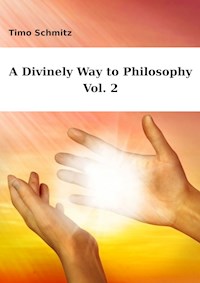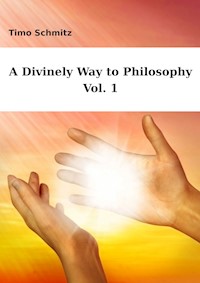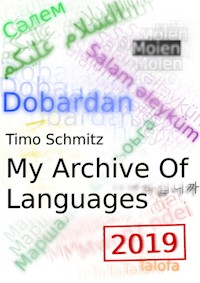16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Graf Berthold Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Dieses Sammelband enthält ausgewählte Artikel des Philosophen und Autors Timo Schmitz (* 1993), welche sich hauptsächlich um philosophische und politische Themen drehen, jedoch wird auch Religion angesprochen. So gibt Schmitz einen Einblick in verschiedene indigene Religionen, behandelt aber auch jüdische Themen, da ihm das Judentum sehr am Herzen liegt. Im vorliegenden Band befinden sich neben seinen Erklärungen zur platonischen Philosophie u.a. die Artikel "Über die Gleichberechtigung", "Sind Tiere moralisch relevant?", "Prinzipien der Homosexualität und Transgender im Judentum", "Falsche Wirklichkeit oder realer Traum?" und "Moralische Schuld und schlechtes Gewissen (Nietzsche, Über die Genealogie der Moral)".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1297
Ähnliche
Kurze Zusammenfassung des Kerns der politischen Lehre Jean-Jacques Rousseaus
Bei Rousseau ist der Naturzustand lediglich ein gedachter Zustand. Er hat nie existiert, da Gott den Menschen direkt in eine Welt jenseits des Naturzustands gesetzt hat und daher nie im reinen Naturzustand lebte. Ein monarchistisches Denken basierend auf dem Gottesgnadentum lehnt Rousseau ebenso ab wie Parteien, da Parteien lediglich Sonderinteressen vertreten und damit nie den Gemeinwillen repräsentieren können. Jedoch geht es bei Rousseau genau um eine solche Repräsentation des Gemeinwohls. Er schlägt daher den Gesellschaftsvertrag vor, indem jeder innerhalb der Gesellschaft sich dem Anderen veräußert. Da jeder dies tut, gibt es niemandem, dem das alleinige Recht einem gegenüber gehört, und damit auch keinen Menschenbesitz, wie zum Beispiel Sklaven oder königliche Untertanen, da alle komplett gleich sind. Dieses radikale Gleichheitsdenken zeigt sich im volonté générale, dem Gemeinwille (der dem Gemeinwohl gewidmet ist). Der Einzelwille ist ebenso wie die parteiischen Sonderinteressen äußerst verwerflich, da er nicht der Gemeinheit dient. Gleiches gilt für den volonté de tous, der Wille Aller, der lediglich die Summe aller Einzelwillen aufzeigt, jedoch dem Gemeinwille nicht würdig ist, da der Gemeinwille vollkommenes Wissen aller Umstände und höchste Vernunft voraussetzt und damit unfehlbar wäre.
Das praktische Problem bei Rousseau ist jedoch, dass es sich hierbei um ein ganzes Volk vereint in einer Person handelt und damit vernünftig und demokratisch betrachtet weder reell umsetzbar, noch gegenständlich begreifbar ist (da es keinen unfehlbaren Menschen gibt, der alle noch so gegensätzlichen Interessen der Menschen in sich vereint). Es handelt sich daher eher um eine metaphysische Utopie, in der das monarchische Gottesgnadentum, durch ein all-vernünftiges Gemeinwesen im Sinne von „einem gemeinen Wesen“ (als Einzelkörper) ersetzt wird. Dieses handelt dann nicht im Interesse von Einem, sondern im Interesse Aller.
Für Rousseaus Theorie, siehe:
Jean-Jacques Rousseau: Du contrat social ou Principes du droit politique. Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts, Französisch/Deutsch. Stuttgart: Reclam, 2010.
Veröffentlicht am 22. April 2018
„Drei normative Modelle der Demokratie“ nach Habermas
Im neunten Kapitel von Jürgen Habermas‘ „Die Einbeziehung des Anderen“ werden drei normative Modelle der Demokratie vorgestellt. Zum einen handelt es sich um die zwei klassischen Modelle des Liberalismus und des Republikanismus, und zum anderen um die von Habermas entwickelte Diskurstheorie, welche seine Bedenken gegenüber beiden Einzelpositionen aufheben soll und wichtige Kernelemente verbindet.
Der Liberalismus sieht in seiner Grundlage vor allem das Individuum vorranging vor höheren Institutionen, wie z.B. dem Staat, wobei eine garantierte Freiheit vor Willkür oder einer absoluten Machtausdehnung schützen soll (Anti-Totalitarismus). Die liberale Auffassung des demokratischen Prozesses liegt laut Habermas darin, dass ein Staat im Interesse der Gesellschaft sein, gar „programmiert“ werden solle. Dabei ist der Staat ein Apparat der öffentlichen Verwaltung, die Gesellschaft wiederum ein marktwirtschaftlich strukturiertes System, mit der Privatperson als Geschäftstreibenden. Die Politik soll in diesem Zusammenhang den Staat in seiner Macht begrenzen, indem sie eine Bündelung aller Privatinteressen gegen den Staatsapparat als solchen, der sich kollektiven Zielen verpflichtet fühlt, durchzusetzen versucht (Habermas, 1999: 277).
Dementgegen sieht der Republikanismus vorranging nicht die Einzelinteressen oder gar deren Aggregation, sondern vertritt einen integrativen Prozess, indem Repräsentanten gewählt werden, die eine Hoheitsgewalt über die Individuen besitzen und bürgerliche Pflichten einfordern können. Habermas sieht daher im Republikanismus die Politik nicht als vermittelndes Element zwischen Staat und Gesellschaft, wie es im Liberalismus der Fall ist, wo die Politik die gegensätzlichen Interessen der beiden Träger ausbalanciert. Republikanismus ist ein Prozess der Vergesellschaftung, wobei die Politik sittliche Lebenszusammenhänge reflektieren soll (ibid.). Damit ist sie ein Medium zur Bildung von Solidargemeinschaften, in denen der Staatsbürger die Angewiesenheit auf das Staatssystem anerkennt. Es gibt somit eine klare Hoheitsgewalt, wobei die Märkte jedoch dezentralisiert reguliert werden sollen. Neben administrativer Macht und Eigeninteressen ist daher die Solidarität eine wichtige Quelle (Habermas, 1999: 278). Das heißt: bürgerliche Autonomie der Zivilgesellschaft auf der einen Seite, aber Integration in das staatsbürgerliche Wesen.
Habermas hebt dabei hervor, dass beide Denkströmungen einige unvereinbare Elemente besitzen. So ist der Staatsbürger im Liberalismus ein Träger subjektiver Rechte, der den Schutz des Staates genießt, gleichzeitig aber vor Interventionen in sein Privatinteresse geschützt ist. Die Privatinteressen sollen dabei zur Geltung kommen, indem sie durch Stimmabgabe die Zusammensetzung in zentralen staatlichen Organen so beeinflussen können, dass die Interessen in den parlamentarischen Körperschaften und administrativen Organen aggregiert werden (Habermas, 1999: 279). Man spricht hier von negativer Freiheit. Nach republikanischem Verständnis dagegen soll nicht die Intervention in bestimmte Bereiche verhindert werden, sondern die Teilnahme und Partizipation am System garantiert werden (positive Freiheit). Nur durch die politische Beteiligung kann die Gesellschaft zu dem gemacht werden, was sie sein möchte (nämlich eine Gemeinschaft, in der alle frei und gleich sind). Das heißt, dass im Republikanismus, alle Bürger selbstbestimmt und autonom sind. Durch ihre Selbstbestimmungspraxis werden öffentliche Institutionen geschaffen, die ihre Freiheit schützen (kommunikatives Modell). Der Staat soll durch Verständigung Ziele und Normen des gemeinsamen Interesses festlegen (vgl. Habermas, 1999: 280).
Ein ähnliches Problem ist der Begriff des Rechts selbst. Für Liberalisten gilt es gegebenenfalls zu prüfen, welche Rechte einem Individuum zustehen, wobei sich alle Rechte in einem höheren Recht gründen, während Republikaner eine objektive Rechtsordnung vertreten, in der Gesetze das Resultat des politischen Willens, begründet in der Kommunikation mit der Gemeinschaft, bilden, wobei die Gemeinschaft dem politischen Körper das Recht zur Begründung von Rechten – die durch die reziproke Anerkennung eines jeden Staatsbürgers und seinen Rechten und Pflichten in gleichen Maßen (= symmetrische Anerkennung) begründet wird – gibt. Dabei sind die Fragen nach Staatsbürgertum und Recht lediglich Probleme eines eigentlich viel tiefergreifenden Problems, nämlich dem Verständnis des politischen Prozesses überhaupt und wie sich dessen Natur konstituiert. Nach liberaler Auffassung streben kollektive Akteure nach dem Machterhalt, während die Politik selbst Ausdruck eines Kampfes um Positionen ist. Wahlen dienen daher dazu, die Personen und Programme zu affirmieren, wobei der Erfolg dieser umso größer ist, je mehr Wählerstimmen sie bekommen. Umgekehrt zeigt sich auch deren Misserfolg. Die Beurteilung eines Wahlaktes ist gleich erfolgsorientierter Marktteilnehmer (vgl. Habermas, 1999: 282). Republikaner dagegen verwehren sich Politik und Ökonomie als strukturell-identische Prozesse zu betrachten. Demnach gehorcht die Politik einer ganz eigenen Struktur, nämlich die der verständigungsorientierten öffentlichen Kommunikation (Habermas, 1999: 282). Ausschlaggebend ist also nicht der Markt, sondern das Gespräch. Somit ist der stetige politische Meinungskampf und -austausch eine unerlässliche Grundlage. Dabei sind die Mächte selbst eingeschränkt, da die Gesetze auch für sie gelten und es keinen höheren Anspruch auf Missachtung dieser gibt. Denn die Legitimation erfolgt durch den demokratischen Prozess, der das Gesetz hervorgebracht hat (und zwar durch kommunikativen Austausch). Habermas sieht beide Demokratiemodelle in den Gruppen der Kommunitaristen und den Liberalen verwirklicht (s. Habermas, 1999: 283).
Die Kommunitaristen sind republikanisch organisiert, wobei ihr Ziel eine Selbstorganisation durch die Bürger ist, die sich kommunikativ vereinigen. Jedoch ist die Gruppenbildung durchaus problematisch, da alle sich zusammenvereinigten Gesellschaften vorangesetzten Tugenden unterwerfen müssen, die das Gesellschaftsverständnis erst ermöglichen bzw. dauerhaft sichern. Ein besonderes Problem ist der Umgang mit Minoritäten sowie wertorientierten Konfliktlagen, die keine Aussicht auf Konsens haben und daher eines Ausgleichs bedürfen (vgl. Habermas, 1999: 284). Daher müssen sowohl eine Kompromissbereitschaft als auch moralische Grundsätze vorhanden sein. Vor allem die moralischen Grundsätze müssen höher wiegen als die konkrete Rechtsgemeinschaft, sodass sie eine universal-anerkannte Gültigkeit erlangen. Ausschlaggebend für eine deliberative Politik – also eine öffentlich-zugängliche Politik durch Teilhabe der Bürger an kommunikativen Prozessen – sind die Kommunikationsverfahren und -möglichkeiten. Nur durch eine aktive Integration im öffentlichen Diskurs, ist also eine solche deliberative Politik möglich.
Habermas schlägt daher ein drittes Modell vor, welches vor allem auf die deliberative Komponente zielt. Dabei nimmt er stärkere normative Konnotationen an, als dies im liberalen Spektrum zu erwarten wäre, wo der Staat vor allem ein Störfaktor für das Individuum ist; aber schwächer als dies im Republikanismus zu erwarten wäre, wo die Gesellschaft sich zwar im Staat zentriert, der Staat sich jedoch mit der Zeit so verselbstständigt, dass er sich von der Gesellschaft trennt, und die Gesellschaft diesen Missstand wieder korrigieren muss. Anders als im Republikanismus, wo die Politik als kollektiver Akteur, als eine Art „Ganzes“ gesehen wird, sieht Habermas die Akteure als abhängige Variable. Somit steht auch nicht mehr die kollektive Handlungsfähigkeit im Vordergrund, sondern die Institutionalisierung. Dieses Modell, welches Habermas als Diskurstheorie bezeichnet, ist sehr stark von kommunikativem Handeln geprägt, wobei Habermas vor allem das Verständnis des kommunikativen Handelns durchleuchtet. Es gibt kein im Staat zentriertes Ganzes, sondern jedes Individuum vollzieht für sich seinen Wahlakt, sodass es keine bewusstvollzogenen kollektiven Entscheidungen geben kann. Alle Entscheidungen sollen durch Kommunikation und Beratung in politischen Gremien sowie durch das Kommunikationsnetz öffentlicher Politiken vollzogen werden (vgl. Habermas, 1999: 288). Für Habermas ist besonders wichtig, dass alle politischen Ordnungen gewaltfrei sind und ein Konsens rein argumentativ erzielt werden soll, sodass jedwede Entscheidung letztendlich „in einem argumentativ erzielten Konsens der Beteiligten begründet werden könnte“ (Habermas, 1973: 144). Jenseits des besseren Arguments gibt es keinen Zwang, sodass ein Konsens nur das ermöglicht, „was alle wollen“ (Habermas, 1973: 148). Das bedeutet, dass letztendlich keine Einzelinteressen den entscheidenden Ausschlag geben können, sondern alle Interessen verallgemeinerbar sein müssen (verallgemeinerbare Interessen). Die Konsensfindung soll in Arenen stattfinden, wo die Meinungsbildung aggregiert und Positionen durch Kommunikation ausgetauscht werden. Letztendlich soll dies zu institutionalisierten Wahlentscheidungen führen. Anders als im republikanischen Modell, wird die Solidarität nicht mehr allein aus kommunikativem Handeln geschöpft, sondern durch rechtsstaatlich gesicherte Institutionen (s. Habermas, 1999: 289). Zudem wird ähnlich wie im Liberalismus, die Grenze zwischen Staat und Gesellschaft in der Diskurstheorie respektiert. Dabei kann in der Diskurstheorie die Öffentlichkeit nicht selber herrschen, sondern lediglich Impulse geben, während das politische System der alleinige Akteur ist. Eine deliberative Politik ist dabei stets auf die „Ressourcen der Lebenswelt“, kurzum der Meinungs- und Willensfreiheit sowie der politischen Sozialisation angewiesen. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die Kommunikationsströme in stetigem Fluss befinden und sich ständig regenerieren, sodass der Diskurs immer aufrechterhalten wird (vgl. Habermas, 1999: 291 f.). Damit wird verhindert, dass politische Institutionen sich verselbstständigen und in einem geschlossenen System an der Öffentlichkeit vorbeiregieren.
Quellen:
Habermas, Jürgen: Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1973.
Habermas, Jürgen: Die Einbeziehung des Anderen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1999.
Veröffentlicht am 26. April 2018
Der Kontraktualismus des John Rawls im Überblick
Der Kontraktualismus ist eine auf Vertragswerke – also Kontrakte – basierende Philosophietheorie, die auch als Vertragstheorie oder Gesellschaftsvertrag bekannt ist. Obgleich es Vertragstheoretiker seit der Antike gibt und Vertragsmodelle in der Neuzeit von Thomas Hobbes, John Locke und Jean-Jacques Rousseau aufgegriffen wurden, ist der moderne Kontraktualismusbegriff vor allem durch die Kritik des John Rawls an ebendiesen geprägt. Ausgangspunkt der neuzeitlichen Vertragstheoretiker ist der Naturzustand. Vor allem Rousseau bemängelte, dass sowohl Hobbesʼ als auch Lockes Naturzustand jeweils als real-angenommener oder zumindest als theoretisch existenter Naturzustand, wenn auch im Gedachten, proklamiert wird. Zudem bildet Hobbes den Naturzustand, indem er die bürgerliche Gesellschaft in einen vorrangigen Naturzustand projiziert und damit zivilisatorische Entwicklungen ohne Hinterfragung übernimmt.1 Und gerade Locke rechtfertigt die Vereinnahmung von Ländern „primitiver“ Völker mit ihrem Leben im Naturzustand und damit, dass diese Völker aufgrund mangelnder Veredelung noch keine Eigentumsverhältnisse als solche kennen würden.2 Rousseau dagegen greift heraus, dass der Mensch niemals im Naturzustand vorkam und daher jede Form des Naturzustandes lediglich gedacht werden kann.3
All die genannten Theorien, einschließlich Rousseaus, haben jedoch den Nachteil, dass der Naturzustand als etwas vormenschliches angenommen wird, was wiederum bedeutet, dass der Mensch durch den Naturzustand bereits in seinem Bewegungsspielraum prädestiniert ist, da er vormenschlichen Regeln unterworfen wäre. Genau hier setzt Rawls ein, der von einer original position (Urzustand) spricht und kein dem Menschen vorangegangenes Konstrukt darstellt. Ganz im Gegenteil, „It is designed to be a fair and impartial point of view that is to be adopted in our reasoning about fundamental principles of justice. In taking up this point of view, we are to imagine ourselves in the position of free and equal persons who jointly agree upon and commit themselves to principles of social and political justice.”4 Die Möglichkeit eines fairen Ausgangspunktes, indem die Vernunft maßgeblich ist, kann nur angenommen werden, wenn der Mensch selbst am Anfang steht und den Ausgangszustand schafft. Da der Urzustand niemals wirklich existiert hat und lediglich ein hypothetisches Experiment ist, nimmt Rawls an, dass in diesem Zustand ein Schleier des Nichtwissens stehen solle, um die gesellschaftlichen Normen zu definieren. Der Schleier des Nichtwissens ist ein ebenfalls rein hypothetisches (und praktisch nicht plausibles) Konstrukt, indem man davon ausgeht, dass jeder Mensch sich seiner Identität nicht bewusst ist. Das bedeutet, er weiß nichts von seinem Geschlecht, seiner Herkunft oder Religion. So wird der interessenbehaftete Mensch von seinen Partikularinteressen gesäubert, denn wenn er nicht weiß, ob er zu den Starken oder Schwachen gehört, wird er eine Lösung anstreben, welche pareto-optimal ist (also selbst noch dem Schwächsten einen Vorteil bringt), denn jeder Mensch könnte ja selbst zu den Schwächsten gehören. Oder anders ausgedrückt: Ich selbst könnte ja zu den Schwachen gehören, also setze ich mich auch für die Schwachen ein. Damit verteile ich alle moralischen Standpunkte fair und gerecht, da ich nicht von eigenen Interessen eingeschränkt werde, die mich an deren Eingeständnis hindern würden. Daraus kann der Mensch letztlich eine Vertragstheorie der gerechten Verteilung von Gütern entwickeln. Dabei rücken zwei Normen in den Vordergrund. Erstens das Prinzip der gleichen Freiheit (principle of equal liberty), welches jeder Person das gleiche Recht auf das umfassendste Gesamtsystem eingesteht und somit alle Zugriff auf die gleichen Grundfreiheiten haben. Zweitens das Differenzprinzip (difference principle), wonach soziale und ökonomische Ungleichheiten so beschaffen sein sollen, dass sie noch zum größten Vorteil der am schlechtesten Gestellten sind (Pareto-Optimalität).
Dieses durch und durch deontologische Prinzip bringt erhebliche Probleme mit sich. Zum einen handelt es sich hier nur um ein gedachtes Konstrukt. Da es aber unmöglich realisierbar ist, wird es nicht möglich sein, mit diesem Experiment die Gesellschaft gerechter zu machen. Weder das Prinzip der gleichen Freiheit noch das Differenzprinzip sind praktikabel, da die Partikularinteressen immer mitschwingen werden. Da jeder Mensch von seiner Identität weiß, werden die Mächtigen stets verhindern, ihre Macht zu verlieren und auf die Expansion ihres Machteinflusses bauen. Damit werden Normen auch weiterhin so normiert, dass sie den Starken und nicht den Schwachen helfen. Dies gilt auch für den Sozialbereich und bei Umverteilungen – am Ende trifft es immer die in der Mitte.
Peter Carruthers geht sogar noch weiter und überträgt die Rawls’sche Vertragstheorie auf Tiere. Haben Tiere im Urzustand eine moralische Relevanz? Scheinbar nicht. Denn das Normensystem des Kontraktualismus setzt rationale Akteure als Subjekte der Interaktion voraus. Da Tiere selbst keine rationalen Akteure sind, können sie keine direkten Rechte für sich beanspruchen. Auch das Stellvertreterargument, in dem jemand für die Tiere spricht, scheitert daran, dass niemand wirklich genau sagen kann, welches Interesse ein Tier in einer bestimmten Situation hat. Daher können Vertreter tierlicher Interessen im Urzustand nur zugelassen werden, um sicherzustellen, dass die Tiere einen moralischen Status haben, indem sie vor Folter und willkürlichem, vermeidbarem Leid geschützt werden.5 Das Problem bei Carruthers zeigt sich jedoch in dem Text aus dem Sammelband von F. Schmitz, indem Carruthers davon ausgeht, dass der Akteur sich bei Vertragsschluss doch faktisch schon auf seine vorherigen moralischen Überzeugungen stützt. Das ist insofern problematisch, da es vor dem Urzustand keine Moral gibt. Der Vertrag dient ja gerade der Schaffung der Moral; anders als bei den klassischen Philosophen, wo der Mensch von Anfang an – selbst in einem nur gedachten Naturzustand – von der Moral des Naturzustandes bestimmt wird. Das bedeutet auch, dass nach dem Durchexerzieren der Moralbegründung am Ende herauskommen könnte, dass unsere derzeitige Moral nicht haltbar ist und eigentlich ganz neue effizientere Normen etabliert werden müssten. Würde man von vorneherein davon ausgehen, dass das Experiment nur die bestehende Moral affirmieren soll, so wäre der ganze Gedankengang völlig unnötig, da er dann von Anfang an von unseren Moralannahmen bestimmt und gelenkt werden würde. Damit wäre er als Nachweis der Sinnhaftigkeit unseres Moralsystems unzulässig, da er nichts aussagen würde. Daher lässt sich allerhöchstens eine indirekte moralische Relevanz von Tieren verteidigen.
Es stellt sich dann desweiteren die Frage, inwiefern Rawls in der Anwendung letztlich noch Sinn macht, denn der Mensch muss sich des Mensch-Seins bewusst sein, um seiner Selbst als rationaler Akteur bewusst zu sein und als Mensch mit Bewusstseinsfähigkeit wird er immer auf seine Interessen bedacht sein. Vor allem wenn er weiß, dass es ihm in seiner derzeitigen Position gut geht – auch unter der Annahme, dass er nicht weiß, wer er ist –, so besteht wenig Interesse daran, etwas zu ändern, solange es ihm gut geht (da er ja nicht weiß, ob eine Veränderung der Position dazu führt, dass es ihm nicht mehr so gut geht). Rawls versucht jedoch seine These zu verteidigen, indem er sie als politisch und nicht-metaphysisch klarstellt. Sein politischer Liberalismus darf nicht mit den Werten des metaphysischen Liberalismus vermischt werden. Das bedeutet, dass er schon gar nicht mit der Ethik in Kontakt geraten darf. Denn man wird nie einen gesamtgesellschaftlichen Konsens in Moral, Religion und Philosophie finden. Werden diese drei Fragen von der Politik gelöst führt dies zu Unterdrückung. Wird ein demokratisches Forum darüber entscheiden und eine vermeintlich wahre Meinung zum Diskurs gestellt führt dies zwangsläufig zu Unfrieden in der Gesellschaft. 6 Auch Kompromisse und ein kleinster gemeinsamer Nenner sind höchst problematisch, da sie jeweils die Aufgabe von tiefwurzelnden eigenen Überzeugungen, die mitunter ein Teil der Identität sind, fordern würden. Auch Interessenparteien könnten Rawlsʼ Politikbild nicht gerecht werden, da sie stets zu schwach wären um ihre Agenden umzusetzen und folglich ein zu geringes Potential für Policy-seeking hätten. Das ist fast selbsterklärend, da Klientelparteien stets nur einen kleinen Teil der Bevölkerung erreichen. Umgekehrt sind Catch-all-parties, also Volksparteien, äußerst ungeeignet, da sie sich nur auf das Office-seeking konzentrieren und versuchen möglichst viele Ämter zu bekleiden, wobei die Inhalte verloren gehen. Dass Parteien ideologischer oder dogmatischer Strömungen für Rawls ebenso ausgeschlossen sind ergibt sich aus dem oben genannten fast von selbst, da sie die freie Meinungsbildung (public reason) einschränken.7
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Rawlsʼ Grundmodell sehr verstrickt ist. Zum einen entwickelt er eine Vertragstheorie, die die rationale Moral des Menschen begründen und zu einer pareto-optimalen Situation führen soll. Auf der anderen Seite soll letztlich die Ethik von der Politik getrennt werden, weswegen er sich für einen politischen Liberalismus entscheidet, der für alle politischen Lager annehmbar ist. Allerdings lässt sich aus dem Rawls’schen Kontraktualismus eine Tierethik ableiten, die den moralischen Wert der Tiere und daraus deren Interessen bzw. Rechte definiert. Demnach haben laut Carruthers Tiere keine moralische Relevanz, da sie ihre Interessen nicht artikulieren können und lediglich rationale Akteure eingebunden sind (wobei auch nicht-rationale Akteure der Species Mensch – z.B. Kinder – durch Stellvertreter berücksichtigt werden). Daraus lässt sich schlussendlich folgern, dass man im Rawls’schen Kontraktualismus nur moralisch-bedingte Rechte genießen kann, wenn man selbst in der Lage ist, moralischen Pflichten nachzukommen (vgl. Kant).
Literatur:
Für Hobbes Naturzustand siehe Thomas Hobbes:
Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates
. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1989, S. 99.
Für Lockes Naturzustand siehe John Locke:
Über die Regierung
. Stuttgart: Reclam, 1974, S. 5-7.
vgl. Jean-Jacques Rousseau:
Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes
.
1754. Gemeinfrei verfügbar; Timo Schmitz:
The dilemma of natural law in an organised society
(8 June 2017). In: Timo Schmitz: Selected English Articles, 2014-2017. Berlin: epubli, 2020.
Samuel Freeman:
Original Position
. Stanford Enyclopedia of Philosophy, 2014.
https://plato.stanford.edu/entries/original-position/
, aufgerufen am 15. Mai 2018.
s. Peter Carruthers:
Kontraktualismus und Tiere
. In: Ursula Wolf (Hrsg.): Texte zur Tierethik. Stuttgart: Reclam, 2008, S. 78-91; Peter Carruthers:
Warum Tiere moralisch nicht zählen
.
In: Frederike Schmitz (Hrsg.): Tierethik: Grundlagentexte. Berlin: Suhrkamp, 2014, S. 219-242.
s. John Rawls:
Political Liberalism
. New York: Columbia University Press, 1999
.
s. Rawls, 1999; John Rawls:
A Theory Of Justice
. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 2009.
Veröffentlicht am 15. Mai 2018
Sind Tiere moralisch relevant?
Die Frage, ob Tiere moralisch relevant sind, ist eine sehr schwierige Frage, die durch verschiedene Strömungen beantwortet werden kann, wobei keine die endgültig wahrhaftige Antwort liefert. Dabei ist es wichtig, oftmals zuerst zu schauen, welchen Standpunkt eine ethische Strömung über den Menschen vertritt, um daraus auf Argumente bezüglich Tieren zu schließen. Der Utilitarismus zum Beispiel kennt keine aus sich heraus verbrieften Menschenrechte, sodass Tierrechte gar nicht in Frage kommen. Den Menschen kommt keine besondere Würde zu, sodass er es im krassesten Fall nicht ausschließt ein Menschenleben zu opfern, sofern es für das Kollektiv gut ist. Der Utilitarismus kennt nämlich keine Individuen, sondern nur Gruppen. Ziel ist es, dass Glück für alle zu maximieren und das Leid zu mindern. Steigert eine Handlung den Lustgewinn für die gesamte Gesellschaft und erweist sie sich als nützlich gilt sie als gut. Peter Singer schlägt einen Präferenzutilitarismus vor. Das bedeutet, dass die Interessen der Beteiligten gewichtet werden. Dabei gibt es nicht ein Interesse, was per se mehr wert ist.1 Vor allem sind die eigenen Interessen potentiell nicht mehr wert, weil sie die eigenen sind, sodass man die Interessen aller anderen ebenfalls gleichwertig zu berücksichtigen hat, um diese dann auf ihre Gewichtung zu überprüfen.2 Zudem sollte man das Bestreben, seine eigenen Interessen befriedigt zu bekommen auch auf die Interessen der anderen ausweiten. Es ist daher jener Handlungsverlauf zu wählen, der für alle von der Entscheidung betroffenen Interessenträger die besten Konsequenzen hat.3 Dabei gelten alle Lebewesen als Interessenträger, die in der Lage sind Leid zu verspüren – welches im Utilitarismus ja minimiert werden soll. Somit sind durchaus auch Tiere zu berücksichtigen. Jedoch ist der Mensch nicht per se den Tieren übergeordnet.4 Kleine Kinder oder Behinderte können durchaus geringere Interessen verfolgen als manche Tiere, da ihre Fähigkeit Interessen zu entwickeln eingeschränkt sein können. Das heißt, das nicht nur die Interessen unterschiedlich zu gewichten sind, sondern auch die Interessenträger, wobei es egal ist, ob der Interessenträger ein Mensch oder eine Maus ist.5 Eine solche Ethik ist jedoch meines Erachtens höchst zweifelhaft, da der Mensch als solcher nicht nur keine natürlichen Schutzrechte mehr gegenüber den Tieren genießt, sondern der Mensch an sich nicht mehr geschützt ist. Das lässt sich soweit ausdehnen, dass Menschen zu Gunsten der Gesellschaft liquidiert werden könnten und sogar Peter Singer verteidigt teilweise die Euthanasie von schwerbehinderten Kleinkindern in seiner Praktischen Ethik. Eine utilitaristische Ethik ist daher stets höchst problematisch, da Minderheiten sehr leicht unter die Räder kommen und die Würde des Menschen zu Gunsten der Nutzenmaximierung komplett entfällt. In der Praxis zeigte sich dies im Nationalsozialismus in der millionenfachen Vernichtung so genannten „unwerten Lebens“ und in der Umweltpolitik der USA, zum Beispiel durch Fracking, welches die Umwelt und damit den Menschen stark belastet, nur um scheinbar einen Nutzen daraus zu maximieren. Eine utilitaristische Ethik muss also strikt abgelehnt werden. Menschenrechte sind unverzichtbar und lassen sich aus der Geschichte begründen. Es gilt daher: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn eine Theorie schon dem Menschen keinen besonderen Schutz eingesteht, ist es fraglich, wie man dann eine sinnvolle Ethik bezüglich Tieren ableiten kann, zumal die Gefahr besteht, dass dann am Ende einige Tiere dem Menschen vorzuziehen wären, wenn sie ein tiefgreifenderes Interesse entwickeln könnten als zum Beispiel ein bestimmter Mensch, der, warum auch immer, nicht dazu in der Lage wäre. Um ausgehend vom Menschen sinnvollerweise Tierrechte ableiten zu können, bedarf es also einer anderen Theorie.
Tom Regan sagt, dass jedes Subjekt-eines-Lebens einen inhärenten Wert besitzt. Somit begründet sich eine Würde, die unantastbar ist. Dabei haben alle Wesen, die einen inhärenten Wert haben jeweils den gleichen inhärenten Wert, sodass ihr Geschlecht, ihre Religion, etc. keine Rolle spielen und man kein Subjekt-eines-Lebens bevorzugen darf.6 Ein Subjekt-eines-Lebens kann eigene Empfindungen verspüren und ein eigenes Wohl verfolgen. Da einige Tiere unter diese Definition fallen sind sie ebenfalls Subjekte-eines-Lebens und haben damit auch einen inhärenten Wert.7 Das bedeutet auch aus vorher genanntem, dass diese keinen geringeren Wert besitzen als Menschen. Regan richtet sich also gegen den Speziesismus, d.h. dass man einer gewissen Spezies den Vorrang gibt.8 Wie begründet Regan nun aber die Menschenrechte? Es ist ihm ungenügend zu sagen, Menschen haben einen inhärenten Wert, weil sie Menschen sind.9 Ebenso wenig zulässig ist die Argumentation, dass Menschen moralisch verantwortlich sind und über ein Selbstbewusstsein verfügen.10 So hätten nämlich Babys und Behinderte womöglich keine Rechte, da diese eventuell über ein geringeres moralisches Verständnis verfügen, sodass diese marginal cases problematisch sind. Dass auch jene Menschen ein Anrecht auf grundgesicherten Schutz haben versteht sich von selbst, da sonst Umstände vorherrschten, wie man sie beim Utilitarismus erwarten könnte. Ebenso gilt das Argument nicht, dass Menschen Sprache verstehen, da auch Menschen, die keine Sprache verstehen Rechte haben sollen und auch die Bildung von Rechtsgemeinschaften sagt nichts über das Recht und dessen Angemessenheit an sich aus.11 Damit bleibt nur das oben genannte Argument übrig, dass Menschen Rechte haben, weil sie Empfindungen besitzen. Es sollte im Interesse jedes Menschen sein, keinem anderen Menschen Leid zuzufügen, schließlich möchte man selbst ja ebenfalls nicht leiden. Das gleiche lässt sich auf jene Tiere übertragen, die ebenfalls unversehrt leben und frei sein möchten.12 Daraus lässt sich also der inhärente Wert für Tiere, der oben bereits eingeführt wurde, anschaulich zeigen. Es lässt sich sogar eine Beistandspflicht ableiten, indem man Subjekten-eines-Lebens, die sich selbst nicht wehren können, Beistand leistet und sich für ihre Rechte einsetzt.
Nach Kant jedoch, gibt es keine direkte moralische Relevanz, wie sich aus §16 der Metaphysik der Sitten ableiten lässt. Dort schreibt Kant, dass der Mensch lediglich Pflichten gegenüber Menschen hat, sowohl gegen sich selbst als auch gegen andere. Da nun andere Wesen keine Vernunft besitzen, kann man ihnen keine Pflichten zuschreiben. Wenn sie jedoch keine Pflichten haben, so hat man auch keine Pflichten ihnen gegenüber. Jedoch gibt §17 bereits Einschränkungen dazu. So dürfen Tiere nicht aus Lust zur Qual gewaltsam behandelt werden, da der Mensch sonst verroht und sein Mitgefühl verliert und auch Haustieren und Behilfstieren ergibt sich eine indirekte Pflicht aus Dankbarkeit ihnen gegenüber, damit ist sie aber auch eine direkte Pflicht gegen sich selbst. Jedoch mag es Gründe für eine schmerzfrei verrichtete Tötung von Tieren geben die unter die Befugnisse des Menschen fallen. Auch Christine Korsgaard greift das Kant’sche Argument auf. Sie spricht von Lebewesen, für die etwas gut oder schlecht ist, welche sie mit „Organismen, die sich ihrer Welt bewusst sind“ gleichsetzt, wobei sie zwischen menschlichen Tieren und nicht-menschlichen Tieren unterscheidet, was eigentlich absurd ist, da der Mensch sich deutlich von den Tieren unterscheidet und nicht zu diesen gehört, auch wenn er gewiss noch tierische Triebe in sich trägt. Dabei gibt es das natürlich Gute und natürlich Schlechte, wobei es, da es von Natur aus gut oder schlecht ist, in sich selbst schon gut oder schlecht ist, also ein ‚deon‘ besitzt und damit direkt auf die Kantische Deontologie verweist. Theoretisch gäbe es zwei moralisch relevante Unterschiede zwischen Menschen und Tieren, die eine Andersbehandlung erlauben. Zum einen bestehen Unterschiede darin, inwiefern etwas gut oder schlecht für Menschen sein kann im Unterschied zu dem Guten oder Schlechten für Tiere und zum anderen ist es die Art der Verpflichtung.13 So kann die Verpflichtung den Menschen gegenüber eine Andere sein wie bei Tieren. Aber: Korsgaard lässt das Argument nicht gelten, dass nur weil Tiere nicht die Potentialität der menschlichen Vernunft haben, diese gleichzeitig keine Rechte bzw. wir keine Pflichten ihnen gegenüber haben.14 Daraus ergibt sich bei Korsgaard dann eine direkte moralische Relevanz, denn wir sollen die grundlegende Bedürfnisbefriedigung, die wir für den Menschen als objektiv gut ansehen auch für Tiere als objektiv gut ansehen. Dies führt dann zu moralisch weiterführenden Fragen. So stelle ich mir die Frage, ob Fortpflanzung eine natürliche Bedürfnisbefriedigung darstellt oder nur durch eine natürliche Bedürfnisbefriedigung dargestellt wird. Ist die Fortpflanzung an sich für die Tiere ein objektives Gut, so dürften wir Katzen nicht kastrieren, da wir in ihre Familienplanung eingreifen, ohne dass die Katze ihren Willen kundgetan hat, während der Mensch selbst über seine Familienplanung entscheiden und verhüten kann. Zweifelsfrei lässt sich Korsgaard aber auf basalere Probleme anwenden: Da die Bewegungsfreiheit objektiv gut für Menschen ist, sollte man Tiere nicht in enge Käfige einsperren und ihnen nicht ihren Bewegungsfreiraum verwehren, ebenso wie wir nicht eingesperrt werden wollen.
Bisher lassen sich drei Grundströmungen herausstellen: Zum einen der Utilitarismus, der weder Menschen noch Tieren verbriefte Rechte zuschreibt und damit keine grundlegende moralische Relevanz für jedwedes Lebewesen begründet; zweitens der Ansatz von Regan, der jedem empfindungsfähigen Lebewesen ein Subjekt-eines-Lebens zuspricht und ihnen damit unantastbare Rechte gibt, die für alle Wesen gelten, die ihrer Potentialität nach diese Fähigkeit haben, selbst wenn einzelne Individuen aufgrund einzelner Ursachen, diese Fähigkeit nicht explizit besitzen; und drittens der Kantianische Ansatz, indem man nur Pflichten gegen andere Vernunftwesen bzw. potentiell-vernünftige Wesen und damit den Menschen hat, während man Tiere nicht quälen oder Leiden lassen soll, um eine Verrohung der Menschheit zu verhindern. Korsgaard erweitert diesen Ansatz, indem sie Tieren Grundrechte zuspricht.
Nun soll noch ein vierter Ansatz erklärt werden: der Kontraktualismus, der auf Rawls zurückgeht. John Rawls geht es um die gerechte Verteilung der Güter, weswegen er einen Zustand konstruiert in dem sich niemand über seine eigene Identität bewusst ist und dadurch pareto-optimale Lösungen anstrebt.15 Jedoch ist davon auszugehen, dass das Individuum weiß, dass es ein Mensch ist, da der rationale Akteur vorausgesetzt wird. Carruthers versucht daraus herzuleiten, was dies für die moralische Relevanz von Tieren bedeutet. Da lediglich rationale Akteure die Möglichkeit haben über ein Normensystem zu entscheiden, können Tiere weder an den Normenbestimmungen teilnehmen, noch aktiv Rechte wahrnehmen, da dafür das rationale Entscheidungsvermögen vorausgesetzt wird. Damit sind Tiere moralisch nicht relevant. 16 Auch das Stellvertreterargument greift hier nicht, da Menschen die Interessen von Tieren nicht durchschauen können.17 Die Moral ist also etwas vom Menschen Konstruiertes und für den Menschen Konstruiertes. Man könnte jedoch Tiere zu Gegenständen berechtigten öffentlichen Interesses machen und sie als solche durch gewisse Normen schützen.18 Carruthers ergänzte später, dass er seine Meinung ein wenig modifiziert habe und das Kantische Verrohungsargument gelten lasse. Als Folge führt er ein, dass neben den Normen auch gewisse grundlegende Tugenden eingeführt werden sollen. Die rationalen Akteure müssen sich nicht auf die Regulierung von Verhalten beschränken, sondern langfristige Einstellungen fördern und etablieren.19
Zum Schluss möchte ich noch meine Anschauung über die moralische Relevanz von Tieren einbringen. Ersteinmal ist festzuhalten, dass sowohl Menschen als auch Tiere Lebewesen sind. Da Menschen jedoch die Krone der göttlichen Schöpfung sind und ein Bildnis Gottes darstellen, gilt für Menschen ein absolutes Folter- und Tötungsverbot. Die Pflicht zur Begründung von Menschenrechten begründet sich alleine daraus, dass das Bildnis Gottes durch willkürliche Tyrannei gottloser Despoten zerstört wird. Auch die Tiere sind ein Teil der göttlichen Schöpfung, jedoch stehen sie unter dem Menschen und Gott hat den Menschen die Herrschaft über alle Tiere dieser Welt anvertraut. Daher können Tiere nicht die gleichen Rechte genießen wie Menschen, da Tiere einem anderen göttlichen Plan folgen wie es der Mensch tut. Auch für einen Atheisten wird dies einleuchtend sein, denn die menschliche Vernunft verpflichtet. Wir sind dazu verdammt, uns moralische Regeln aufzuerlegen und auch wenn einzelne Individuen, zum Beispiel Kleinkinder oder Behinderte, eventuell nicht die gleichen Fähigkeiten besitzen, so kommt ihnen dennoch das Mensch-Sein zu und da alle Menschen von Natur aus gleich sind, haben wir auch die gleichen Pflichten ihnen gegenüber, selbst wenn jedes Individuum seine eigene Verstandesfähigkeit besitzt und ein Mensch unterschiedlich intelligent und achtsam sein kann. Tiere dagegen folgen ihren Instinkten, auch dies leuchtet dem Atheist ein, und wenn man den natürlichen Trieb eines Tieres triggert, so folgt es ihm eher wie jeder verstandesmäßigen Logik.
Als Wächter über die Schöpfung müssen wir unsere Umwelt und auch die Lebensmöglichkeiten der Tiere bewahren. Dass ist es ja gerade, was den Utilitarismus so verächtlich macht: das kurzzeitige Glück für eine Gesamtheit an Menschen rechtfertigt die längerfristige Zerstörung seiner Umwelt und damit auch seiner Existenz. Die dem Menschen anvertraute Schöpfung kann in der utilitaristischen Ethik durchaus geschändet werden, ein Menschenleben hat keinen Wert an sich und kann auch Mittel zum Zweck sein. Dabei dürfte es auch im Interesse des Atheisten sein, die Schöpfung zu bewahren, nämlich die intakte Funktionsweise der Natur auf unserer Erde dient auch dem Überleben des Menschen. Zerstört er den ganzen Regenwald, zerstört er auch sich selbst, denn der Regenwald atmet. Insofern hat der Mensch auch die Pflicht, die Tiere zu beschützen und ihren Lebensraum zu sichern. Gleichsam darf kein Tier gequält oder aus rein-finanziellen Interessen getötet werden. Das Schreddern von Küken und die qualvolle Massentierhaltung mögen zwar für einige Großunternehmen rentabel sein, doch auch ein wirtschaftlich nicht verwertbares Küken hat einen Willen zum Leben. Der Wille zum Leben verbietet meiner Meinung nach die qualvolle profit-orientierte Tötung, aber sie ist kein universelles Recht, wie das Menschenrecht. Tiere dienen auch dem menschlichen Nutzen. Ein Huhn darf als Nahrungsmittel getötet werden, um den Hunger der Menschheit zu lindern, aber so sollte es doch zumindest zu Lebzeiten ein glückliches Leben gehabt haben. Auch bedarf es menschlicher Eingriffe zum Schutze vor Seuchen oder vor zu starker Ausbreitung, sodass es den Lebensraum anderer Tiere gefährdet. Jedoch dürfen Tiere nicht des Quälens willen getötet werden, da dies eine Missachtung der Schöpfung ist. Auch Atheisten dürfte dies einleuchten, wenn man ihnen aufzeigt, dass das Quälen von Tieren einen unmittelbaren Einfluss auf diese hat und dies auf Dauer die Verhaltensweisen von Tieren ändert und somit die Natur aus dem Gleichgewicht bringt. Tierversuche sind abzulehnen, da ihre Lebensqualität deutlich eingeschränkt wird und der Mensch nicht Gott spielen darf. Da nun aber Alternativen zu vielen Tierversuchen bestehen, bedarf es eigentlich keiner Tierversuche mehr. Es sei aber als einzige (und absolute Not-)Ausnahme erwähnt, dass Tierversuche dann und nur dann zulässig sind, wenn es um die Erhaltung der Menschheit geht und jegliche Alternative zeitnah nicht organisierbar ist und es sich nicht um selbstbewusstes Leben (zum Beispiel Primaten) handelt.
Abschließend kann gesagt werden, dass Menschen einen inhärenten Wert besitzen, der ihre Unversehrtheit unantastbar macht und garantiert, während Tiere keinen an sich inhärenten Wert, jedoch einen Willen zum Leben haben. Nutztiere müssen so gehalten werden, dass sie diesen Willen frei entfalten können und auf ihre Weise glücklich sind. Der Mensch darf jedoch eingreifen und dieses Leben beenden, wenn es der Erhaltung des Menschen dient (Nahrung, Seuchenprävention, Überpopulation der Tiere), etc. Als verantwortungsbewusstes Wesen muss der Mensch versuchen, natürliche Habitate der Tiere zu schützen und ihnen beizustehen, wenn ihre Existenz in natura auf dem Spiel steht (Regenwaldrodung, Überfischung, etc.).
Literatur:
s. Peter Singer:
Rassismus und Speziesismus
. In: Ursula Wolf (Hrsg.): Texte zur Tierethik.
Stuttgart: Reclam, 2008, S. 25.
Singer, 2008: 25 f.
Singer, 2008: 26.
Singer, 2008: 28 f.
Zum zweiten Abschnitt des Satzes, vgl. Singer, 2008: 30 f.
s. Tom Regan:
Wie man Rechte für Tiere begründet
. In: Ursula Wolf (Hrsg.): Texte zur Tierethik.
Stuttgart: Reclam, 2008,
S. 35.
Regan, 2008: 36 f.
Regan, 2008: 37.
s. Tom Regan:
Von Menschenrechten zu Tierrechten
. In: Friederike Schmitz (Hrsg.): Tierethik Grundlagentexte.
Berlin: Suhrkamp, 2014, S. 96 ff.
Regan, 2014: 98 f.
Regan, 2014: 99 f.
Regan, 2014: 100 ff.
Christine Korsgaard:
Mit Tieren interagieren – Ein kantianischer Ansatz
. In: Friederike Schmitz (Hrsg.): Tierethik Grundlagentexte. Berlin: Suhrkamp, 2014, S. 247 f.
Korsgaard, 2014: 263 ff.
s. John Rawls:
A Theory Of Justice
.
Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 2009; Timo Schmitz:
Der Kontraktualismus des John Rawls im Überblick
.
15. Mai 2018.
Peter Carruthers:
Warum Tiere moralisch nicht zählen
. In: F. Schmitz (Hrsg.), 2014, S. 223 ff.; Peter Carruthers: Kontraktualismus und Tiere. In: Ursula Wolf (Hrsg.): Texte zur Tierethik. Stuttgart: Reclam, 2008, S. 78 ff.
Carruthers, 2008: 80 f.
Carruthers, 2008: 85.
Carruthers, 2008: 90 f.; Carruthers, 2014: 233 ff.
Veröffentlicht am 17. Mai 2018
Federalist Papers, Teil 1: Hamilton und Madison über “The Union as a Safeguard Against Domestic Faction and Insurrection”
Hamilton schlägt in der neunten Schrift ein republikanisches System vor, welches stark genug ist, um sich zum einen nach außen zu verteidigen und zum anderen, um gleichzeitig nach innen Parteiungen zu unterdrücken, die zu einer Korrumpierung der freiheitlichen Ordnung übergehen. Als Negativbeispiele zeigt er die griechischen Stadtstaaten und italienischen Republiken auf, die trotz ihrer hohen Bürgerbeteiligung regelmäßig des Streits und der Tyrannei verfielen. Gleichzeitig lehnt er sich an Montesquieus Idee der Gewaltenteilung an, da vor allem die Trennung von Exekutive und Legislative das politische Gewicht ausbalanciert. Das Problem, was Hamilton nun erkennt ist, dass das Montesquieu’sche Modell selbst nur auf äußerst kleine Territorien anwendbar ist (vgl. Stadtstaaten, etc.). Würde man die Bundesstaaten teilen, würde dies nur dazu führen, dass die Politik verzweigter wird, da mehr Akteure benötigt werden. Es bedarf also einzelner Staaten, die lose und damit noch volksnah sind und in denen keine Korruption auftauchen kann; das Gebiet nach außen hin jedoch stark und abgesichert ist. Ein solches Modell ist die Konföderation, ein loser Staatenbund mit innenpolitischer Souveränität und außenpolitischer Einheit. Wenn in einem Staate jemand zu viel Macht an sich reißt, so ist dies automatisch für andere Staaten ein Warnsignal und sie werden dies nicht gut heißen. Die Gewaltenteilung ist damit dauerhaft garantiert, ebenso die Unabhängigkeit der politischen Institutionen. Gleichzeitig lassen sich so diktatorische Machtansprüche ebenso abwälzen wie Volksaufstände, die so unterdrückt werden können. Die Konföderation besteht aus vielen kleinen Republiken, die zusammengenommen die Macht der großen Monarchien besitzt. Die Konföderation ist ein Zusammenschluss verschiedener Gemeinwesen. Die Fortführung in einer Union wäre immer noch konföderativer Natur, da sie der Zusammenschluss verschiedener Einzelstaaten beinhaltet und die einzelnen Mitgliedsstaaten immer noch weitreichende Rechte besitzen, die verfassungsmäßig garantiert sind und nicht abgeschafft werden können – auch wenn sie sich der allgemeinen Autorität der Union unterordnen müssen. Generell sieht er jedoch die Abgrenzung zwischen Konföderation und Union als eine Spitzfindigkeit.
Madison erwähnt in der zehnten Schrift, dass besonders Gegner der Union immer wieder mit Argumenten der mangelnden Stabilität, der Konfusion und Ungerechtigkeit punkten können, wobei diese drei Argumente auch tatsächlich die Gefahren der Freiheit bergen, Angst und Misstrauen das Resultat fehlender Solidarität und das Ergebnis von Ungerechtigkeiten ausgehend von den Parteiungen der öffentlichen Administration sind. Dabei definiert Madison eine Parteiung als eine Gruppe von Bürgern – die sowohl eine Mehrheit als auch eine Minderheit darstellen könnte –, die von ihren Leidenschaften und Neigungen getrieben ein gemeinsames Interesse verfolgt, welches den Freiheiten und Rechten der anderen gegenübersteht [und diese daher einschränken würde; Anmerkung des Autors] oder dem Gemeinwohl entgegensteht. Um das Problem ausgehend von diesen Parteiungen zu beseitigen, könnte man Parteiungen selbst abschaffen, was aber der Abschaffung der Freiheit gleichkommt; oder man deklariert eine Parteiung zum Gemeinwohl und schreibt ihre Interessen vor [was aber im Grunde genommen wieder die Freiheit aller Bürger abschafft; Anmerkung des Autors]. Die einzige Alternative kann daher nur die Kontrolle der Wirkungen von Parteiungen sein, da die Ursachen für die Entstehung von Parteiungen in der menschlichen Natur und zwar in der Bildung von Eigentum vorliegen. Solange der Mensch quantitativ und qualitativ unterschiedliches Eigentum erwirbt [und dies wohl auch schützen möchte, Anm. d. Autors] bzw. die Fähigkeit dazu besitzt, wobei jeder Mensch von Natur aus eine unterschiedliche Fähigkeit derselben besitzt, gibt es auch unterschiedliche Interessen und damit unterschiedliche Parteiungen. Damit sind die ungleichen Besitzverhältnisse und die Bildung verschiedener Klassen der Ausgangspunkt verschiedener Parteien und Parteiungen und die Aufgabe des Staates ist es, die vielfältigen und einander gegengesetzten Interessen zu regulieren. Obwohl Madison erkannt hat, dass Besitzverhältnisse und Klassenbildung die Ursache für Instabilität und Spaltungen innerhalb des Volkes sind, ist er nicht auf die Idee gekommen die Klassen als eigentliche Ursache abzuschaffen, sondern hat die Parteiungen – die wiederum auf den Besitzverhältnissen und deren Interessen beruhen – zur Ursache deklariert. Dass die Beseitigung der Interessenbildung der Beseitigung der Freiheit gleichkommt versteht sich von selbst. Er hat also richtig gefolgert, als er sagte, dass Parteiungen als Ursache nicht abgeschafft werden dürfen. Dass aber eigentlich nicht die Parteiungen, sondern die Klassen die wahre Ursache sind, die man daher beseitigen könnte, das hat Madison nicht erkannt, obwohl er ja gerade die Klassen als Problemfeld wiederum erkannt hat.
Jedoch hat Madison Recht, wenn er behauptet, dass niemand Richter in eigener Sache sein dürfe, da sein eigenes Interesse die Entscheidung beeinflussen würde. Dabei zeigt er auf, dass das staatliche System ähnlich eines Gerichtes aufgebaut ist, indem über entgegengesetzte Interessen geurteilt wird. Da aber selbst aufgeklärtere Staatsmänner immer auch in ihrem eigenen Interesse handeln werden und die aufgeklärtesten Staatsmänner nur selten vorzufinden sind, ist eine neutrale Instanz nie wirklich umsetzbar. Zum einen verfolgt die Minderheit sinistere Phantasien, zum anderen verfolgt die Mehrheit wiederum ihre Interessen, die sie den anderen aufoktroyieren möchte. Die reine Demokratie, so wie sie damals verstanden wurde [und sich in der Schreckensherrschaft der Jakobiner zur Zeit der Französischen Revolution manifestierte und somit eine Tyrannei war; Anm. d. Autors] ist also zum Scheitern verdammt. Abhilfe soll ein republikanisches System [also das, was wir heute als moderne Demokratie verstehen (und eben nicht das, was man damals mit Demokratie verband); Anm. d. Autors] schaffen. Nur dieses kann effektiv die Wirkung kontrollieren, wobei es nicht zu groß oder zu klein sein und ein richtiges Maß annehmen sollte, damit alle gerecht repräsentiert werden und gleichzeitig die Übermacht einer Parteiung flächenmäßig verhindert werden kann.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Hamilton also pluralistisch ist und sich gegen den Rousseau’schen volonté générale wendet. Die direkte Demokratie des Volkes lehnen sowohl Hamilton als auch Madison ab und schlagen eine Repräsentativverfassung vor. Dabei soll eine Union aus mehreren Mitgliedsstaaten entstehen (Verbundföderalismus). Die Federalists sind für einen Machtausgleich und Gewaltenteilung, jedoch nicht für die Abschaffung der Parteiungen. Durch Checks and Balances ist ein Interessenausgleich möglich. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ein eher nicht rational-handelnder Präsident an der Macht wäre, so könnten Gegeninstitutionen ihn immer noch in Schach halten und verhindern, dass er einen absoluten Willen durchsetzen kann.
Veröffentlicht am 24. Mai 2018
Federalist Papers, Teil 2: Madison über „The Structure of the Government Must Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments”
In der 51. Schrift äußert sich Madison zur Gewaltenteilung. Als Autorisierungsquelle jeglicher Gewalt sieht er das Volk. Ausgehend von dieser sollen die verschiedenen Ämter über verschiedene Kanäle besetzt werden. Dabei sollten alle Gewalten voneinander unabhängig sein, sodass es keine Gewaltenverschränkung gibt und die Exekutive nicht die Legislative korrumpiert oder umgekehrt. Auch muss sichergestellt werden, dass die Judikative unabhängig bleibt, indem sich die Richter schnell von jenen lösen, die diese ins Richteramt gebracht haben, damit diese von den Richtern keine bevorzugte Behandlung zu erwarten haben. Durch die strikte Teilung und Vermeidung von Konvergenzen und durch Verschränkungen soll es erst gar nicht zu Vetternwirtschaft kommen können. Während die Föderalisten für einen Machtausgleich und Gewaltenteilung einstehen, lehnen sie jedoch eine direkte Demokratie ab und berufen sich auf Repräsentation. Die Gegner der Föderalisten dagegen fordern mehr Rechte für die Einzelstaaten und sind gegen die Abtretung von Kompetenzen an die Union. Sie streben eine Demokratie an, in der alle Macht direkt vom Volk ausgeht und das Volk direkt miteingebunden wird. Die Föderalisten dagegen sind gegen die Demokratie und für die Republik und setzen damit auf den Konföderalismus. Dabei gehen Föderalisten davon aus, dass die Verfassung ausreiche, um die individuellen Rechte der Bürger zu schützen, während die Anti-Föderalisten die Gefahr sehen, dass durch die Repräsentation durch eine kleine Minderheit eine neue Form der Tyrannei und eine kleine Machtelite entstehen könnte. Aus diesem Grund möchten die Anti-Föderalisten die Machtbefugnisse lieber vor Ort, also bei den Einzelstaaten, lassen. Die Föderalisten kommen zum Ergebnis, dass gerade die Union verhindern kann, dass ein einzelner Staat in die Tyrannei abdriftet, nämlich durch die großräumige Kontrolle und Unabhängigkeit, da Abgeordnete aus anderen Bundesstaaten die Bürger vor Ort nicht genauestens kennen und sich so nicht zu ihren Vorteilen korrumpieren lassen.
Madison geht davon aus, dass alle Bürger Leidenschaften besitzen, die diese einbringen möchten und das System daher nicht eine kleine Gruppe an die Macht bringen soll, die stark genug ist ihre Ideen durchzubringen und zu stärken, sondern die Konkurrenz der verschiedenen Meinungen und Ideen müssen am Leben gehalten werden. Deswegen müssen trotz der Kontrollfunktion der Checks und Balances die Institutionen an sich unabhängig bleiben und unabhängig arbeiten können. Durch die unabhängige Arbeit könnten diese dann ihre Kontrollfunktion erst ausüben, indem sie nicht auf Blockade eines anderen Instruments hinarbeiten, sondern sich auf den Zweck ihrer Daseinsberechtigung konzentrieren und durch die Ausübung deren Tätigkeit – also ihres Zwecks – automatisch eine Kontrollfunktion hergestellt wird. Das heißt, der einzelne Akteur ist nur in seinem department tätig und hat darüber hinaus keinen Einfluss auf andere departments oder direkte Eingriffsmöglichkeiten. Die Legislative soll am stärksten ausgestattet sein, weswegen sie in verschiedene branches geteilt werden muss, um so nicht an Übermacht zu gewinnen. Die verschiedenen Zweige (branches) dürfen daher so wenig direkte Verbindung haben wie nur möglich. Strenggenommen sind die verschiedenen Gewalten schon für Madison sogenannte ‚branches‘, das bedeutet, dass die legislative Gewalt strenggenommen noch einmal einer Gewaltenteilung in sich unterzogen werden soll. Dies soll geschehen, indem den verschiedenen Zweigen die verfassungsmäßigen Mittel und persönlichen Motive zur Verfügung gestellt werden, um im Falle einer Kompetenzüberschreitung eines anderen Zweiges Widerstand leisten zu können. Das persönliche Interesse des Amtsinhabers muss mit den Interessen der Verfassung zusammenstehen. Letztendlich soll so Ehrgeiz dem Ehrgeiz entgegenstehen. Das Ziel der Regierung ist Gerechtigkeit. Madison sieht dies sogar als das Gesamtziel der bürgerlichen Gesellschaft an.
Veröffentlicht am 25. Mai 2018
Über die Gleichberechtigung
Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist eine essentielle und wichtige Errungenschaft der Geschichte. Es steht außer Frage, dass diese Berechtigung ein Recht zu sein scheint und das wiederum bedeutet, dass man es einfordern kann. Als intrinsisch gutes Recht erhebt es sogar den Anspruch, auf die ganze Welt exportiert und überall implementiert zu werden. Das Problem daran ist, dass es als erkämpftes Recht kein natürlich gutes Recht ist, welches seinen intrinsisch guten Anspruch gegen jedwede Kritik verteidigen könnte. Ultrakonservative lehnen die Gleichberechtigung ab. Progressive Konservative mögen zwar der Idee der Gleichberechtigung zustimmen, aber Einschränkungen zulassen. Ihnen entgegenzutreten ist nicht leicht, denn Rechte sind stets wandelbar. Dem ultrakonservativen Argument, es handele sich um eine Phase, die normativ jederzeit beendet werden könne, kann kein Argument sinnvoll mehr entgegengehalten werden, es sei denn man findet einen Weg, eine Gleichheit zwischen Männern und Frauen, jenseits eines gesetzlichen Rahmens als natürlich gut und damit intrinsisch gut zu formulieren. Ich schlage an Stelle der Gleichberechtigung die Gleichgewichtung vor. Das Problem bei dem Gedanken der absoluten Gleichheit ist, dass die Etablierung dessen dazu führt, dass Menschen immer gleicher werden, nicht im Sinne von „einander ähnlich“, sondern die geforderte Gleichheit ist nie gleich genug. Das zeigt, dass es immer in jedem Moment ein überragendes Gewicht gibt, welches jedoch nicht statisch sondern fluide ist. So mag in einem Moment vielleicht kurz der Mann überwiegen, in der nächsten Sekunde dann aber die Frau. Dieses polare Prinzip bezeichneten die alten Chinesen als Yin und Yang – zwei Kräfte, die immer umeinander konkurrieren und deren zusammentreffen Wunderbares hervorbringen kann.
So mag die Stärke des Mannes in einem Moment von Vorteil sein, die Durchsetzungskraft einer Frau wiederum der Vorteil in einer anderen Sekunde. In einer Situation dominiert mal der Mann über die Frau, nur um sich in der nächsten Sekunde gleich wieder zu untergeben und der Frau alle Macht zu überlassen. Das Problem der Feministen ist also offensichtlich: Sie möchten den Mann entmannen, sie möchten eine Tyrannei der Frau etablieren, um die frühere Tyrannei des Mannes zu rächen. Das ist für die Gesellschaft höchst gefährlich. Denn sowohl der männliche als auch der weibliche Chauvinismus bringen das scheinbar natürliche Gleichgewicht um die Konkurrenz der Kräfte durcheinander und die kurzfristige gegenseitige Unterwerfung aus dem Gleichgewicht, indem eine Kraft unterdrückt wird, die andere Kraft dagegen alle unterjocht.
So wurde die Versklavung der Frau damals aus einem Irrtum begangen, der folgenschwer war, jedoch verstanden werden muss. Ersteinmal muss festgestellt werden, dass die Gleichgewichtung schon ein biblisches Thema war. Eva wird aus der Seitenrippe Adams geformt und nicht etwa aus seinem Kopf oder Fuße. Wäre Eva aus seinem Kopf geformt, so könnte sie ihn dominieren; wäre sie aus dem Fuße geformt, wäre sie Adam stets unterlegen gewesen. Stattdessen wurde sie aus seiner Seite geformt, um ein ebenbürtiger Begleiter an seiner Seite zu sein. Wie so oft in der Geschichte wurde nun ein Abschnitt vorzügig interpretiert, um damit eine eigene Handlungsweise zu rechtfertigen: die sogenannte Erbsünde – die Frau als verdammtes Wesen, welches dem Manne dienen solle. Tatsächlich hebt Eruvin 100b hervor, dass die Frau bestraft wurde und sie ihr Haar so lang wie eine Dämonin wachsen lasse und wie ein Tier urinieren muss. Aber Eruvin 100b erwähnt auch, dass Gott der Frau seinen Segen gegeben hat, indem sie sich dabei nicht wie ein Hund anstellen muss und trotz der Geburtsschmerzen der sexuelle Akt ihr Freude bereiten solle. Die Strafe des Mannes dagegen fiel viel härter aus. Dieser muss sein Brot im Schweiße verdienen und hart für das Überleben arbeiten (Bereshit Rabbah 20:10). Für einen biblischen Leser, dürfte doch gerade der Mann, der an Prachtbauten für die Könige mit der Hand ganze Kolosse schuftete und auf dem Acker sich mit Mühe abwälzte, um etwas ernten zu können, dies doch viel gewichtiger zugekommen sein, als die Menstruationsbeschwerden der Frau. Letztendlich war es der Erfindungsreichtum, der alles umkehrte. Mit der Erfindung primitivster Geräte und Werkzeuge wurde schon in der Antike die bittere und viel qualvollere Strafe des Mannes wegrationalisiert; die Strafe der Frau ließ sich aber aufgrund ihrer anatomischen Gegebenheiten nicht so einfach überwinden. So wurde dann nur die Strafe in der Frau gesehen, nicht aber ihren Segen und „Frau und Vieh“ wurden eins. Rabbi Bahya ben Asher (1255-1340) hob in seinem Kommentar zwar hervor, dass Frauen sehr geschwätzig seien, sprach ihnen auf Grundlage der Bibel aber zu, dass sie ein Segen seien, da sie das einzige Wesen auf der Welt seien, das selbst ein intelligentes Wesen zur Welt bringen könne (Rabbeinu Bahya zu Bereshit 3:20). Auch hier hat sich die Frau als geschwätziges Wesen sehr schnell als Eigenschaft etabliert, der Segen der Frau, der viel höher wiegt, wurde dagegen unter den Teppich gekehrt.
Es zeigt also, dass die Verkürzung von Interpretationen immer wieder dazu geführt hat, Unrecht gegenüber Frauen walten zu lassen. Es ist ein gesamtes Phänomen der Literatur geworden, nur das in der Literatur zu sehen, was man gerade braucht. So hat Hobbes zwar erwähnt, dass der Mensch dem Mensch ein Wolf sei, im gleichen Atemzug aber ergänzt ‚und ein Engel‘. Das Menschenbild Hobbes‘ wird heute in dem Ausspruch homo homini lupus formuliert, vom Engel fehlt jede Spur. Da also scheinbar immer nur das Negative herausgesucht wird, ist bei der Gleichmachung der Geschlechter Vorsicht geboten. Eine Feministin sieht im Manne bloß ein machtgeiles Wesen, welches jede Gelegenheit nutzt, die Unterjochung wieder zu etablieren und jeder Machtmissbrauch eines Mannes wird zur Untermauerung verwendet. Ein verlassener Familienvater sieht dagegen in der Frau nur ein Subjekt, welches ihn entrechten und wie ein Sparschwein bis zum letzten Cent ausschlachten möchte. Wie man sieht führt die Gleichberechtigung also lediglich dazu, die Grabenkämpfe oberflächlich zu beschwichtigen. Ein solches Recht ist keineswegs per se falsch, da es einen juristischen Rahmen bietet und Möglichkeiten schafft. Aber dieser Rahmen lässt sich in der Gesellschaft nie zu hundert Prozent verwirklichen. Deswegen muss sich in der Gesellschaft nicht das Bewusstsein des Rechts der Gleichheit, sondern die Gewichtung der Gleichheit etablieren und das Recht nur die Garantie sein. Es stimmt nunmal, dass Männer und Frauen sich nicht unterscheiden: sie haben die gleichen Fähigkeiten und Veranlagungen und ihre Rollen entstehen schlicht durch die Erziehung, sind also ein Scheinwesen. Aber da beide gleich sind, haben sie auch das gleiche Streben nach Dominanz. Durch die Gleichgewichtung ist es vernünftig, mal dem Mann die dominante Rolle zukommen zu lassen, da in einer Situation er die Fähigkeit besitzt etwas zu meistern – nicht weil er ein Mann ist, sondern weil er sich die Fähigkeit angeeignet hat – und mal ist es nur vernünftig der Frau den Vortritt zu lassen – nicht aus Mitleid oder gar aus Angst vor dem Gesetz, sondern weil sich die Frau eine Fähigkeit angeeignet hat, die sie in dieser Situation einsetzen kann. Daraus ergibt sich auch, dass die individuelle Fähigkeit dazu maßgeblich sein soll, die gesellschaftlichen Positionen zu besetzen und nicht das Geschlecht. Eine Frauenquote mag zwar der Gleichberechtigung gut tun, nicht aber der Gleichgewichtung, weil so eine Frau vielleicht an einen Posten kommt, der ihr von der Befähigung vielleicht gar nicht zukäme und woanders vielleicht eine Frau, die die Befähigung hat, gar nicht mehr berücksichtigt wird, weil bereits eine Quote erfüllt wurde und der männliche Teil der Gesellschaft dann vielleicht Angst hat, ganz aus seiner Riege gedrängt zu werden und so ein unfähiger Mann als Ausgleich vorgezogen wird, anstelle der qualifizierten Frau. Dieses Beispiel zeigt also wieso es fatal ist alles zu verrechtlichen, anstelle ein Bewusstsein für eine gesunde Gewichtung zu fördern.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Gleichgewichtung intrinsisch gut ist, da sie ein situatives Wechselspiel der Dominanzen darstellt und den natürlichen Trieb nach Herrschaft sättigt, indem man sowohl Herrscher als auch Untertan in einer Person nach Maßgabe der Vernunft ist. Da beide Geschlechter in gleicherweise vernünftig sind, kommt es darauf an, wer in einer gewissen Situation vernünftigerer ist und damit die Dominanz in dieser Situation übernimmt. Damit lässt sich die Gleichgewichtung weltweit als gutes Vorbild exportieren und etablieren, während die bloße Gleichberechtigung nicht auf Vernunft und Fähigkeiten beruht, sondern eine rein-normative Variable ist, die sich international mal stärker ausprägt und dann wieder verschwindet, da Gesetze stetig wandelbar sind. Da das Hauptmerkmal die Vernunft ist, müssen Jungen und Mädchen gleichermaßen gefördert werden. Ein reiner Mädchentag für Berufe ist daher ebenso abzulehnen wie eine Frauenquote, da diese nur ein Geschlecht fördern. Schwangerschaftsberatungen für Männer dagegen wären sinnvoll, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Frauen besser zu verstehen und ihnen den nötigen Raum zu geben sowie tatkräftig unterstützend zur Seite zu stehen. Solche Initiativen sind besser als jedes Gesetz oder jede Quote.
Veröffentlicht am 26. Mai 2018
Tocqueville und die Demokratie in Amerika, Teil 1: Analyse der französischen Ständegeschichte und die Rolle der Demokratie
Die Zusammenfassung bezieht sich auf Alexis de Tocquevilles „Über die Demokratie in Amerika“. Alle Seitenzahlen beziehen sich auf die Reclam-Ausgabe (Nr. 8077) von 1985.
In seiner Einleitung schildert Tocqueville bereits ein wichtiges Hauptanliegen: die Gleichheit. Auf seiner Amerika-Reise hat er festgestellt, dass die Gleichheit die schöpferische Kraft der Gesellschaft ist und alles, was nicht direkt durch die Gleichheit geschöpft wird, wird zumindest durch sie transformiert. Tocqueville stellt aber auch fest, dass die Gleichheit keineswegs alleine auf Amerika beschränkt ist. In seiner Analyse der letzten 700 Jahre französischer Geschichte kommt er zum Ergebnis, dass anfangs ein sehr kleiner Zirkel die Macht akkumulierte und den Rest unterjochte. Jedoch gab es alle 50 Jahre einen revolutionären Geist, der die Obersten ein Stück herabstufte und die Untersten ein wenig aufwertete. Ludwig XIV. soll sogar soweit gegangen sein, dass die Gleichheit direkt unter dem Throne begann und Adlige und einfache Bürger sich gar nicht mehr unterschieden. Während Rousseau sagte, dass überall Ungleichheit herrsche, ist Tocqueville genau umgekehrter Meinung und schwört die Gleichheit herbei. Dabei arbeiten alle auf die Gleichheit hin, auch jene die diese zu verhindern versuchen. Und so ist die Demokratie nur eine Frage der Zeit: sie ist unaufhaltsam und sowohl Befürworter als auch Gegner tragen ihren Teil dazu bei – abwenden lässt sie sich jedoch nicht, wie der revolutionäre Geist der letzten 700 Jahre bis Tocqueville (also 900 Jahre bis heute) gezeigt hat (S. 15-19). Die Demokratie und ihr revolutionäres Wesen sind so vorgezeichnet, wie der Verlauf der Gestirne, die ständig ihren Bahnen folgen und folglich ist der Kampf gegen die Demokratie (im Sinne Tocquevilles) gleich dem Kampf gegen Gott – und dem göttlichen Willen (S. 20). Statt die Demokratie zu nutzen und zu fördern haben die Machthaber Europas stets versucht sie zu bekämpfen und zu beseitigen (S. 21).
Gleichsam ist anzumerken, dass jenseits der Demokratie selbst die Gewalt ihre Schranken hat. Die einfachen Bürger waren sich ihrer standesmäßigen Geburt bewusst und trachteten gar nicht nach Macht, die ihnen nicht zustand, sodass sie ihre Natur gar nicht bezweifelten, während die Oberen sich ihren Vorzügen bewusst waren, sodass sich ein Wohlwollen zwischen Adel und Knechtschaft entwickelt hatte, in der jeder die Rolle des Anderen respektierte. Kam es zum Widerstand, dann nicht, weil der Knecht seiner Natur aufbegehren wollte, sondern weil er gegen ihn angewandte Gewalt als illegitim empfand. Die Gewalt eines Absolutisten war also nie wirklich absolut, sondern fand immer ihre Grenzen im Gewohnheitsrecht, welches die Legitimität der Maßnahmen begründete. Mit dem Ende der französischen Ständegesellschaft und der Gleichheit der Klassen als Masse, sieht Tocqueville den Vorteil in der Demokratie insofern alle gesetzesliebend sind. Nicht zuletzt, da die Menschen ja von Natur aus sich der legitimen Gewalt unterwerfen und sich dieser nicht widersetzen werden, solange sie legitim ist. Wenn alle Menschen gleich sind, dann ist die legitime Gewalt das Gesetz. Ergo wird der Bürger es achten und ihm folgen (S. 22 f.). An die Stelle der Adligen soll der Zusammenschluss der Bürger stehen, die einander vertrauen, da jeder das ihm zustehende Recht qua Gesetz einfordern kann. (S. 24)
Doch Tocqueville scheint auch die einhergehenden Probleme der Gesellschaft in seiner Transformation gefunden zu haben. Denn das Ansehen der Könige seiner Zeit ist verloren gegangen. Das Gesetz, welches Gleichheit und Recht garantiert, dagegen ist nicht an seine Stelle getreten. Folglich kam es zur Missgunst in der Gesellschaft, zum Kampf der antagonistischen Klassen. Die Aufteilung der Vermögen hat zwar den Abstand verringert, aber dafür den Hass erhöht, da keiner dem anderen mehr etwas gönnt und die einen nach dem Vorteil des Wohlstandes streben, der andere dagegen Angst hat seinen Wohlstand zu verlieren (S. 25). Daher erscheint beiden Antagonisten die Gewalt als einziger Ausweg, denn keiner von ihnen hat das Recht als solches wirklich begriffen (S. 26). Statt dass die Demokratie die Aristokratie ersetzt, wurde die Aristokratie zerstört ohne eine neue Gesellschaftsordnung zu etablieren, sodass man noch in deren Trümmern sitzt. Tocqueville sieht in der Kirche und den frommen Menschen noch eine Hoffnung, denn vor Gott sind alle Sünder gleich, also muss gerade die Kirche das Interesse daran haben, die Gleichheit und Demokratie voranzutreiben. Sie könnte die Gleichheit aller Menschen legitim begründen und Frieden zwischen den verfeindeten Gruppen stiften. Als Empirist sieht Tocqueville jedoch, dass auch die frommen Menschen in verschiedene Lager zerstritten sind und die Christen die Demokratie abstoßen möchten (S. 27). Letztendlich kommt Tocqueville aber zu dem Schluss, dass man am Ende auf die Religion setzen muss, da die Herrschaft der Freiheit nicht ohne Sitten und Tugend auskommt. Eine freiheitliche Gesellschaft ist also nicht frei von Moral und Tugend (S. 28). Die religiösen Kräfte bekämpfen jedoch faktisch die Freiheit und die Verfechter der Freiheit kämpfen gegen die Religion (S. 29). Zudem fällt die Idee des Bösen oft mit der Idee des Neuen zusammen, sodass es eine allgemeine Angst vor dem Fortschritt in den Augen einiger Menschen gibt (S. 28), die damit der Zukunft keine Chance geben, obwohl diese – wie oben beschrieben – nicht aufzuhalten ist. Zu dieser Gruppe von Menschen zählen die Gebildeten. Die Ungebildeten und Sittenlosen – kurzum die Gottlosen – haben sich zu den Vorkämpfern der Zivilisation erklärt, obwohl ihnen diese Position gar nicht zusteht (S. 29).
Tocqueville stellt schließlich fest, dass die Menschen in Amerika die Vorzüge der Revolution genießen, die es dort nie gegeben hat (S. 29 f.), also in anderen Worten: die Auswanderer gen Amerika haben gegen die Bedingungen in Europa zwar in Europa gekämpft, diesen Geist aber auch mit nach Amerika genommen und dort ausbreiten können, ohne gegen eine Übermacht kämpfen zu müssen, sodass diese die soziale Revolution schnell vollziehen konnten, die aus Tocquevilles Sicht nun ihre Grenzen erreicht hat. Damit hat Tocqueville im Großen und Ganzen die europäische Geschichte umrissen und möchte folglich die amerikanische Gesellschaft, die ja jene Ideale entfaltet hat, genauer untersuchen.
Veröffentlicht am 4. Juni 2018
Tocqueville und die Demokratie in Amerika, Teil 2: Die Gesellschaft der USA und das Problem der Demokratie
Die Zusammenfassung bezieht sich auf Alexis de Tocquevilles „Über die Demokratie in Amerika“. Alle Seitenzahlen beziehen sich auf die Reclam-Ausgabe (Nr. 8077) von 1985.
In der Einleitung seines Werkes (S. 15-31) zeigt er auf, wie sich die antagonistischen Klassen immer weiter angeglichen haben und auf eine völlige Gleichheit weiter hinarbeiten. Dieser Prozess der Demokratisierung ist laut Tocqueville nicht aufzuhalten und sowohl Gegner als auch Befürworter des Modells sind maßgeblich an seiner Etablierung beteiligt. Als Empirist nimmt er sich Amerika zum Vorbild, welches er als Beispiel für eine durch Gleichheit geprägte Gesellschaft sieht.