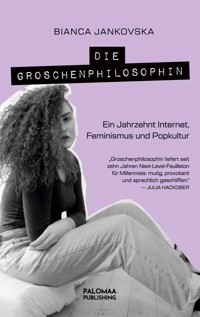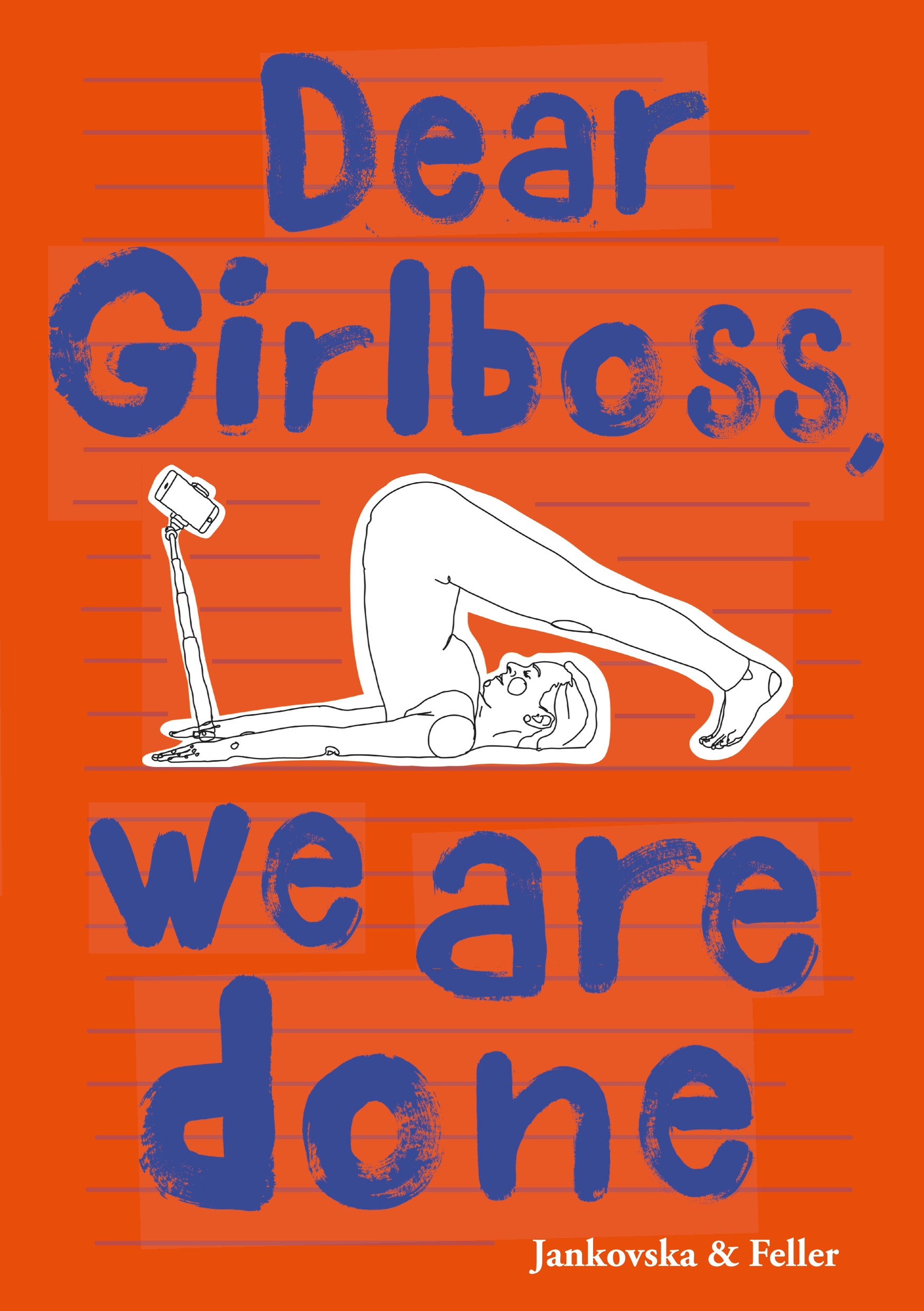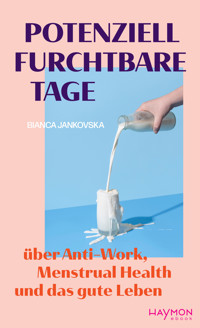
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
DAS ENDE DER AUSBEUTUNG – MIT MENSTRUAL HEALTH UND ANTI-WORK DIE ARBEITSWELT REVOLUTIONIEREN Acht Jahre lang ergründete Bianca Jankovska am eigenen Leib, was passiert, wenn ZYKLUS und die damit verbundenen SCHMERZEN auf LOHNARBEITSABHÄNGIGKEIT treffen. Ein MELTDOWN MOMENT folgte dem nächsten. Denn: Unsere LEISTUNGSGESELLSCHAFT zwingt uns dazu, uns trotz monatlich wiederkehrender Schmerzen und mitunter KRANKHEITSSYMPTOMEN zum Job zu schleppen – wenn nötig unter Medikamenteneinfluss. MENSTRUATIONSURLAUB oder ein ZYKLUSORIENTIERTES ARBEITSZEITMANAGEMENT gibt es in Deutschland und Österreich nicht. Ganz ehrlich: Im KAPITALISTISCHEN PATRIARCHAT, in dem wir leben, klingen sie eher nach Utopie als nach realisierbaren Errungenschaften. FAKT ist außerdem, dass die vorherrschenden ARBEITSSTRUKTUREN nicht nur Menstruierende, sondern auch psychisch Erkrankte, Marginalisierte – und die Umwelt – AUSBEUTEN und KRANK MACHEN. Es muss sich also dringend etwas ändern! Wie? Indem wir unser heutiges ARBEITSSYSTEM SABOTIEREN und einen ANTI-WORK-FEMINISMUS IMPLEMENTIEREN – ganz ohne Perioden-Glitzergedöns und Wärmflaschen-Merch. Hier gibt es keine Tipps für's Bewerbungsgespräch – und KEIN SCHLECHTES GEWISSEN, wenn du am Ende des Jahres keinen Meilenstein zu verkünden hast. ANTI-WORK bedeutet übrigens nicht, nie mehr zu arbeiten. Die IDEE dahinter ist viel mehr, dass wir uns als Gesellschaft VON krankmachenden ARBEITSZWÄNGEN LÖSEN und damit aufhören, uns selbst auszubeuten oder schlecht zu fühlen, wenn wir einmal nicht arbeiten (können). BIANCA JANKOVSKA verbindet persönliche ANEKDOTEN mit strukturellen PROBLEMEN und erzählt eindrucksvoll von THERAPIE IM KAPITALISMUS, PMS und PMDS, von PRIVILEGIEN-CHECKS, KÜNDIGUNGSERFAHRUNGEN, SCHAM, SCHULD und SCHMERZ. In augenöffnender Einfachheit zeichnet sie LÖSUNGSVORSCHLÄGE und PERSPEKTIVEN für eine gesündere und bessere ARBEITSWELT. Willkommen in der FEMINISTISCHEN ANTI-WORK-BEWEGUNG: für Menstruierende, Arbeitende, Selbstständige und alle, deren psychischen und körperlichen Ressourcen von Tag zu Tag weniger werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Widmung
Vorwort
Disclaimer
Anti-Work und Privilegien
Intro: Issues
Meltdown Moments
Dysphoria County
Your therapist can’t end capitalism
Spielerin des Jahres
Kapitel 1: Scham
Es reicht halt nie
Hört mir auf mit dem Perioden-Gedöns
Gecancelt im Yoga-Studio
So what? I can’t hold a job
Krankenbett in Šibenik
Kapitel 2: Schuld
Familie
Ich muss, ich muss
Perfectionist Polly
Reiche Eltern umverteilen
Und was arbeitet eigentlich dein Mann?
Kapitel 3: Wut
Mein Zyklus ist nicht meine Superpower
Deutschland, wo ist mein Menstrual Leave?
Die Outsourcing-Lüge
4-Tage-Woche ≠ Teilzeit ≠ Faulheit
Kapitalisten ausbeuten
Kapitel 4: Schmerz
Du, bitte wein leise
Aliens
Intimacy
Citalopram zum Frühstück
8 Wochen und 6 Tage
Wenn Elon Musk eine Frau wäre
Kapitel 5: Hoffnung
The Great Resignation
Arbeitslosigkeit for future
Gute Arbeit
Healing from healing
Kämpfen und abhaken
Outro: The Art of Living
PMDS-FAQ
Danksagung
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Weitere e-books aus dem Haymon Verlag
Über die Autorin
Impressum
für die menschen
die mich trotz
meiner vielen schwächen
nicht haben
fallen lassen
Vorwort
Ich habe dieses Buch nicht geschrieben, um mir selbst einen Gefallen zu tun. Dafür sind die Ausschnitte, die ich aus meinem Privatleben hervorgekramt und zur öffentlichen Selbstanalyse freigegeben habe, viel zu hässlich.
Es wäre für meine Reputation als „seriöse Autorin“ vermutlich besser gewesen, manche Teile wieder zu löschen, persönliche Schwachstellen zu kaschieren, um ein gewisses Image zu wahren, und ein nüchternes Sachbuch über menstruelle Gesundheit zu schreiben, mit dem das Feuilleton etwas anfangen kann.
Aber wem hätte ich damit geholfen? Wem hätte es etwas gebracht, wenn die Erfahrungen, die ich stellvertretend für viele andere Menstruierende und Menschen mit psychischen Erkrankungen auf dem Arbeitsmarkt gemacht habe, im Dunkeln geblieben wären? In meinem eigenen Kopf. In einem Tagebuch.
Fakt ist: Ich hätte dieses Buch früher selbst gebraucht. Es beschreibt meine eigene Krankheitsgeschichte mit der wenig bekannten Prämenstruellen Dysphorischen Störung (PMDS), aber auch meine Suche nach diesem „guten Leben“, die ich trotz der Hürden, die mir bisher im Spätkapitalismus begegneten, nicht aufgegeben habe.
Das Buch ist in fünf Kapitel gegliedert, die im Idealfall nacheinander gelesen werden, da sie aufeinander aufbauen. Zugleich steht jedes davon inhaltlich für sich und hat jeweils eine eigene Aussage. Ich habe den Inhalt nach Emotionen sortiert, nicht nach Themen, weil ich in erster Linie emotionsgetrieben geschrieben habe und mir diese Form der Anordnung eine gewisse künstlerische Freiheit ermöglicht hat.
Es beginnt mit der Auseinandersetzung mit meiner eigenen Scham, geht über in die Frage nach Schuld, gefolgt von Kapiteln über Wut und Schmerz, bevor es mit dem Kapitel über Hoffnung endet. Ganz zum Schluss befindet sich eine Sammlung von FAQ zur PMDS, die bei Bedarf natürlich auch gleich zu Beginn gelesen werden kann.
Obwohl es immer noch kein richtiges Leben im falschen gibt, kann ich versprechen, dass es Wege heraus aus der Ohnmacht und Hilflosigkeit gibt.
Alle in diesem Buch erwähnten Zahlen, Studien und Fakten beziehen sich auf den Forschungsstand im Jahr 2023 oder davor. Englische Literatur wurde von mir übersetzt. Ich hoffe, dass manche meiner Thesen und Vermutungen schon bald von neuer Forschung gestützt werden. Dass Menschen in zehn Jahren sagen werden: „Zum Glück sind wir heute weiter“.
Weil bestimmt einige Menschen fragen werden, warum ich nicht gendere, obwohl mein Buch inklusiv sein soll: Ich finde nicht, dass Gendern in jedem Fall zu mehr Inklusivität beiträgt. Ich habe selbst Personen in meinem Umfeld, die sich schwer damit tun, gegenderte Sprache zu lesen. Deshalb habe ich mich dagegen entschieden, mit *, Binnen-I oder anderen Varianten zu gendern, und stattdessen versucht, wo möglich eine genderneutrale Bezeichnung zu verwenden oder das generische Maskulinum mit dem Femininum abzuwechseln, um den Lesefluss möglichst ungestört zu erhalten. Wo wir schon beim Thema sind: Ich habe möglichst oft von „Menstruierenden“ und nicht von „Frauen“ geschrieben, weil sich dieses Buch selbstverständlich nicht nur an Frauen richtet. Konkret ausgedrückt: Nicht alle Frauen menstruieren und nicht alle Menstruierenden sind Frauen. Leider wird in vielen Studien, Berichten, Artikeln und Umfragen von binären Geschlechterkategorien ausgegangen, weswegen ich die Begrifflichkeiten in solchen Fällen aus Gründen der Präzision übernehmen musste.
Ich möchte zudem an dieser Stelle festhalten, dass ich keine Ärztin bin und mit diesem Buch auf keinen Fall medizinische Ratschläge erteilen möchte.
Darüber hinaus ist meine eigene Perspektive immer noch die einer akademisierten, postost-migrantischen, nicht von Armut betroffenen, reproduktionsfähigen, heterosexuellen Cis-Frau vor der Menopause aus einer Großstadt. Ich habe keine körperliche Behinderung, gehe jedoch mit einer gewissen psychischen Belastung durchs Leben und befinde mich auf dem Spektrum der Neurodiversität. Ich maße mir nicht an, aus einer anderen Perspektive zu schreiben, und versuche hier, meine eigene Herkunft so authentisch und kritisch einzuordnen wie möglich.
Abschließend bleibt noch zu sagen: Ich hoffe, dass es noch viele weitere Bücher geben wird, die sich des Themas Menstrual Health im Spätkapitalismus aus einem eigenen, neuartigen Blickwinkel annehmen.
Emanzipatorisches Lesen
Bianca Xenia Jankovska
Disclaimer
Teresa Bücker ist mein Imposter-Syndrom-Endgegner. Egal, wo ich mich befinde oder womit ich mich gerade ablenke: Teresa Bücker ist nicht nur überall, Teresa Bücker hat auch ein unfassbar detailliertes und präsentes Standardwerk geschrieben, das eigentlich von Anti-Work handelt, sich aber aus marketingtechnischen Gründen nicht so nennt. Stattdessen heißt es Alle_Zeit und erinnert mich zuverlässig wie ein Uhrwerk daran, was ich alles als Autorin: nicht schaffe, nicht kann, nicht bin.
Eigentlich hatte ich das Buch bereits weggelegt, um mich nicht an den Details aufzuhängen, aber dann nehme ich den Faden doch wieder auf. Ein bisschen aus FOMO, ein bisschen aus Pflichtgefühl, ein bisschen aus schlechtem Gewissen. Ich erfahre, dass es die 40-Stunden-Woche realpolitisch gar nicht gibt, dass deutsche Männer im Durchschnitt eine 37-Stunden-Woche und deutsche Frauen eine 30-Stunden-Woche präferieren. Dass es gar nicht stimmt, dass Menschen heutzutage weniger arbeiten als früher, dass Feel-Good-Manager im Grunde auch nur bezahlte Care-Kräfte in Unternehmen sind und sich alleinerziehende Mütter unternehmensinterne Benefits wünschen, die nicht ab 19 Uhr in einem Fitnessstudio stattfinden.
Teresa Bücker sammelt in ihrem Buch recherchierte Fakten, droppt historische Eckdaten in chronologischer Reihenfolge und ganz nebenbei die teils immer noch vorhandenen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Sie zitiert Politikerinnen und Aktivisten aus der Pflege, kennt alle aktuellen Statistiken zum Thema Lohnarbeit in Deutschland und scheut sich nicht, sie anzuführen.
Aber: Wer ist diese Teresa Bücker und wie macht sie das? Ich habe sie einmal gesehen, bei einem Workshop-Wochenende irgendwo in Brandenburg. Aber außer unseren Augen hat sich da nichts getroffen. Ihre Sprache wirkt auf mich fast schon gezwungen sachlich, kalt, unantastbar. Und genau das macht Teresa Bücker so erfolgreich: ihre Fähigkeit, bei emotionalen Themen wie Erwerbsarbeit, Ungerechtigkeit und Arbeitslosigkeit vollkommen emotionslos zu bleiben, die richtigen Fakten, statt hässlicher Gesichtsregungen, an den Tisch zu bringen und dabei wie nebenbei die Care-Revolution herbeizuschreiben. Neben Teresa Bücker wirke ich wie ein unfrisierter Instagram-Clown, der seinen Meinungsdünnpfiff nicht unter Kontrolle hat.
Kurz: Teresa Bücker ist der Archetyp einer gutsituierten Journalistin, die ich nie geworden bin. Während ich mich durch das Buch quäle, denke ich verzweifelt darüber nach, was ich nach dem Lesen alles in meinem eigenen Buch erwähnen sollte. Sollte ich nicht auch noch etwas über die Vorteile von Gewerkschaftsarbeit schreiben? Na ja, oder zumindest etwas über die Arbeiterkämpfe meiner Vorfahren, oder? Welche Statistiken muss ich hinterher noch nachschlagen, damit auch mein Buch mehr „Fleisch“ bekommt, mehr Autorität, mehr Sachlichkeit … ja, vielleicht mehr Respekt. Respekt von Kritikerinnen, die mir nach dem Lesen meines Buches sicherlich fehlende emotionale Distanz und mangelnde journalistische Recherche vorwerfen werden. Denn, sind wir mal bitte ehrlich, wer in dieser Branche nicht wie Teresa Bücker arbeitet, der macht sich der unsauberen Arbeitsweise schuldig.
* * *
Nach anderthalb Stunden mit Alle_Zeit muss ich aufhören und eine Pause einlegen. Es ist schon witzig, denke ich mir, dass Teresa Bücker ausgerechnet ein Buch über Zeitkultur geschrieben hat, denn ich habe die vage Vermutung, dass sie für dieses Buch mehr Stunden gearbeitet hat, als ich für „normal“ oder „angemessen“ erachten würde. Vor meinem inneren Auge sehe ich Teresa Bücker, wie sie jeden Abend um 23:47 Uhr 30 Tabs offen hat, um diese eine Zahl zu suchen, diese eine Zahl zu finden, die ihren Aussagen lebenslange Legitimation verleihen wird.
Je mehr ich über Teresa Bücker und ihr Buch nachdenke, desto mehr glaube ich, dass Teresa Bücker und ich ein vollkommen anderes Verhältnis zur Arbeit haben – obwohl wir beide darüber schreiben, obwohl wir beide daran interessiert sind, eine radikal neue, sozial gerechte Zeitkultur einzuführen.
„As a writer, I’ve often experienced imposter syndrome around not having ‚well-researched‘ books or writing.“ Mar Grace1
Wenn ich darüber nachdenke, ob meine eigenen Texte genug Recherche beinhalten, konfrontiere ich mich mit meiner vermeintlichen Unzulänglichkeit, mit meiner vielleicht größten Angst. Nämlich, dass es anderen auffällt, dass meine Texte nicht in erster Linie recherchelastig sind, sondern durch Emotionen getrieben werden. Dass ich nicht immer Lust habe, 70 Seiten Statistiken und Zitate anderer zu droppen, um einen Punkt zu machen.
In meiner Welt sind Statistiken dazu da, um von Menschen nachgeschlagen zu werden, die es wirklich ganz genau wissen wollen. Ganz oft finde ich sogar, dass zu viel Zitier- und Klugscheißerei einem Beitrag schaden, dass die Worte anderer meine ursprüngliche Aussage verfälschen und mich unter Druck setzen, alles, was es zu einem bestimmten Thema zu sagen gibt, in einem einzigen Text zu vereinen. Dabei habe ich diesen Anspruch gar nicht.
* * *
Es ist wichtig, dass es Frauen wie Teresa Bücker gibt, und vermutlich hat jeder, der das hier liest, seine ganz eigenen Kämpfe mit seiner „persönlichen“ Teresa Bücker auszutragen. Gleichzeitig ist es auch wichtig, aufzuhören, sich für die Art, wie man arbeitet, zu schämen. Manche Menschen recherchieren gerne, andere nicht. Manche Menschen haben wenig Meinung, manche viel. Manche Menschen lesen gerne Kriminalromane, andere lieber Memoiren.
Deshalb möchte ich gleich zu Beginn vorwarnen: Dieses Buch ist auf gar keinen Fall vollständig. Nicht einmal annähernd fasst es alle Debatten, die es derzeit rund um das Thema Anti-Work und Menstrual Health gibt, zusammen. Ich habe tonnenweise Literatur ausgelassen, nicht gelesen, übersprungen, gar nicht erst gekauft, nach zehn Seiten abgebrochen. Weil ich mich gelangweilt habe, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war, weil ich lieber wandern gegangen bin, weil schon andere Autorinnen vor mir sehr viel Ausführlicheres dazu geschrieben haben, weil ein Buch ohnehin niemals reichen wird, um die Gesellschaft zu verändern, und dieses Buch von meinen ganz subjektiven Erfahrungen handeln soll und handeln wird.
Das hier ist mein Buch, und ich werde sicherlich kein Buch über Anti-Work schreiben, um mich während des Prozesses auszubeuten, kaputtzumachen und meine Karriere voranzutreiben. Vielleicht ist das hier bereits mein erster emanzipatorischer Akt für ein Anti-Work-Leben. Ein Buch über Anti-Work mit Anti-Work-Haltung zu schreiben, das so, wie es ist, genug ist. Ein Buch, das nicht alles können muss, nicht alles von der Antike an erklären soll und Texte nach der dritten Korrekturschleife auch mal gut sein lässt.
Wem das nicht reicht, der kann immer noch Alle_Zeit von Teresa Bücker lesen.
Ich würde es verstehen. Wirklich.
Anti-Work und Privilegien
Seit die Idee zu diesem Buch entstanden ist, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie ich über so etwas Prätentiöses wie nicht arbeiten schreiben könnte. Halleluja, ich sah die Kommentare bereits von links und rechts auf mich zufliegen: „Arbeit macht doch auch glücklich!“, „Arbeit ist Selbstverwirklichung!“, „Und außerdem braucht die Wirtschaft Arbeitskräfte!“, „Wo kommen wir da hin als Wirtschaftsnation, wenn keiner mehr arbeitet?“.
Nicht zu arbeiten, so Konsens von links, ist nur etwas für Reichgeborene, nur etwas für Nepo-Babies, die ungeborenen Kinder von Justin Bieber oder die Tochter von Kylie Jenner. Die meisten Menschen, ja, auch die allermeisten bekannten deutschsprachigen Theoretiker können sich kein Leben ohne Lohnarbeitszwang vorstellen. Vermutlich auch deshalb, weil dann die Arbeit liegen bleiben würde, die sie selbst nicht verrichten wollen. Unsere Welt, wie wir sie heute kennen, würde schlicht: zusammenbrechen.
Aber ist nicht zu arbeiten wirklich per se etwas Schlechtes?
Spätestens seit der amerikanischen Great Resignation (Kapitel 5) ist vielen Arbeitgebenden bewusst geworden, dass eine Zeitenwende einsetzt. Die Gründe dafür sind mehr als nachvollziehbar: Wofür noch arbeiten, wenn der Lohn nicht oder nicht genügend an die Inflation angepasst wird, Reichtum großteils vererbt wird (Kapitel 2: „Reiche Eltern umverteilen“) und die Welt brennt (Kapitel 5: „Arbeitslosigkeit for future“)? Wofür noch zur Arbeit gehen, wenn uns Millennials und Zoomern die Zukunft gestrichen wurde?
Ich habe nicht vor, hier zu erklären, wer den Kapitalismus erfunden hat. Es gibt tausende Bücher und Dokumentationen zum Thema und auch darüber, was er bereits alles zerstört hat. Es langweilt mich, über bereits Erörtertes zu schreiben. Ich spare uns die Zeit und fange nicht ganz vorne an. Sondern da, wo wir gerade stehen, während ich zwischen Sommer 2022 und Winter 2023 eine Mischung aus persönlichen Anekdoten, am eigenen Leib getesteten Lösungsvorschlägen und literaturbasierten Utopien in gut verdauliche Essays gieße.
Ich möchte darüber schreiben, was die Klasse, in die wir geboren wurden, mit unserem Leistungsbedürfnis zu tun hat. Ich möchte über das Stigma der Erwerbsarbeitslosigkeit schreiben, über Tradwives, die die Errungenschaften ihrer Vorgängerinnen für ein bisschen Scheinfreiheit als Hausfrau aufgeben (Kapitel 2: „Und was arbeitet eigentlich dein Mann?“), und über die Lüge des Outsourcings – natürlich auf Kosten anderer.
Denn es stimmt natürlich, wir können Anti-Work nicht nicht intersektional denken, wenn wir die Freiheit vom Erwerbsarbeitszwang für alle fordern. Und doch wird es vermutlich wie immer eine kleine, privilegierte Gruppe an Vorreiterinnen sein, die ihre eigenen Privilegien für realpolitische Forderungen und Analysen nutzen, bis auch die Letzten aufhören können, für umweltzerstörende Konzerne malochen zu müssen. Ich würde sogar sagen, es ist die Pflicht der Privilegierten, unsere heutige Arbeitswelt zu sabotieren und zu zerstören. Uns solidarisch vor jene zu stellen, die das (noch) nicht können.
Anti-Work ist jedoch nicht nur eine Bewegung mit konkreten politischen Zielen, sondern auch eine Haltung, die erstmal im Kleinen Wirkung haben kann.
Anti-Work bedeutet für mich als Lohnabhängige nicht, gar nicht zu arbeiten, sondern mich vom schlechten Gewissen der Nicht-Produktivität zu lösen. Von Zeit zu Zeit zu kündigen – nicht um sofort einen neuen Job anzufangen, sondern meine eigene mentale und physische Gesundheit zu retten. Die Lüge vom Traumjob zu verlernen und gleichzeitig neue Praktiken im eigenen Leben zu implementieren, die nichts mit dem ständigen Streben nach mehr zu tun haben.
Anti-Work bedeutet mehr Faulheit für alle – und nicht nur für die oberen 1 %.
Aber spulen wir doch erstmal noch ein paar Jahre zurück. Denn ich habe natürlich nicht schon immer so gedacht.
Intro: Issues
Dass ausgerechnet ich einmal über Mental Health schreiben würde, hielt ich noch vor wenigen Jahren für ausgeschlossen (und vermutlich auch alle, die damals meine Arbeit verfolgt haben).
2020 erschien in Kollaboration mit der Illustratorin Julia Feller mein zweites Buch Dear Girlboss, we are done, das von den negativen Effekten handelt, die die Offenbarung der eigenen Traumata für Frauen online zur Folge hat. Ich habe das Buch nach dem Erscheinen nie wieder in die Hand genommen, und doch kann ich mich vage daran erinnern, dass ich darin Influencerinnen und Journalistinnen, die auf Social Media offen über ihre psychischen Probleme schreiben, abwertete.
Ich verstand nicht, warum sie sich in Zeiten von Hasskommentaren, Stalking und der internetimmanenten Gier nach Voyeurismus und traurigen Geschichten freiwillig auf großen Medienportalen die Blöße gaben, fremde Menschen in die eigenen seelischen Abgründe mitzunehmen.
Die Offenlegung der weiblichen Psyche war für mich nicht in erster Linie politisch, sondern in erster Linie privat – und gefährlich. Ich fand es seltsam, wenn sich kluge Frauen, in meiner damaligen Wahrnehmung, darauf reduzieren, an einer psychischen Störung zu leiden, und fortan ihr gesamtes Online-Dasein darauf ausrichten, mit einer bestimmten Diagnose in Verbindung zu stehen.
Vielleicht tat ich das, weil ich mir selbst lange Zeit nicht eingestehen wollte, krank zu sein. Bis ich im Mai 2022, im Alter von 30 Jahren, eine Speichelprobe an ein Berliner Labor schickte.
Meltdown Moments
Ich hatte gerade das anstrengendste Jahr meines Lebens hinter mir.
Innerhalb von zwölf Monaten zog ich von Berlin aufs Land in Dippoldiswalde und wieder zurück nach Berlin, wo ich während des dritten Pandemie-Winters ein juristisches Masterstudium aus der Ferne abschloss und gleichzeitig vier Tage die Woche als Change-Managerin bei einem Consulting-Unternehmen arbeitete.
Mein Alltag war die Hölle.
Ich verbrachte den Großteil des Tages damit, sinnlose Powerpoints im Wert von mehreren zehntausend Euro zu erstellen (wovon ich natürlich nur einen Bruchteil abbekam), und arbeitete zwischendurch am Exposé meiner Masterarbeit im Fachbereich des Wettbewerbsrechts.
In manchen Monaten gab es weniger als sechs Tage, an denen ich lachte und so etwas wie Freude oder Sinn empfinden konnte. Meine Lebensunlust war nicht mehr zu leugnen.
Trotzdem hätte ich mich nicht als „depressiv“ bezeichnet, denn schließlich kam ich jeden Morgen aus dem Bett, schrieb neben dem Consulting-Job eine juristische Masterarbeit, ging joggen und verdiente genügend Geld, um im Supermarkt nicht auf die Preise von Milch und Butter achten zu müssen.
Ich hatte es geschafft, mich aus dem journalistischen Prekariat zu befreien, in einer anderen Branche anzufangen und mich gleichzeitig in einen neuen, unfassbar komplizierten Bereich einzuarbeiten, ohne zuvor das erste deutsche juristische Staatsexamen abzulegen. Freunde, die selbst Jura studiert hatten, gratulierten mir – und staunten gleichzeitig über meine bestandenen Prüfungen. Scheinbar war ich immer noch so ehrgeizig wie mit 21 – allerdings nach fünf Jahren Selbstständigkeit inklusive einiger kurzer, notgedrungen eingeschobener Festanstellungen ungefähr fünfmal so ausgebrannt.
Ich hatte seit 2017 keine richtige Pause mehr gemacht, und mit richtig meine ich, länger als zwei Wochen am Stück auf dem Rücken zu liegen und an die Decke zu starren. Ohne Handy, ohne Laptop, ohne Auftraggeber, die bis 15 Uhr ein volles Word-Dokument von mir wollen.
Der Preis für meine Funktionalität war hoch.
Mein Nervenkostüm war so dünn wie eine Frischhaltefolie.
Mein Privatleben glitt mir aus den Händen.
* * *
Triggerwarnung: selbstverletzendes Verhalten, Selbsthass
An einem unspektakulären Montagvormittag entdeckte ich eine Parkstrafe über 50 Euro hinter meiner Windschutzscheibe, weil ich vergessen hatte, ein Ticket für den Gratis-Parkplatz beim Supermarkt zu ziehen (klingt unlogisch, war es auch).
Es regnete heftig, und ich versuchte, die Angelegenheit gleich zu regeln. Ich lief also in den Supermarkt und wieder hinaus, ich versuchte, mit dem Parkwächter zu sprechen. Aber keine Chance. Der kostenlose Besucher-Parkplatz war über Nacht kapitalisiert worden. Schließlich kam ich auf die Idee, auf das Ticket eines anderen Fahrzeugs mit derselben Ankunftszeit zu setzen, dessen Besitzer es mir – so der Plan – nach seiner Abfahrt freiwillig überlassen könnte. Mit diesem fremden, nicht zuordenbaren Ticket hätte ich die Strafe vielleicht abwenden können.
Doch bevor ich ein passendes Ticket finden konnte, kündigte sich in meiner Magengegend bereits ein Nervenzusammenbruch an. Mein Gehirn blockierte jegliche Rationalität und schüttete eine unverhältnismäßig große Dosis Adrenalin aus. Stück für Stück breitete es sich in jeder Zelle meines Körpers aus. Meine Pupillen erweiterten sich. Meine Herzfrequenz stieg an. Hilflos rief ich meinen besten Freund an, um ihm von der Situation zu erzählen, die im Grunde genommen eine kleine, unnötige Lappalie war. Statt mich von ihm trösten zu lassen, fing ich an, Öl ins Feuer zu gießen.
Die Leute auf dem Parkplatz starrten mich an, was mich nicht daran hinderte, in voller Lautstärke weiter ins Telefon zu schreien. Da war ich also: die Verrückte, die bei Regen auf einem Parkplatz auf- und ablief und dabei weinte, als ob sie gerade einen Arm verloren hätte. Die, die doch sonst stundenlang Argumente hin- und herwälzen konnte und sich beruflich auf sehr viel schwerere Problemszenarien einlassen musste.
She lost it.
Schließlich beendete ich das Telefonat, indem ich auflegte, und fuhr nach Hause. Dass ich unterwegs keinen Unfall verursachte, war purer Zufall – denn durch meine verheulten Augen habe ich nicht mehr viel von der Straße gesehen.
In der Wohnung verschlimmerte sich mein Zustand. Ich hatte die Verbindung zu mir selbst verloren.
Warum passiert so etwas immer mir?
Warum bin ich so dumm und kann nicht lesen?
Warum muss ich ausgerechnet diesen Parkplatz nehmen?
Kann ich nicht besser auf mich aufpassen?
Meine Selbstabwertung nährte sich erfolgreich von dem kleinen Fehler, den ich in Eile begangen hatte, und stürzte mich kopfüber in eine Abwärtsspirale. Sie gipfelte darin, dass ich meinen Mid-century-Schreibtisch mit beiden Händen an die Wand schleuderte und ihn anschließend wie eine Hyäne in seine Einzelteile zerlegte. Ich riss die Schubladen samt Inhalt heraus und warf sie gemeinsam mit meiner Tastatur und einem Haufen Bücher auf den Parkettboden. Das 70 Jahre alte Teil war in weniger als drei Minuten zu einem Haufen Brennholz geworden.
Ich befand mich mitten in einem Blackout. Am Ende des Massakers hielt ich ein Tischbein in der Hand und hatte mehrere Schrammen an meinen Beinen. Als ich endlich zu mir kam, nahm ich mich aus der Vogelperspektive laut schluchzend und panisch atmend in der Embryonalstellung auf dem Bett liegend wahr.
Um mich herum und in mir drinnen: Chaos.
Der einzige Gedanke in mir war nun: „Endlich. Jetzt kann es raus. Jetzt kann alles raus“.
Dysphoria County
Die Prämenstruelle Dysphorische Störung (PMDS) ist eine Krankheit, deren Ursachen bislang wenig erforscht sind. Fest steht allerdings, dass Menschen mit Zyklus, die an der schwersten Form der Prämenstruellen Störung leiden, in den Tagen nach dem Eisprung bis zum Einsetzen der Monatsblutung an unterschiedlich stark ausgeprägten Depressionen, Ängsten, Aggressionen und Wahrnehmungsstörungen leiden, die bis hin zu Body-Dysmorphia, selbst- und fremdverletzendem Verhalten sowie Suizidalität führen können.
Bei einigen Menstruierenden halten die Symptome zehn, bei anderen 20 Tage an. Bei einigen sind sie durchgehend vorhanden, was eine Abgrenzung zu anderen psychischen Erkrankungen schwer macht. Treten die beschriebenen Symptome lediglich in der Zeit ab dem Eisprung auf und hören sie abrupt rund um das Einsetzen der Blutung wieder auf, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um PMDS handelt. Um dies zu diagnostizieren, sollte über mindestens drei Monate ein Tagebuch geführt werden, in dem die unterschiedlichen Symptome täglich auf einer Skala bewertet werden.
Ein Progesteronmangel kann, muss aber kein Grund für das Auftreten der Prämenstruellen Dysphorischen Störung sein. In meinem Fall konnte durch eine Speichelprobe ein eindeutiger Progesteronmangel festgestellt werden. Unzählige Jahre des Leidens und 150 Euro kostete mich dieser Erkenntnisgewinn, der nicht von Krankenkassen übernommen wird.
Die Ursachen meines Progesteronmangels sind bislang ebenso unklar wie die genaue Entstehung von PMDS. 3–8 % aller Menstruierenden leiden daran. Und niemanden interessiert es! Warum das so ist, liegt auf der Hand: Frauengesundheit ist historisch bedingt kein besonders relevantes Thema. Das wissen wir spätestens seit der Lektüre von Caroline Criado Perez, die in ihrem Buch Invisible Women. Exposing Data Bias in a World Designed for Men die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der medizinischen Forschung einem breiten Publikum offenlegte.
Die meisten Betroffenen kommen meist erst dann mit ihrem Progesteron-Wert in Berührung, wenn sie nicht schwanger werden können. Wenig überraschend wurde auch ich von den meisten Ärzten gefragt, ob ich Nachwuchs plane – obwohl ich eigentlich nur wissen wollte, was genau nach dem Eisprung in meinem Gehirn passiert.
Denn „normal“ fühlte sich in meinem Kopf nach dem zwölften Zyklustag nicht mehr viel an. Monat für Monat stand ich in dieser Zeit neben mir, erkannte mein blasses Gesicht im Spiegel nicht wieder und litt, neben gelegentlichen aggressiven Explosionen, an obsessiven, wiederkehrenden Gedanken, die mich nicht losließen. Fast so, als hätte mir jemand meine schlimmsten Alpträume auf Band gesprochen und die Play-Taste mit Tesa fixiert.
Du bist schuld daran, dass du dich in dieser Lage befindest.
Du bist ein Loser, der es nicht schafft, glücklich zu sein.
Du triffst andauernd schlechte Entscheidungen.
Du hast heute wieder den ganzen Tag darauf gewartet, dass etwas Schlechtes passiert.
Während ich das hier schreibe, ist meine Euphorie über den erkannten Progesteronmangel übrigens wieder ein Stück weit verflogen – denn es gibt keine Studie, die eindeutig beweist, dass PMDS mit einem Progesteronmangel zusammenhängt oder dass die Aufnahme von bioidentischem Progesteron in Form von Kapseln dazu führt, dass die PMDS-Symptome verschwinden. Mehr zum komplexen Verhältnis von Progesteron und PMDS steht übrigens im FAQ ganz am Ende dieses Buches.
Bislang gibt es jedenfalls kein in Deutschland oder Österreich zugelassenes Medikament speziell gegen PMDS. Bis zum Inkrafttreten der neuen Version des in Deutschland und Österreich gängigen medizinischen Klassifikationssystems für Gesundheitsprobleme, ICD-11, im Jahr 2022 war die Krankheit überhaupt nur im amerikanischen DSM-5-Katalog1 gelistet. Umso schwieriger ist es, auf PMDS spezialisierte Ärztinnen und Gynäkologen zu finden – denn anders als vielfach angenommen, ist PMDS keine psychische, sondern eine gynäkologische Erkrankung.
* * *
Zu meiner Freude war in meinem 150-Euro-Speichelproben-Set auch ein Gespräch mit einer auf Frauengesundheit spezialisierten Heilpraktikerin enthalten. „Why not?“, dachte ich mir. „Schaden kann es nicht.“
Ich legte meine Vorurteile gegenüber esoterisch angehauchter Unwissenschaftlichkeit beiseite und begann ein Gespräch mit einer Frau, deren Stimme mir ehrlich gesagt sofort unsympathisch war. Das ganze Telefonat über stellte ich mir vor, wie die Frau in Jogginghosen im Home-Office saß und den ganzen Tag die immer selben Fragen von einem Dokument ablas, um den Umsatz des Start-ups, bei dem ich dieses Speichelproben-Set kaufte, zu steigern.
„Sie sollten unbedingt gut auf sich achten!“
„Sie sollten Stress so gut es geht vermeiden!“
„Sie sollten Ihre Ernährung umstellen!“
„Haben Sie es schon mit Frauenmanteltee versucht?“
„Wir haben in unserem Shop einige Tees, die speziell für PMS-Patientinnen geeignet sind!“
„Nehmen Sie Vitamin B?“
„Also von Medikamenten würde ich Ihnen abraten!“
Kurzum: Es war schwer, mich ernst genommen zu fühlen. Wenn ich meine emotionalen Verdauungsprobleme und Meltdowns mit Magnesium und Vitamin B curen könnte, glaubt mir, ich hätte es schon getan. Ich hätte gerne darauf verzichtet, die „Drama-Queen“, die Übersensible zu sein.
Patientinnen wie mir – egal, ob sie nun an der Prämenstruellen Störung, Depressionen, bipolaren Störungen, Angststörungen, Phobien oder anderen Neurosen leiden – werden in der Regel genügend Ruhe, eine spezielle Ernährung, Entspannung und Sport verordnet. Als ob wir in einer Welt leben würden, die es erlaubt, uns hauptberuflich um unsere Gesundheit zu kümmern. Als ob wir die Zeit hätten, uns neben Vollzeiterwerbsarbeit, Care-Arbeit und Beziehungspflege um eine richtige Diagnose zu kümmern.
Ich selbst habe etwa fünf Jahre gebraucht, um überhaupt eine Methode der Diagnostik für PMDS zu finden – und noch ein bis zwei weitere Jahre, um mir eine halbwegs effektive Behandlungsmethode zusammenzustellen.
PMDS verdirbt mir 50 % meiner Lebenszeit, seit … ja, seit wann eigentlich? Seit ich ein unbändiger Teenager war, der seine Familie terrorisierte? Seit ich mit 19 heimlich angefangen habe, mich mit Weed zu self-medicaten, weil keiner so genau wusste, was ich hatte?
Trotzdem: PMDS ist für mich nur ein Wort, ein Tropfen auf dem heißen Stein, ein Anhaltspunkt von vielen auf meiner langen Liste an Fragen. Ich möchte mich nicht mit der Krankheit überidentifizieren. Ich könnte auch „ganz gewöhnliche“ Depressionen oder eine bipolare Störung haben. Denn im Grunde steht hinter allem, was ich hier schreibe, eine bestimmte Haltung.
Nämlich, dass es keine „einfache“ Heilung psychischer Störungen und Erkrankungen in einem Leistungssystem gibt, das uns psychisch krank macht.
Für niemanden von uns.
Your therapist can’t end capitalism
Wie die meisten Millennials und Gen Xer habe auch ich meinen fair amount of Selbsthilfeliteratur gelesen, um mit meinen Meltdowns „fertigzuwerden“. Oder anders gesagt: um es zu schaffen, dass meine Meltdowns für andere weniger furchteinflößend sind. Für Außenstehende waren und sind meine Aussetzer schwer nachzuvollziehen und noch schwieriger zu tolerieren.
Empathie dürfen emotionale Menstruierende nur erwarten, solange sie im vorgesehenen Muster agieren: weinen, traurig in der Ecke sitzen oder still werden. Mit neofeministischen Ratschlägen à la „Trau dich, wütend zu sein!“ und „Brich die Regeln!“ konnte ich dementsprechend schon früh wenig anfangen, weil ich ja bereits ohnehin diejenige war, die sich nicht an Regeln hielt, aus Schulunterricht und Trainingslagern flog und der eigenen Wut gerne freien Lauf ließ.
Niemand möchte aber wirklich wütende Frauen sehen. Wenn wir wütend werden, sollen wir diese Wut gefälligst in konstruktiven Aktivismus oder Journalismus verwandeln und nicht direkt gegen uns selbst oder andere richten. Dann wird unser Verhalten nämlich als „krankhaft“ pathologisiert und nicht als Antwort auf ein grundsätzlich krankmachendes System und jahrelangen strukturellen Missbrauch verstanden.
Obwohl ich mich weder als spirituell noch religiös bezeichnen würde, habe ich während meiner letzten und lange überfälligen Auszeit im August 2022 ungefähr jedes Buch in die Hand genommen, das mir dabei helfen könnte, die slawische Volleyballtrainerin in meinem Kopf durch eine liebevolle Pflegemutter zu ersetzen. So schnell ließ mich der zerstörte Mid-century-Tisch nämlich nicht los. I really hit rock bottom.
Also las ich Holly Whitakers Quit Like a Woman, obwohl Alkohol seit mehreren Jahren keine Rolle in meinem Leben spielte, und fing mit Marianne Williamsons A Return To Love an, obwohl ich nicht an Gott glaube. Michael A. Singers Klassiker The Untethered Soul brachte mir das Konzept des inneren Mitbewohners bei, den ich mir immer dann vorstellen sollte, wenn ich eine Situation vorschnell bewertete. Ich sollte die Stimme in meinem Kopf objektiv von außen betrachten, um ihr die Macht zu nehmen. Laut Singer war ich nicht die Stimme, sondern die Person, die die Stimme wahrnahm. Aha.
Was mich an der massenhaft verfügbaren Selbsthilfeliteratur störte, war, dass die meisten Anleitungen zur Heilung aus folgenden drei, relativ banalen, Elementen bestanden:
•Abstraktion negativer Gedanken
•Fokus auf Liebe
•Meditation und Yoga
Ja, ich sollte dem Licht folgen, meiner Welt stets mit Liebe begegnen (was mir damals bereits oft gelang) und meine Perspektive wechseln (was mir immer häufiger gelang), ich sollte zum Yoga gehen (was ich tat) und mich spirituellen Weiterbildungsseminaren anschließen, um dort neue Freunde zu finden (was ich nicht tat).
Es war ein wenig paradox: Morgens setzte ich mich mit Hilfe von wissenschaftlicher Literatur mit den biochemischen Prozessen auseinander, die PMDS hervorrufen kann, abends beschallte ich mich mit halb-esoterischen Self-Help-Kapiteln, die die Schuld an meinem Schmerz meiner vermeintlichen Unfähigkeit, „wahrhaftig zu lieben“, zuschrieben.
Anders als noch vor ein paar Jahren war ich inzwischen sogar offen für „alternative“ Methoden der Heilung. Ich meditierte und schaffte es so immer öfter, mich abends in einen Zustand der Entspannung zu versetzen. Ich las alle Bücher mit einer gewissen Offenheit und Euphorie, etwas von Menschen zu lernen, die „weiter“ waren als ich.
Holly Whitaker etwa fokussiert sich in ihrem Buch Quit Like a Woman auf das Thema Alkoholsucht und die Frage, warum so viele Menschen negative Gefühle und Stress durch den Gebrauch von Rauschmitteln betäuben. Schließlich wirkt Alkohol bereits in geringen Mengen entspannend, weshalb ihn viele überarbeitete Menschen nutzen, um abends runterzukommen. Whitakers Buch ist nicht nur ein Augenöffner in puncto Lügen der Alkohollobby, sondern auch ein Ratgeber für alle, die sich wieder selbst spüren, Glück empfinden, Grenzen setzen und neue Freunde finden wollen. Ich habe durchaus spannende Zitate mitgenommen, wie zum Beispiel:
„Viele von uns denken, wir bräuchten ein Meer von Menschen, ein Dorf. Oft entspringt dieser Gedanke einer Vorstellung davon, was gesellschaftlich akzeptabel ist. Der soziale Beweis dafür, wie wertvoll oder cool oder normal oder sympathisch man ist, hängt oft damit zusammen, wie beliebt man ist.“
Danke dafür.
Hollys Geschichte hat mich gepackt und begeistert. Bis auf eine Sache: Obwohl Holly ehrlich über ihre Recovery von der drogenabhängigen, selbstzerstörerischen Partygängerin zur abstinenten und besänftigten Yogini spricht, muss sie uns Leserinnen immer wieder mitteilen, wie erfolgreich ihre neue Karriere als Bestsellerautorin und Gründerin von Tempest, einer „Sobriety School“, läuft, dass sie über 30 Mitarbeiter beschäftigt und jede Menge Verantwortung trägt. Dass ihr Terminkalender rappelvoll ist und sie sich gut überlegt, mit wem sie zum Lunch geht. Ok, verstanden, Girlboss.
Und auch Marianne Williamson (deren Bestseller ich ehrlicherweise nach 30 Seiten gelangweilt abgebrochen habe) wird nicht müde zu betonen, dass ihr Buch seit Jahrzehnten ein absoluter Renner ist, der ihr ein privilegiertes Leben als Missionarin verschafft hat.
Brené Brown, die über Scham und Verletzlichkeit forscht, verkauft es in ihrem Buch Verletzlichkeit macht stark als etwas Gutes, wenn Firmen die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern, indem sie eine Kultur der Verletzlichkeit zulassen. Jedes dritte Kapitel beginnt mit der Nacherzählung eines Vortrags, den sie an irgendeiner Elite-Universität, Elite-Einrichtung oder bei einem Ted Talk vor Tausenden von Menschen gehalten hat. Wenn authentisch gelebte Verletzlichkeit letztlich wieder nur zu mehr Kapitalismus führt und in erster Linie weißen Frauen in Führungspositionen hilft, dann bin ich raus, sorry!
Wird es bereits deutlich, worauf ich hinauswill?
Die aktuelle Self-Help-Literatur mag uns die richtigen Glaubenssätze, Mindsets und Therapie-Programme vermitteln – aber sie setzt meiner Meinung nach nicht dort an, wo das Unglück vieler wirklich anfängt: im Leistungsdruck des Bildungssystems und später in der Arbeit gegen Geld für andere.
Damit meine ich explizit nicht jene Arbeit, die wir gerne tun und die uns geistig fliegen lässt (Kapitel 5: „Gute Arbeit“), sondern die ganz normale, stinklangweilige Arbeit, die wir gegen Geld für Consulting-Konzerne, Restaurantbesitzer, kapitalistische Medienunternehmen, Kreativagenturen, Hotels, Versicherungsunternehmen, Alarmanlagenhersteller oder Autoproduzenten verrichten.
Denn – und das sollte mal klar festgehalten werden: Es hilft mir nicht, spirituell für ein paar Momente „bei mir zu sein“, wenn mein ausbeuterischer Job mich jeden Tag von Neuem grundsätzlich davon abhält.
* * *
Die Frage, die ich mir 2022 öfters gestellt habe, lautet wie folgt:
„Wie bist du eigentlich wieder hier gelandet?“
Für die Antwort muss ich ein wenig ausholen. Wie viele Kinder migrantischer Mütter war ich von klein auf darauf trainiert, gute Noten nach Hause zu bringen. Meine Mutter erzählt mir bis heute, dass ich sehr klug und sehr interessiert am Unterricht war und dass ich zudem auch sehr leicht lernte. Vielleicht stimmte ihre Geschichte. Vielleicht war ich aber auch nur gut darin, die Erwartungen meiner Mutter zu erfüllen.
Meine Mutter machte alles, was sie konnte, um mir mein Aufwachsen in Wien so schön wie möglich zu gestalten. Mit vier lernte ich Lieder mit Ernie und Bert im Englischfrühförderprogramm. Nach dem Kindergarten kam ich auf eine neue Montessori-Ganztagsschule. Morgens malten wir Mandalas, nachmittags spielten wir Fußball. Dazwischen gab es sicherlich auch ein paar Deutsch- und Matheeinheiten, die ich jedoch nicht als solche wahrnahm. Wir hatten nicht nur einen Klassenvorstand, sondern zwei – und konnten die Inhalte gemeinsam mit ihnen in einem freien Rahmen erarbeiten.
Mit neun wechselte ich schließlich aufs Gymnasium, was mir dank der Vorbereitungsarbeit meiner Mutter auch nicht weiter schwerfiel. Sie organisierte mir zuhause einen kindergerechten room for one’s own mit Schreibtischlampe, Papierablage und einer großen Palette Jolly-Buntstiften. Ich schrieb – trotz der Umstellung vom freien Lernen ohne Benotungsdruck auf Noten – fast immer Einsen und hatte keine nennenswerten Probleme. Ich war angepasst, gutgelaunt und strebsam. Gute Noten waren etwas, womit ich mir die Zuneigung meiner Mutter – und damit auch die Anerkennung ihrer slowakischen Verwandten – sichern konnte. Wenn ich gute Noten schrieb, war sie die gute Mutter, die das Beste aus ihrem Kind drüben im Westen herausholte. Und wenn ich das gute Kind war, wurde ich geliebt.
Ich möchte meiner Mamička keine Vorwürfe machen, sie hat mich zu einem verlässlichen Menschen erzogen, der sich in der Welt zurechtfindet. Ich durfte alles an Bildung mitnehmen, was das österreichische System zu bieten hat, und weiß spätestens, seit meine eigenen Freundinnen Kinder haben, was meine Mutter alles geopfert hat (sie würde es übrigens nie so nennen!), um genügend Zeit für mich und meine Hausaufgaben zu haben. Meine Mama hat mich umsorgt, als gäbe es nichts Wertvolleres auf der Welt.
Meine Schulzeit ist mir insgesamt in sehr guter Erinnerung geblieben. Ehrlich gesagt war die Zeit bis zur Pubertät meine bislang liebste Lebenszeit überhaupt. Es war jene Zeit, in der meine Welt noch in Ordnung war. Wie wir wissen, sind Erinnerungen aber trügerisch und werden Jahrzehnte später in einem nostalgischen Licht wiedergegeben, das kaum bis gar nichts mit der eigentlichen Realität von damals zu tun.
Inzwischen glaube ich, dass meine guten Erinnerungen an die Schulzeit bis heute meine Leistungsbereitschaft prägen. Mir Wissen anzueignen und fleißig zu sein, war mein persönlicher Schlüssel zu Glück, Freude, Liebe und Anerkennung.
* * *
Meine erste Therapeutin war eine gutangezogene Frau Mitte 50. Sie war dünn und ernst, trug gerne offene, flache Schuhe (für die ich ihr manchmal Komplimente machte) und hielt sich mit ihrer persönlichen Meinung strikt zurück.
Auf dem Weg in die Praxis in Moabit hoffte ich immer, niemandem zu begegnen. So als ob ich mich dafür schämen müsste, zur Therapie zu gehen. Dabei wäre es doch viel schlimmer, nicht zur Therapie zu gehen. Dass aber andere Menschen zur selben Therapeutin gehen wie man selbst, war für mich mental dann doch too much to handle.
Während meiner gesamten Therapie hatte ich das dumpfe Gefühl, dass meine Therapeutin mich nicht besonders mochte, doch es war mir egal. Ich glaube nicht, dass mich eine Therapeutin mögen muss, um mir etwas über mich selbst beizubringen. Wichtiger ist, dass ich meine Therapeutin respektiere. Und das tat ich.
Die meisten meiner Probleme hatten irgendetwas mit Arbeit und Beziehungen auf der Arbeit oder Beziehungen generell zu tun. Aber meistens redete ich über die Arbeit. Manchmal kam ich mir vor wie bei der Berufsberatung und nicht wie bei einer tiefenpsychologischen Therapie. Hin und wieder lachte meine Therapeutin, wenn ich ihr von meinen Problemen erzählte. Es war kein schallendes Gelächter, aber ein durchaus akustisch und visuell wahrnehmbares Schmunzeln.
Sollte ich wieder zurück in eine Festanstellung gehen? Warum war es so anstrengend, spannende und zuverlässige Auftraggeber zu finden? Sollte ich mich meiner Psyche zuliebe aus dem Insta-Game zurückziehen und etwas ganz anderes machen, kochen zum Beispiel? Warum ist Schreiben für Geld so undankbar? Ich redete und redete und redete und ging jedes mögliche Szenario durch, das beruflich in meiner Zukunft stattfinden könnte.
Was meine Therapeutin nicht konnte, war, Lösungen anzubieten. Sie wollte, dass ich selbst auf eine Antwort kam. Manchmal bettelte ich regelrecht um einen Ratschlag, weil ich nicht mehr weiterwusste und weil sie doch die kompetente Person in puncto Psyche war.
* * *
Mit der Zeit habe ich herausgefunden, was meinen mentalen Zustand garantiert verschlechterte – und es heute noch tut. Hier eine unvollständige und unsortierte Liste:
•Zu viele Deadlines gleichzeitig
•Mehr als zwei feste Auftraggeber zur gleichen Zeit
•Schlechte Kommunikation
•Top-Down-Kommunikation
•Regeln, die keinen Sinn haben
•Auf Dauer mehr als fünf Stunden pro Tag geistig arbeiten
•Soziale Isolation
•Soziale Überaktivität
•Monologisierende, paternalisierende und verurteilende Freunde
•Druck, abliefern zu müssen
•Druck, posten zu müssen
•Druck, etwas Besonderes erschaffen zu müssen
•Tagesschau zum Abendbrot
•Mir länger als vier Monate keinen Urlaub zu gönnen
•25 Urlaubstage als Festangestellte
•Familientreffen
•Finanzielle Ängste
•Bürokratie
•Warten auf Genehmigungen
Inzwischen schäme ich mich nicht mehr für diese Liste, obwohl ich weiß, wie die Kommentare lauten würden, würde ich sie in einem Massenmedium veröffentlichen. Vor allem ältere Generationen würden so etwas schreiben wie: „Die jungen Menschen von heute halten aber auch gar nichts mehr aus und sollten erstmal ordentlich arbeiten! Es wurde uns ja auch nichts geschenkt!“ Sie würden schreiben, dass sie sich anno dazumal über einen Urlaub pro Jahr freuten, statt ständig mehr zu fordern. Eine Frechheit sei das!
Die Debatte rund um die Generationsunterschiede zwischen Boomern und Millennials bzw. Zoomern ist alt – und ich habe mehrere Jahre meines Lebens damit verschwendet, an ihr teilzuhaben. Not any more.
Heute denke ich mir: Kein Wunder, dass meine Therapeutin keine Antwort hatte. SHE CAN’T FUCKING END CAPITALISM.
Von den Punkten auf der Liste kann mir eine Therapeutin maximal bei „Familientreffen“, „Freunde“ und „soziale Kontakte“, „Warten (Geduld)“ und „Kommunikation“ helfen. Realpolitisch kann sie nicht: mir mehr Urlaubstage geben; Regeln und Bürokratie, die keinen Sinn ergeben, abschaffen; das Nachrichtengeschehen beeinflussen oder Social Media ändern. Sie kann mir keine qualitativ wertvollen Auftraggeber herbeizaubern, weil sie überhaupt keinen Einfluss darauf hat, wie meine Akquise in einer schwachen Konjunkturphase läuft. Sie kann nicht meinen Stundensatz erhöhen, sodass ich mich weniger ausgebeutet fühle. Und sie kann mir nicht den Druck nehmen, abliefern zu müssen, um drei Deadlines in einer Woche einhalten zu können.
Meine Therapeutin kann mir nicht dabei helfen, das große Über-Problem meiner Lohnabhängigkeit zu lösen, weil sie auch nur einen Kassenplatz in diesem gottverdammten, kaputten System anzubieten hat, in dem Menschen depressiv werden, ihren Nachtisch ins Klo kotzen, ihre Kinder misshandeln und bis zum Burn-out hinter ihrem Schreibtisch sitzen bleiben.
Da kann sie dann auch nicht einfach schnipsen und die Zeit zurückdrehen, einen Urlaub für zwei in der Toskana und Geld vom Staat verschenken – am besten monatlich –, um Menschen das zu geben, was sie eigentlich zusätzlich zur zeitraubenden Therapie brauchen: eine Verschnaufpause. Eine Pause von dem ganzen Wahnsinn aus Bewerbungen schreiben und Absagen bekommen, neue Ideen generieren und keine Förderungen bekommen, beim Amt vorsprechen und den Lebenslauf aktualisieren, doch noch einen Master anfangen und für wenig Kohle in einem prestigeträchtigen Konzern arbeiten, nicht befördert werden, weil man einmal auf eine E-Mail „Nein, dafür stehe ich nicht zur Verfügung“ geantwortet hat – obwohl einem alle sagen, man solle Grenzen setzen. Doch wenn man sie letztlich durchexekutiert, sitzt man schneller wieder bei seinen Eltern im Kinderzimmer, als man „Ich kündige!“ rufen kann.
Don’t get me wrong: Therapie ist wichtig. Aber sie ist auch nur ein Puzzleteil von vielen, das ich austesten musste, um zu lernen, was mir wirklich hilft. In manchen Wochen hat die Therapie mehr Stress verursacht, als sie behoben hat. Besonders dann, wenn die Termine untertags waren und ich deshalb Schwierigkeiten hatte, genau jene Deadlines einzuhalten, über die ich mich beim Termin dann beschwerte.
Ich frage mich, ob so viele Menschen überhaupt Therapie bräuchten, wenn wir nicht in dieser Gesellschaft leben würden, in der viele Menschen ihre Kinder erziehen wie Hunde und ihre Alten lange vor dem Tod ins Heim stecken. Solange wir als Individuen tagein, tagaus, seit wir geboren wurden, von einer Kultur der Missgunst und des permanenten Vergleichens umgeben sind, von einer Kultur, die von Leistung, Produktivität und Ambition, und nicht von Ruhe, Resilienz und Würde, getrieben wird, werden die verfügbaren Kassenplätze immer bestens ausgelastet sein.
Am Ende meiner Therapie bekam ich übrigens keine Diagnose.
Stattdessen entschied ich mich, etwas „Ordentliches“ zu studieren, um dem Journalismus den Rücken zu kehren: Jura.
Spielerin des Jahres
Triggerwarnung: Essstörung
Ich bin nicht die Einzige, die von klein auf darauf trainiert wurde, sich durch Leistung zu behaupten. Vielleicht mag ich es deshalb nicht, mich in meiner Freizeit zu messen. Egal, ob es um Basketball, Tischtennis oder Tischfußball geht. Sobald ich um Punkte spielen muss, fangen die Stresshormone an zu kicken.
Sportarten wie diese, und ja, auch Fußball und Badminton, können theoretisch allesamt ohne den Druck, gewinnen zu müssen, gespielt werden. Wir könnten Bälle hin und her schießen, uns an der meditativen Geräuschkulisse von quietschenden Schuhen und treffenden Schlägern erfreuen und keinen Gedanken an die allerbeste Strategie verschwenden, um den Ball zu versenken. Doch stattdessen hat sich der Leistungsgedanke auch in die menschliche Beziehung zum Sport gefressen.
Als ehemalige Leistungssportlerin bin ich von dieser Prämisse besonders geprägt. Von meinem elften Lebensjahr an verbrachte ich zwei bis fünf Nachmittage pro Woche in einer Halle, um einen Lederball gegen die Wand, Unterarme oder den Boden zu knüppeln.