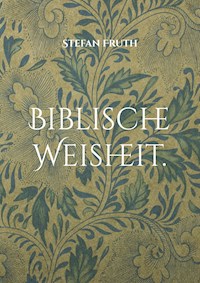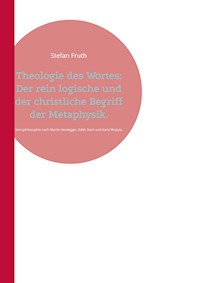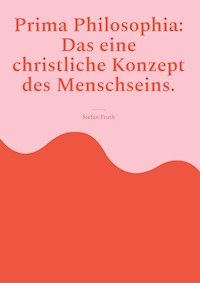
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die vielen philosophischen Versuche der Neuzeit, das menschliche Bewusstsein und Wissen transzendental aus dem Selbstbewusstsein des Menschen 'an und für sich' abzuleiten, übersehen allzu leicht, das Mensch-Sein vor allem 'Mit-Sein in allen Erstreckungen' (j. Ratzinger) ist, wie anhand von Texten der genannten christlichen Denker nachgewiesen werden soll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jesus spricht: “Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.” ( Johannes 15,5).
“Leben im wahren Sinn hat man nicht in sich allein und nicht aus sich allein: Es ist eine Beziehung. Und das Leben in seiner Ganzheit ist Beziehung zu dem, der die Quelle des Lebens ist. Wenn wir mit dem in Beziehung sind, der nicht stirbt, der das Leben selber ist und die Liebe selber, dann sind wir im Leben. Dann ‘leben’ wir.” (Ratzinger Joseph/ PP Benedikt XVI., Enzyklika SPE SALVI, Libreria Editrice Vaticana 2007, Ziffer 27, Seite 35.)
“Gott können wir nicht nur außer uns und in uns, sondern auch über uns schauen: außer uns durch die Spuren, in uns durch sein Bild und über uns durch das Licht, das über unserem Geist aufleuchtet. Dies ist das Licht der ewigen Wahrheit, da unser Geist in seiner Erkenntnis unmittelbar von der Wahrheit selbst gestaltet wird. (...) Wer also das unsichtbare Sein Gottes nach der Einheit seiner Wesenheit betrachten will, der richte zuerst seinen Blick auf das Sein selbst und erkenne: das Sein selbst ist in sich so sehr das Allergewisseste, dass seine Nicht-Existenz nicht gedacht werden kann, weil das reinste Sein selbst uns nur in der vollen Verneinung des Nicht-Seins entgegentritt, wie das Nichts in der vollen Verneinung des Seins. Wie also das schlechthinnige Nichts vom Sein und seinen Eigentümlichkeiten nichts an sich trägt, so hat umgekehrt das Sein selbst nichts von Nicht-Sein, weder dem Akt noch der Potenz nach, weder in Wirklichkeit noch nach unserer Erkenntnis. Da Nicht-Sein Beraubung des Seins ist, tritt es nur durch das Sein in unseren Verstand. Das Sein aber geht nicht durch etwas anderes ein, weil alles, was erkannt wird, entweder als Nicht -Seiendes oder als Seiendes in Möglichkeit oder als Seiendes in Aktualität erkannt wird. Wenn also das Nicht-Seiende nur durch das Seiende erkannt werden kann und das der Möglichkeit nach Seiende nur durch das In-Wirklichkeit-Seiende und Sein eben die reine Aktualität des Seienden bedeutet, dann ist es das Sein, das zuerst in unseren Verstand eintritt, und dieses Sein ist reiner Akt. Das ist aber nicht das Einzelsein, denn ein solches wäre, weil mit Potentialität vermengt, ein beschränktes Sein. Es ist auch kein Sein im analogen Sinn, das ja sehr wenig an Aktualität besitzt, weil es nur geringen Anteil am Sein hat. Also kann jenes Sein nur das göttliche Sein sein.“ (Bonaventura, Itinerarium mentis in deum, Kösel, München 1961, V. Kapitel, Seite 123-127)
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
Die christliche Perspektive einer Synthese der Philosophie der menschlichen Zeit und einer eschatologisch fundierten und auf die Ewigkeit und Allgegenwärtigkeit und Allwissenheit des göttlichen Wesens ausgerichteten Theologie.
Die christliche (Froh-)Botschaft (des Vaterunser) in der philosophisch-theologischen Sicht von Karol Wojtyla und Edith Stein.
Zitat aus den Katechesen von Papst Johannes Paul II.: “Die Liebe des Vaters und des Sohnes in Person”: “Gott ist die Liebe.” (1 Joh 4,8).
Zitat aus den Ausführungen von Edith Stein zum Thema: “Das Abbild der Dreifaltigkeit in der Schöpfung”, aus dem Kapitel: “Das Gottesbild im natürlichen Geistesleben des Menschen”.
Zitat aus der Enzyklika "Spe salvi” von Papst Benedikt XVI.
Zitat aus dem Hauptwerk “Endliches und ewiges Sein” von Edith Stein: “Die Tatsache des eigenen Seins als Ausgangspunkt der sachlichen Untersuchung”.
Zitate aus dem Hauptwerk “Endliches und ewiges Sein” von Edith Stein.
“Person und Geist.”
“Das menschliche Personsein”.
“Das menschliche Sein als leiblich-seelisch-geistiges. Eigentümlichkeit des menschlichen Geisteslebens”.
“Ichleben und leiblich-seelisches Sein”.
“Leib, Seele, Geist. ‘Die Seelenburg’".
“Ich, Seele,Geist, Person”.
“Die Menschenseele im Vergleich zu den niederen Formen und zu den reinen Geistern”.
“Stufen der Selbsterkenntnis”.
“Wesen, Kräfte und Leben der Seele”.
“Das Innere der Seele”
Person und Tat: operari sequitur esse.
Exzerpt aus Wojtylas Lubliner Vorlesung “Das Gute und der Wert” aus dem Kapitel: “Die geschaffenen Güter und der Mensch” nach Thomas von Aquin.
Personalität: Wahrheit, Freiheit, Tätigkeit, Disposition und Fertigkeit; Vernunft, Verstand und Wille. Das “liberum arbitrium”, die freie Wahl und die “Prädestination” im sittlichen Urteil.
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die vielen philosophischen Versuche der Neuzeit, das menschliche Bewusstsein und Wissen transzendental aus dem Selbstbewusstsein des Menschen “an und für sich” abzuleiten, übersehen allzu leicht, das Mensch-Sein vor allem “Mit-Sein in allen Erstreckungen” 1 ist: “so dass in jedem Menschen auch Vergangenheit und Zukunft der Menschheit mit anwesend sind, die sich ja, je mehr man zusieht, als ein einziger ‘Adam’ erweist. (...) Man braucht sich nur bewusst zu machen, dass unser geistiges Leben gänzlich am Medium der Sprache hängt, und dann hinzufügen, dass die Sprache nicht von heute ist: Sie kommt von weit her, die ganze Geschichte hat an ihr gewoben und tritt durch sie in uns ein als die unumgängliche Voraussetzung unserer Gegenwart, ja als ein beständiger Teil davon. Und umgekehrt: Der Mensch ist das Wesen, das auf Zukunft hin lebt, das in der Sorge sich fortwährend über seinen Augenblick hinaus entwirft und nicht mehr existieren könnte, wenn es sich plötzlich zukunftslos vorfände.”
Martin Heidegger hat in seinem philosophischen Hauptwerk “Sein und Zeit” von 1927 in Abhebung von zeitgenössischen Strömungen des Modernismus eine existenziale Sichtweise des Menschen ausgearbeitet und diesem den metaphysisch neutralen Titel: (ontisches) “Dasein” gegeben, dessen ontologischer Sinn in der Zeitlichkeit liegt, in welcher das Dasein selbst sein In-der-Welt-sein (und das daraus entspringende Welterkennen) sich in “eigentlicher Entschlossenheit” erschließt, indem es bereits Vorhandenes und in der alltäglichen Sorge (des Besorgens und Fürsorgens) Bekanntes und Zuhandenes gleichsam transzendieren und dabei vor sich selbst als Existenz Gewissen zeigen soll, damit es eben das Gewissen als “Ruf der Sorge” versteht, welcher es auf ein “mögliches Ganzseinkönnen” seiner Existenz verweist.
So verbindet Heideggers (frühe) Philosophie Anthropologie und Ontologie, wie sich besonders am Phänomen der “Welt” (bzw.
Weltzeit, die eo ipso der Zeitlichkeit “entspringt”) aufweisen lässt, in der als gemeinsamer Welt sich einzelne Existenz des Menschen mit dem Mitsein mit Anderen verbindet und somit eine geschichtliche Form der “Innerzeitigkeit” des Besorgens von Zeit (und der Temporalien; d.h. des Zuhandenen) ausbildet; die man rückblickend als “Historie” und gesamt-menschliche Art und Weise der Weltgeschichte bezeichnen kann.
Während Heideggers frühe Analysen dezidiert nicht-metaphysisch sind, hat sich Edith Stein in ihrem philosophischen Hauptwerk “Endliches und ewiges Sein” von 1950 (eigentlich fertiggestellt ca. 1939) bemüht, den Menschen als endliches Sein dem ewigen Sein Gottes gegenüberzustellen bzw. denkerisch darin zu fundieren, wobei sie in ihren Darlegungen vor allem der scholastischen, aristotelisch-thomanischen Tradition folgt.
Aus derselben metaphysischen Einstellung heraus interpretiert Karol Wojtyla in seinem 1969 erschienenen philosophischen Hauptwerk “Person und Tat” den Menschen als Person, welche von Gott geschaffen ist, und führt dazu seine phänomenologische Analyse aus, wie die menschliche Person zu sich selbst bzw. zu ihrer Eigentlichkeit findet gerade in der Struktur des bewussten Handelns, d.h. der eigentlich-willentlichen und wert-orientierten, verantwortlichen, gewissenhaften und von der (göttlich fundierten) Wahrheit abhängigen Tat, in der es sich über ein bloß passives Hinnehmen eines unpersönlichen Geschehens erhebt bzw. dieses aktiv transzendiert.
Allerdings bedeutet für Wojtyla das scholastische Axiom von Gott als dem höchsten Sein, an dem alle anderen Sein sich nur unvollkommen orientieren können, nicht einen Rückfall in die antike Ontologie (der physikalischen Ding-Vorhandenheit), sondern er betont - nach dem bekannten Satz: metaphysika utilis ad omnia - das irreduzible Vermögen des Menschen in seiner Subjektivität und seine Fähigkeit, Theologie und Philosophie (die Sichtweise des Absoluten und die des nur Kontingenten) in Form seines konkreten Existierens und Handelns als das empirisch-erfahrbare Phänomen der humanen Spiritualität (Geistigkeit, Vernunftbegabung) anthropologisch zu erleben; als eine Art der Nachfolge Christi und so als wahrhafte Person und so als lebendiger Mensch den Schritt zu tun aus der totalen Opposition von Geist und Natur bzw. Materie oder Seele und Leib; ausgehend von den Symptomen und der Folgerichtigkeit der realen Gegebenheiten hin zu den Fundamenten und Gründen des wahren menschlichen Seins; vom passiv verstandenen Aspekt hin zum aktiven, vom Statischen zum Dynamischen, vom fragmentarischen zum holistischen, einheitlichen Verständnis dessen, was Einmaligkeit und Individualität heißen soll.
Die Zeitlichkeit des menschlichen Daseins wird somit bei Wojtyla gewissermaßen als Antizipation und vorläufige Realisation der (göttlichen und wesenhaft-überzeitlichen) Ewigkeit verstanden, in welcher sich Gemeinschaft (als personale communitas) in der Vielheit und Vielfalt aus der Unendlichkeit des Einen Gott heraus ereignet. Damit ist natürlich auch der zentralen Bedeutung des trinitarischen Glaubens und des Christus-Ereignisses ein (katholisches=universales) Wort gesprochen. Im Gegensatz zu einer rein sprachphilosophischen Interpretation des Wortes 2 Gottes in Schöpfung und Mensch bzw. in Verbindung zu einem authentischen Verständnis des dialogischen Prinzips des Naturhaften, stellt für Stein und mehr noch für Wojtyla das seelisch-geisitg-körperliche Leben (Dasein, Existieren) des einzelnen Menschen aber selbst die höchste Ausformung der ursprünglich göttlichen Inspiration dar - wie sie sich vor allem anderen in der historischen Gestalt des Gottes-Sohnes (und Gott-Menschen) Jesu Christi gezeigt hat.
Von diesem angedeuteten philosophischen Standpunkt her wäre also der Weg zu einem biblischen Verständnis des Evangeliums und der Apokalypse als der (geheimen) Offenbarung des Göttlichen Wortes und des Geheimnisses des Heiligen Geistes (als der Dritten Göttlichen Person des trinitarischen göttlichen Wesens und Waltens) nicht mehr weit.
So soll in dieser Arbeit der tatsächlichen Verbindung des göttlich-geistigen (körperlosen) Wort Gottes in der Dimension des Geheimnisses des (menschlichen) Geistes (als sprachliches Ereignis) 3 , und besonders der konkreten Konstitution der menschlichen Existenz selbst in Alltag, Praxis und in der Weise des lebendigen - und des dem Irdischen verhafteten, also faktischen - Existierens des Menschen auf Erden, nachgegangen werden.
So soll dem Anliegen der christlichen Tradition gerecht zu werden versucht werden - und auch dem ursprünglichen Anliegen der Phänomenologie 4 , die sich von allem Anfang an gegen eine rein psychologische und mehr auf eine pneumatologische, d.h. dem menschlichen Wesen als ganzheitliches Wesen mehr entsprechende Interpretation - mit Heidegger gesprochen: Wahrheit also nicht als logische Wahrheit von Sätzen (in einer Sphäre rein abstrakter und nicht näher definierten Geistigkeit) 5 , sondern als Wahr-Sein des menschlichen Existierens und Handelns.
Dabei wird es aber weniger um eine in der Tradition Heideggers vollzogene hermeneutische Daseins-Analyse des Weltphänomens (im In-Sein, In-der-Welt-sein und in der Innerzeitigkeit der Sorge) gehen, sondern um die Legitimation der christlichen Annahme und Voraussetzung einer christlich postulierten “Innerlichkeit” (= geistigen Seele) des Menschen vor Gott, den Mitmenschen und der Umwelt. Es handelt sich dabei also um ein spezielles Wahrnehmen der menschlichen Natur in ihrem Verhältnis zum Göttlichen Wesen als ihrem Ursprung; welche als Konsequenz zu einer wesentlichen und wesenhaften Hinwendung zum Anderen, zum “Du” führen soll.
Diese durchaus praktische Hinwendung zum Nächsten, zum anderen Mitmenschen als alter ego und Abbild Gottes, diese tätige Nächstenliebe (caritas, agape, philia), ist das spezifisch Christliche.
- Welches freilich bis zum heutigen Tag unter dem Skandalon des Kreuzes steht; und so sozusagen ständig vom Tod, von Leiden und Absterben, bedroht ist.
Trotzdem soll im Zentrum dieser Arbeit mehr der konstitutive philosophische Aspekt der humanen Struktur fokussiert - und dabei mehr in seiner Ursprünglichkeit, Vitalität und Aktualität angesprochen, gedeutet und nicht schon restlos (in der Weise einer philosophischen Systematik) erklärt werden; um so die stets neue Dimension einer authentischen Reziprozität zu öffnen.
Damit soll schließlich auch der generelle und wesenhafte Zusammenhang von Ontologie und Anthropologie und von Philosophie und Theologie aufgezeigt werden, wie er in den philosophischen Hauptwerken Edith Steins und Karol Wojtyla dargelegt ist.
Denn der Mensch an und für sich ist kein abstraktes Produkt einer wie auch immer gearteten materia prima, sondern ein “Hörer des Wortes" 6 und gleichsam ein "Täter" des Wortes.
Zielgestalt einer so verfolgten christlichen Philosophie ist also - mit Wojtyla gesprochen 7 - die Synthese von moderner Phänomenologie und scholastischer Seinsphilosophie sein, wie sie z.B. von Stein und Wojtyla in den beiden besonders heranzuziehenden Werken: “Endliches und Ewiges Sein” bzw.
“Person und Tat” beispielhaft und der christlichen Schul-Tradition folgend expliziert wurden.
1 Ratzinger Joseph, Einführung in das Christentum, Kösel 2005; Seite 232-233.
2 z.B. die “Pneumatologie des Wortes” von Ferdinand Ebner.
3 z.B. in einer ahistorischen Gnadentheologie in der Weise einer theoretischen Identifikation von (wie auch immer verstandenem) Sein und Denken.
4 z.B. von Husserls Ideation und epoche
5 z.B. in der solipsistischen Selbstsetzung im Deutschen Idealismus von Fichte und Hegel, aber auch in der Transzendentalphilosophie Kants - als “Ich-Einsamkeit” und Objekt einer pathologischen Psychologie.
6 vgl. das gleichnamige Buch von Karl Rahner
7 Karol Wojtyla/ Johannes Paul II., Person und Tat, Herder 1981, Seite 91: “Es mag so scheinen, als ob die Gleichsetzung der Person mit dem suppositum - selbstverständlich unter Anwendung der Proportionalitätsanalogie - bereits von vornherein darüber entscheidet, welche Bedeutung wir der Natur in der Analyse des Subjekts des Handelns geben wollen. Doch die Person und mit ihr das suppositum wurden nicht nur als metaphysisches Subjekt des Existierens und des Dynamismus des Menschen begriffen, sondern auch als gleichsam phänomenologische Synthese von Wirkmacht und Subjektivität. In Verbindung damit muss auch die Natur eine gewisse Doppelbedeutung annehmen, und das gerade wollen wir jetzt beleuchten.” Dazu: Karol Wojtyla/ Johannes Paul II., Person und Tat, Herder 1981, Seite 95: “Von den Momenten oder auch Aspekten der Erfahrung müssen wir zum Ganzen übergehen, und von den Momenten oder Aspekten des Menschen als dem Subjekt der Erfahrung müssen wir zu einer ganzheitlichen Auffassung des Menschen übergehen. (Im Verlauf des wirklichen Erkennens kommt ein solcher Übergang und eine solche Richtung des Erkennens nicht vor - im wirklichen Erkennen stecken die Aspekte und Momente immer schon im Erkenntnisganzen. Trotzdem betrachten wir hier diesen Übergang und schlagen diese Richtung ein, um gründlicher zu erkennen. Es geht auch darum, zu zeigen, wie Phänomenologie und Metaphysik im selben Objekt schürfen und sich doch gegenseitig nicht ausstreichen.)” Mit dem “suppositum” meint Wojtyla die “Synthese von Handeln und Geschehen, wie es im Menschen vorkommt, eine Synthese der Taten und Aktivierungen, eine Synthese von Wirkmacht und Subjektivität auf der Grundlage ein-und desselben” [Menschen].(Ebd.)
Die christliche Perspektive einer Synthese der Philosophie der menschlichen Zeit und einer eschatologisch fundierten und auf die Ewigkeit und Allgegenwärtigkeit und Allwissenheit des göttlichen Wesens ausgerichteten Theologie .
Man kann menschliches Dasein in der Welt sicherlich im Allgemeinen beschreiben als den stets und ständig gegenwärtigen, vernünftigen (rationalen) Standpunkt des Menschen als In-der-Welt-sein in Raum und Zeit und in einen geschichtlich historischen Zeitspielraum gestellt, innerhalb dessen sich der auf sich allein gestellte Mensch praktisch und handelnd gegenüber einer mitmenschlichen Gesellschaft und gegenüber einer umwelthaften Natur bewähren und sich selbst in seiner konkreten geistigen und körperlichen Existenz und der ihm eigenen Zeitbedingtheit - als Zeitlichkeit in einer Weltzeit - beweisen muss; welche Weltzeit der Mensch in seiner Zeitlichkeit allerdings gegenwärtig aktiv gestalten und auch denkerisch vorgreifend, utopisch