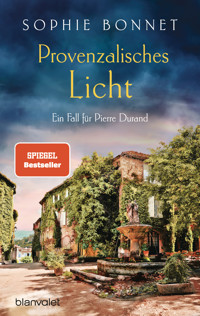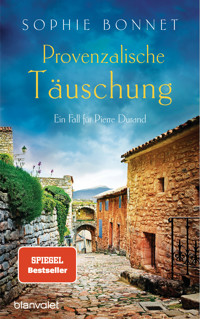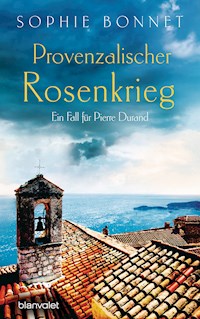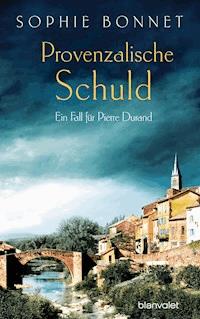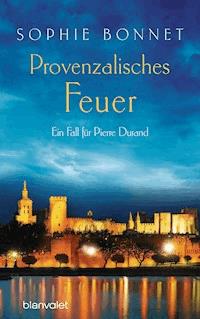9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Pierre-Durand-Krimis
- Sprache: Deutsch
Frühling in der Provence. Die Felder blühen. Doch ein grausamer Mord stört die Idylle …
Es ist Frühling in der Provence. Das Luberon-Tal ist in ein weiß-rosa Blütenmeer getaucht, und in den Destillerien rund um Sainte-Valérie herrscht Hochbetrieb. Inmitten dieser Idylle wird Paulette Simonet, Inhaberin der Kosmetikfirma Mer des Fleurs, tot im Kessel ihrer Seiferei aufgefunden. Unfall oder Mord? Feinde gab es reichlich. Die Verfechterin nachhaltiger Produkte hatte sich nicht nur mit den traditionellen Marseiller Seifenfabrikanten angelegt, sondern auch mit einer Supermarktkette, die billige Fälschungen ihres Sortiments auf den Markt brachte. Ein Fall für Pierre Durand, dessen Ermittlungen ihn quer durch Südfrankreich führen – und in die Tiefen eines Rosenkriegs zwischen der Ermordeten und ihrem Exmann …
»Niemand verbindet Genuss und Verbrechen so harmonisch wie Sophie Bonnet in ihren Provence-Krimis.« Hamburger Morgenpost
Lesen Sie auch weitere Romane der hoch spannenden »Pierre Durand«-Reihe!
Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Es ist Frühling in der Provence. Das Luberon-Tal ist in ein weiß-rosa Blütenmeer getaucht, und in den Destillerien rund um Sainte-Valérie herrscht Hochbetrieb. Inmitten dieser Idylle wird Paulette Simonet, Inhaberin der Kosmetikfirma Mer des Fleurs, tot im Kessel ihrer Seiferei aufgefunden. Unfall oder Mord? Feinde gab es reichlich. Die Verfechterin nachhaltiger Produkte hatte sich nicht nur mit den traditionellen Marseiller Seifenfabrikanten angelegt, sondern auch mit einer Supermarktkette, die billige Fälschung ihres Sortiments auf den Markt brachte.
Ein Fall für Pierre Durand, der sich gerade für die Position als Commissaire in Cavaillon beworben hat. Seine Ermittlungen führen ihn quer durch Südfrankreich – und in die Tiefen eines Rosenkriegs zwischen der Ermordeten und ihrem Exmann …
Autorin
Sophie Bonnet ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin. Mit ihrem Frankreich-Krimi Provenzalische Verwicklungen begann sie eine Reihe, in die sie sowohl ihre Liebe zur Provence als auch ihre Leidenschaft für die französische Küche einbezieht. Mit Erfolg: Der Roman begeisterte Leser wie Presse auf Anhieb und stand monatelang auf der Bestsellerliste, ebenso wie ihr zweiter Roman Provenzalische Geheimnisse. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Hamburg.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
SOPHIE BONNET
ProvenzalischeIntrige
Ein Fall für Pierre Durand
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. AuflageCopyright © 2016 by Blanvalet in der VerlagsgruppeRandom House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Angela TroniUmschlaggestaltung: www.buerosued.deUmschlagmotiv: Plainpicture/Water Rights/Yann GuichaouaAF · Herstellung: kwSatz: DTP Service Apel, HannoverISBN 978-3-641-17138-4V001www.blanvalet.de
Prolog
Im selben Augenblick, als sie in den Kessel sah, dachte sie an ihre Kindheit. Sie war gerade acht Jahre alt, trug das Haar zu Zöpfen geflochten und stand mit nackten Füßen vor der Küchentür, lugte durch einen Spalt zu Maman, die gerade calissons fertigte.
Die ovalen Konfektstückchen aß Paulette von allen dreizehn Weihnachtssüßigkeiten am liebsten. Auch jetzt, da sie der goldgelben, siedenden Masse immer näher kam und den Geruch gemahlener Mandelkerne einsog, meinte sie, das Marzipan auf der Zunge zu schmecken, die kandierten Melonen, Orangen und Zitronen.
Eine Welle der Glückseligkeit durchflutete sie, was angesichts der prekären Lage, in der sie sich befand, paradox, ja nahezu diabolisch anmutete.
Alles gut, dir wird nichts geschehen, dachte sie und zwang sich, ihre Aufmerksamkeit weiter auf das Aroma des emporsteigenden Dampfes zu richten. Du darfst jetzt keine Angst zeigen!
Schon immer hatte sie auf Gerüche mit heftigsten Emotionen und Bildern reagiert und dabei alles um sich herum vergessen. Jetzt waren sie ihr Rettungsanker; halfen, die Unruhe zu bezwingen, die plötzlich von ihr Besitz ergriff.
Ja, es war ihr wichtig, wie Dinge rochen, und das galt nicht nur für zuckrige Leckereien, sondern vor allem für die Seifen von Mer des Fleurs. Darüber konnten sich diese Sturköpfe aus Marseille lustig machen, wie sie wollten. Es war nun einmal Tatsache: Die echte Savon de Marseille stank wie hunderttausend Höllenhunde! Medizinisch, streng, beißend. Der seifige Brei, der in dem gewaltigen Fabrikkessel unter ihr blubberte, roch hingegen süß und warm, der Duft hüllte sie ein, milderte ihr Unbehagen.
»Verdammt, nun komm schon, ich will dir nicht wehtun müssen«, tönte es an ihrem Ohr.
Sorge war aus der Stimme zu hören. Aber es war wichtig, dass sie, Paulette, sich so hartnäckig zeigte und damit ein Zeichen setzte, endgültig.
»Ich lasse mich nicht erpressen«, stieß sie hervor. »Von niemandem.«
Bitte, warum kommt denn keiner?
Im Büro, nur wenige Meter von der Seiferei entfernt, bereiteten die Angestellten gerade die Feier vor, mit der das fünfzehnjährige Bestehen von Mer des Fleurs begangen werden sollte. Bürgermeister, Presse, Lieferanten, sie alle hatten zugesagt, wollten dabei sein, wenn hunderte türkisblaue Luftballons mit dem Firmenlogo in den Himmel aufstiegen, begleitet von Reden, Musik und Canapés.
In diesem Moment, als ihre Hüfte unvermittelt gegen den Kessel gedrückt wurde, befüllten die anderen dort nichtsahnend die hübschen Tütchen mit den Kosmetikproben. Emile kalkulierte gerade die Kosten und fragte sich vielleicht genau in diesem Augenblick, ob sie nicht doch den Musiker aus Salon-de-Provence engagieren könnten, wenn sie dafür bei den Getränken sparten. Er würde ins Stocken kommen, so wie immer, und sich um eine Entscheidung herumwinden, die er ohne sie nicht fällen mochte. Jede Sekunde könnte einer von ihnen nachsehen, warum sie so lange fortblieb. Die Stufen zur Seiferei hinaufeilen und sie aus ihrer misslichen Lage befreien.
»Also gut, du willst es nicht anders!« Die Sorge war offenbar in Wut umgeschlagen. Eine Wut, die etwas Bedrohliches hatte.
Paulette wand sich in dem festen Griff und trat nach hinten.
Eine Hand legte sich auf ihren Hinterkopf und presste sie nach unten, stieß mit ungeahnter Kraft nach, bis ihre Muskeln den Widerstand nicht mehr halten konnten und ihr Oberkörper nach vorn kippte. Heißer Dampf schlug ihr entgegen, sie hustete, als sie ihn einatmete. Ungläubige Angst stieg in ihr auf.
»Willst du mich etwa umbringen?«, schrie sie. Ihr Herz raste. Hatte sie bisher geglaubt, die Situation annähernd unter Kontrolle zu haben, so wusste sie plötzlich, dass etwas ganz furchtbar aus dem Ruder lief.
Heiße Schwaden umhüllten ihr Gesicht, brannten auf der Haut. Verzweifelt schnappte sie nach Luft.
Ein heftiger Schmerz durchzuckte ihren Hals. Sie schluckte schwer, spürte, wie ihr Kehlkopf mit jedem Atemzug enger wurde. Panisch drückte sie die Hüfte fester an den Rand des Kessels und versuchte, den Kopf zu heben.
»Aufhören, bitte«, presste sie hervor. »Wir finden schon eine Lösung.« Ihr Brustkorb wurde immer enger. »Sofort aufhören«, setzte sie heiser nach, »ich bekomme keine Luft mehr.«
Die Antwort ging im Brodeln der Seifenmasse unter, ein fernes Wispern. Die Hitze war inzwischen unerträglich, brannte in Augen und Nase und ganz tief im Inneren des Brustkorbes. Mit einer hastigen Bewegung zog sie die Luft ein und mit ihr eine Glut, die sich bis in die kleinsten Verästelungen ihrer Lunge schlich und ihr vollends den Atem nahm.
Auf einmal war ihr, als hörte sie zwei Stimmen hinter ihrem Rücken, die laut miteinander zu diskutieren schienen. Sie glaubte, die andere Stimme zu erkennen, schwankte zwischen Sorge und Hoffnung, während sie spürte, wie ihr Bewusstsein langsam schwand.
»Hilf mir!«, flehte sie schwach.
Zu spät.
War es das? Der Moment, an dem sie sich aus dem Leben verabschieden sollte? Die Endgültigkeit erschreckte sie.
Etwas Hartes prallte gegen ihren Rücken, ein Schrei erklang. Dann ein weiterer Stoß, sie sackte nach vorne, verlor den Halt, fiel.
Ihr letzter Gedanke galt Mathéo, ihrem Sohn. Maman würde ihn mit Liebe und Fürsorglichkeit verwöhnen. Und mit süßen, klebrigen calissons.
1
»Monsieur Durand?«
Die junge Dame sah sich um, als seien sämtliche Stühle im Gang besetzt. Sie hatte beide Augenbrauen hochgezogen, was ihrem Gesicht einen strengen Ausdruck verlieh. Schließlich blieb ihr Blick am einzigen Besucher hängen.
»Das bin ich«, antwortete Pierre und stand auf.
Er folgte dem gestrafften Rücken der Frau über das quietschende Linoleum und fragte sich, warum zum Teufel er sich fühlte wie ein ungezogener Schüler auf dem Weg zum Direktor. Dabei war er bereits öfter in der Präfektur von Avignon gewesen. Beim ersten Mal hatte er sich der Höflichkeit halber – und auf Betreiben des Bürgermeisters Arnaud Rozier – dem Präfekten als neuer Chef de police von Sainte-Valérie vorgestellt. Als man ihn damals an den zahllosen Türen vorbei zum Büro von Monsieur le préfet Gilles Fardoux geleitet hatte, war er stolz gewesen, in freudiger Erwartung auf sein neues Amt.
Das war heute anders, und das Gefühl, dass er im Begriff war, eine große Dummheit zu begehen, war kaum zu ignorieren.
Wollte er wirklich in die alte Tretmühle zurück? Sich dem engmaschigen Behördennetz, den Intrigen ausliefern, denen er sich damals mit seiner Kündigung in Paris entzogen hatte?
»In Cavaillon ist das anders, bei uns geht es kameradschaftlich zu«, hatte ihm Jean-Claude Barthelemy versichert, der bald in den Ruhestand gehen würde. Der alte Commissaire hatte Pierre geradezu gedrängt, sich als sein Nachfolger zu bewerben.
»Als einfacher Dorfpolizist wirst du nicht glücklich«, hatte er konstatiert. »Es wird immer jemanden geben, der deine Einmischung in laufende Ermittlungen nicht gutheißt.« Dann hatte er rasselnd gehustet und die Stirn in tiefe Falten gelegt. »Komm schon Pierre, das ist deine Chance. Du kannst doch nicht ohne!«
Über Wochen hatte Pierre mit sich gerungen und das Für und Wider gegeneinander abgewogen.
Für eine Fortsetzung seiner Tätigkeit als Dorfpolizist sprachen die Ruhe und Beschaulichkeit, die er in dieser Position genoss. Die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, der ihm zumeist freie Hand ließ. Mit Gisèle, der Empfangsdame in der mairie,und – er hätte es nie für möglich gehalten – sogar die mit Luc, seinem übereifrigen und manchmal etwas einfältigen Assistenten. Nicht zuletzt waren da noch die Bewohner von Sainte-Valérie, die ihn endlich in ihre Gemeinschaft aufgenommen hatten und die sich auf ihn verließen.
Dann hatte er an seine angespannte finanzielle Lage gedacht und an die beiden letzten Mordfälle, bei denen er aufgrund seines Dienstgrades nur inoffiziell hatte ermitteln dürfen. Das hatte den Ausschlag gegeben.
Es folgten Personalgespräche, körperliche wie psychologische Untersuchungen und ein mehrstündiger Eignungstest, dessen Fragen zu Politik, Geschichte und Allgemeinwissen besser in das Fernsehquiz Qui veut gagner des millions? gepasst hätten. Aber Pierre kannte das schon, er hatte sich entsprechend darauf vorbereitet.
Und nun der Anruf, sich umgehend einzufinden.
Mit zunehmendem Unwohlsein fragte sich Pierre, ob er besser gleich umkehren sollte, als die Dame endlich stehen blieb und an eine der grau lackierten Türen klopfte. »Der erste Bewerber, Monsieur Durand!«, rief sie ins Zimmer. Dann drehte sie sich zu Pierre um und nickte ihm ohne ein Lächeln zu. »Bitte treten Sie ein.«
»Vielen Dank, das ist überaus freundlich von Ihnen«, antwortete Pierre mit übertriebener Liebenswürdigkeit.
Er widerstand dem Impuls, dem Ganzen mit einer Verbeugung die Krone aufzusetzen, und marschierte geradewegs auf den Schreibtisch zu, an dem zwei Männer saßen. Links der Präfekt Gilles Fardoux, groß wie ein Schrank, das Gesicht hingegen weich und freundlich wie das eines Kindes. Neben ihm ein schmaler, distinguiert wirkender Uniformierter mit silbrigen Schläfen und üppigem, dunklem Haupthaar, das durch den großen Farbkontrast wie ein Toupet wirkte.
»Monsieur Durand, wie schön, Sie wiederzusehen«, rief Fardoux aus und zeigte auf seinen Nebenmann. »Darf ich Ihnen meinen Generalsekretär vorstellen? Das ist Monsieur Delettre, Unterpräfekt und Koordinator für die polizeilichen Belange.«
Sie schüttelten sich die Hände, wobei Pierre auffiel, dass der Generalsekretär der Polizeiverwaltung einen wesentlich festeren Händedruck hatte als sein Vorgesetzter, dann nahmen alle drei Platz.
Fardoux schlug eine Aktenmappe auf, nickte kurz, als sei er zufrieden mit dem, was er dort sah, und schloss sie gleich wieder.
»Monsieur Durand«, begann er ohne Umschweife, »ich will ehrlich sein. Ihr ehemaliger Vorgesetzter in Paris hat mir von Ihrer Berufung abgeraten. Aber Sie haben Glück, ich mag ihn nicht besonders, er ist mir zu glatt. Genau genommen würde ich mich darüber freuen, ihm eins auszuwischen.« Er lächelte verschwörerisch. »Ich muss sagen, dass mich Ihr rascher Aufstieg innerhalb des Pariser Polizeiapparates sehr beeindruckt hat. Zudem gefällt mir die Unbeirrbarkeit, mit der Sie sich in der Vergangenheit bei der Klärung der beiden Mordfälle im Distrikt Provence-Vaucluse hervorgetan haben. Genau so jemanden brauchen wir im Kommissariat von Cavaillon.«
»Mit Verlaub, Monsieur le préfet, im Fall der Befugnisüberschreitung wäre eher ein internes Verfahren wegen Amtsanmaßung angebracht gewesen«, wandte der Generalsekretär ein. »Dagegen war das Ergebnis der Eignungstests in der Tat recht beeindruckend, nur scheint mir Ihre körperliche Fitness in den letzten Jahren etwas gelitten zu haben. Weder die Bewegungsschnelligkeit noch die Kraftausdauer der Bauchmuskulatur war befriedigend.« Er ließ den Blick über Pierres Körper wandern, bis er in der Leibesmitte hängen blieb. »Sie sollten weniger essen und mehr Sport treiben.«
Pierre sog die Luft ein. Was für ein unangenehmer Kerl! Er dachte an das Deeskalationstraining, das Teil der Vorbereitungsmaßnahmen auf diesen Posten war, und atmete langsam wieder aus, während er bis acht zählte. In puncto Fitness hatte Delettre leider Recht. Seine Kondition hatte in den letzten Jahren nachgelassen, das hatte er bei seinem letzten Fall bemerkt, als der Verdächtige ihn in einem Sprint weit hinter sich gelassen hatte. Er nahm sich vor, wieder mit dem Joggen zu beginnen und jeden Morgen vor der Arbeit ein paar Kraftübungen zu machen.
Was aber das Essen anging …
Trotzdem nickte Pierre folgsam, woraufhin sich der Präfekt zufrieden zurücklehnte. »Wunderbar, damit sollte das ja geklärt sein!«
»Nun, wir werden sehen«, entgegnete Delettre und fuhr mit strengem Blick fort: »In diesem Auswahlverfahren hat alles seine Bedeutung.«
Er machte eine kunstvolle Pause, in der er den Kopf nach oben reckte, als ziehe ein unsichtbarer Marionettenspieler an seinem Haar.
»Wir sitzen hier beisammen«, fuhr er fort, »weil der Juryvorsitzende des Bureau du Recrutement Sie mit Nachdruck für die letzte Runde empfohlen hat. Gemeinsam mit einem anderen Bewerber.« Er griff nach der Akte, blätterte mit nervenaufreibender Gelassenheit durch die Seiten und runzelte schließlich die Stirn. »Sie müssen zugeben, dass Ihr Werdegang äußerst eigenwillig ist. Helfen Sie mir, Ihr Anliegen zu verstehen. Sie sind als leitender Commissaire in Paris ausgestiegen, um sich zum einfachen Dorfpolizisten zu … nun ja … zu verändern. Wie kommt es, dass Sie sich entschieden haben, nun doch in den höheren Dienst zurückzugehen? Hat Ihnen die Arbeit als Policier nicht gefallen?«
»Also …« Pierre sah zu Fardoux, der ihm freundlich zunickte, dann wieder zu Delettre. Mit dem Präfekten ließ sich gewiss gut auskommen. Mit dessen uniformiertem Beißhund jedoch würde er aneinandergeraten, so viel war sicher. »Ich habe mich für die Position als Commissaire von Cavaillon beworben, obwohl mir der Posten als Chef de police municipale sehr gut gefällt«, antwortete er, wobei er das Chef deutlich betonte. »Der Hauptgrund für meinen Entschluss sind die polizeilichen Kompetenzen, die im Dienst der police nationale um einiges umfangreicher sind.«
»Ja, Ihre Überschreitungen sind legendär. Grenzen zu akzeptieren gehört wohl nicht zu Ihren Stärken?«
Pierre blieb ruhig. Die Taktik, die Delettre jetzt fuhr, war durchschaubar. Es gehörte dazu, den Bewerber zu provozieren, um seine emotionale Belastbarkeit zu testen, ebenso die Fähigkeit, bei Kritik ausgeglichen zu bleiben.
»Ich habe immer innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen gehandelt«, antwortete er fest, »und sie nur dort gedehnt, wo es die reglements zuließen.«
»Soso, und dabei einige Alleingänge hinter dem Rücken der Kollegen riskiert. Monsieur le préfet mag es als Unbeirrbarkeit auslegen, für mich dagegen ist es ein Zeichen mangelnder Teamfähigkeit.«
»Um zu dieser Meinung zu kommen, haben Sie sicher mit allen Beteiligten gesprochen?«
»Es genügt, was ich weiß.«
»Ah, Sie arbeiten also auch gerne im Alleingang?« Den Hieb hatte er sich nicht verkneifen können.
Über das Gesicht von Fardoux huschte ein Lächeln. Delettre hingegen verzog keine Miene.
»Wollen Sie uns erzählen, warum gerade Sie für den Posten der Richtige sind?«
»Ich …«, begann Pierre. Er hasste solche Gespräche. Noch mehr aber verabscheute er Menschen, die die Antworten auf derartige Fragen zur Basis ihrer Entscheidungen machten. Emotionale Ausgeglichenheit hin oder her, er mochte sich nicht länger verstellen, es entsprach nicht seinem Naturell. »Ich nehme an, Sie werden Ihre Wahl nicht davon abhängig machen, welche Argumente ich jetzt in die Waagschale lege.«
»Doch, davon können Sie ausgehen. Selbstverständlich bleibt es Ihnen überlassen, ob Sie sich unseren Fragen stellen wollen. Dennoch kann ich Ihnen nur raten, es zu tun, wenn Sie die Situation für sich entscheiden wollen. Sie und Ihr Mitbewerber liegen derzeit gleichauf.« Er hob die rechte Hand und führte Daumen und Zeigefinger bis auf wenige Millimeter zusammen. »Ihre Chancen auf den Posten sind nahezu identisch. Also, warum gerade Sie?«
Pierre atmete tief durch. Wollte er das wirklich? Er zeigte auf den Aktenordner. »Steht alles da drin.«
»Ich würde es trotzdem gerne in einem klar formulierten Satz von Ihnen hören.« Delettre beugte sich vor, wohl um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Dabei fixierte er Pierre, als sei er Schlangenbeschwörer im russischen Staatszirkus.
»Verehrter Herr Delettre«, entgegnete Pierre so ruhig, wie es ihm nur möglich war, »wenn Sie jemanden suchen, der sich mit der Eloquenz eines Versicherungsvertreters verkaufen kann, dann bin ich für diesen Posten mit Sicherheit der Falsche.«
»Vorsicht, mein Freund.« Delettres Stimme bekam einen drohenden Unterton. »Vielleicht mag dieses rebellische Cowboygetue bei Ihnen auf dem Land Beifall finden. Bei uns allerdings ist eine gewisse Disziplin neben gutem Benehmen Grundvoraussetzung.«
Das reichte. Pierre warf einen raschen Blick auf die Uhr und stand auf. Halb neun, es wurde Zeit zurückzufahren, wenn der Bürgermeister nichts von seinem Ausflug nach Avignon merken sollte. Noch konnte er in sein altes, vielleicht unaufgeregtes, aber zumindest idiotenfreies Leben zurückkehren, ohne dass Arnaud Rozier von der Bewerbung erfuhr.
»Wenn Sie es für gutes Benehmen halten, mich persönlich zu beleidigen, haben wir tatsächlich ein Problem«, knurrte Pierre. »Bei uns auf dem Land kann das ganz rasch zu Handgreiflichkeiten führen. Sie werden daher sicher verstehen, dass ich jetzt besser gehe.«
Noch im Moment seiner impulsiv vorgetragenen Erwiderung wusste er, dass er gerade dabei war, die zaghaft geöffnete Tür zu einer sorgenfreien Zukunft mit lautem Knall zuzuschlagen, aber das war ihm jetzt auch egal. Entweder der Präfekt nahm ihn, wie er war, oder er konnte ihm gemeinsam mit seinem toupierten Generalsekretär den Buckel herunterrutschen.
Das fassungslose Gesicht von Monsieur Delettre begleitete Pierre durch den langen Flur zurück. Tief in Gedanken ging er an der Anmeldung vorbei ins Freie und wäre dabei beinahe mit einem Mann in einem tadellos sitzenden Anzug zusammengestoßen, der vor der großen Flügeltür stand und rauchte.
»Pardon«, murmelte er.
»Pierre Durand?«
Er hielt inne und betrachtete das jugendliche Gesicht seines Gegenübers. Der Mann war Mitte dreißig, groß und schlank, das volle braune Haar ordentlich zurückgekämmt. Er kannte dieses Gesicht, auch wenn die elegante Kleidung an dem dazugehörigen Körper ungewohnt war.
»Robert, was machen Sie denn hier?«
Vor ihm stand Inspektor Lechat, Jean-Claude Barthelemys langjähriger Assistent.
»Ein wichtiger Termin.« Er strich sich über den Anzug.
»Lassen Sie mich raten: Sie sind einer der letzten Kandidaten für den Posten des Commissaire in Cavaillon.«
»Woher wissen Sie das?«
»Was glauben Sie?«
»Sie etwa auch?« Robert Lechat riss die Augen in ungläubigem Staunen auf, dann verzog sich sein Mund zu einem breiten Grinsen. »Himmel, dann kann ich ja gleich wieder fahren!«
Pierre mochte den jungen Mann, der ihn stets wie einen Kollegen behandelt hatte, nie als einfachen Dorfpolizisten. Die Tatsache, dass ausgerechnet Robert sein Gegenspieler sein sollte, machte ihm den impulsiven Abgang leichter. Egal ob man sich nun gegen ihn entschied, mit Robert würde jemand befördert, der es verdiente.
»Keine Sorge, ich glaube, meine Chancen haben sich gerade in Luft aufgelöst.« Er reichte Lechat die Hand. »Viel Erfolg!«, sagte er und meinte es aufrichtig.
Noch einmal nickte er dem Kontrahenten zu, dann setzte er seinen Weg in Richtung des hohen Eisentors fort.
Robert Lechat, ausgerechnet.
2
Pierre hatte sich für die Fahrt zur Präfektur den alten Kastenwagen von Didier Carbonne geliehen, dem verwitweten Uhrmacher, der sich in letzter Zeit immer häufiger unangekündigt auf seinem Hof blicken ließ. Was weniger an Pierres Gastfreundlichkeit lag, sondern eher an Charlottes Anwesenheit, die Carbonne zu wittern schien wie ein herrenloser Hund. Als er auch heute in aller Herrgottsfrühe auf den Vorplatz gerumpelt kam, hatte Pierre ihn kurzerhand gebeten, ihm den Citroën für zwei, drei Stunden auszuleihen. Er war froh darüber, nicht mit dem – für private Bewerbungsfahrten gar nicht zulässigen – Polizeidienstwagen fahren zu müssen.
Der alte Uhrmacher hatte über seinen struppigen Bart gestrichen und schließlich genickt, ohne nachzufragen, wofür er den Wagen denn brauche. Indiskretionen waren ihm fremd. Vielleicht aber lag es auch daran, dass er sich grundsätzlich nicht um die Angelegenheiten anderer Leute scherte, es sei denn, sie betrogen ihn beim Boulespiel.
Als Pierre die Tür des Kastenwagens öffnete, schlug ihm der Geruch von kaltem Rauch und modrigen Sitzen entgegen. Mit angehaltenem Atem stieg er ein, betätigte die altmodische Fensterkurbel und startete den Motor. Scheppernd und mit einer bedenklich lauten Fehlzündung setzte sich der Wagen in Bewegung.
Während Pierre vom Parkplatz rollte und das imposante Gebäude der Präfektur hinter sich ließ, fragte er sich, ob es nicht doch ein Fehler gewesen war, den Generalsekretär derart anzugehen. Nun, da er es so weit geschafft hatte.
Er unterdrückte ein Seufzen.
So lange hatte er mit sich gerungen, und nun würde ein anderer ihm die Entscheidung abnehmen.
Langsam fuhr Pierre den Boulevard Limbert entlang und war dabei so in Gedanken versunken, dass er vergaß, in die Avenue Pierre Semard einzubiegen, die im weiteren Verlauf zur N 7 wurde und direkt ins Luberon-Tal führte. Er bemerkte es erst, als er bereits den Bahnhof passierte. Wenden war hier unmöglich, die Autos fuhren dicht an dicht. Er versuchte es mit Handzeichen und winkte vergeblich seinem Nebenmann zu, aus dessen offenem Fenster wummernde Rapmusik tönte und an seinen ohnehin angespannten Nerven zerrte.
Fluchend ließ Pierre an einer Ampel eine Gruppe Reisender vorbei, die in Richtung Innenstadt strebten. Dabei fiel ihm der Unrat am Straßenrand auf. Papierfetzen, Folie, Zigarettenkippen – und war das dort hinten nicht sogar eine herrenlose Rolle Toilettenpapier? Dabei hatte die Saison noch nicht einmal begonnen.
Im Juli, wenn das berühmte Festival d’Avignon Besucher, Theatermacher und schrill kostümierte Künstler anzog und die Stadt bunt und laut pulsierte, wurde die Lage noch dramatischer. Innerhalb kürzester Zeit verwandelte sich der historische Stadtkern rund um den Papstpalast in eine Müllkippe. Zahllose Plakate, auf denen mehr als sechshundert Inszenierungen um Zuschauer buhlten, klebten dann an den mittelalterlichen Stadtmauern und wehten durch die überfüllten Gassen. Es war nicht zu übersehen, dass die Stadt, glanzvolles Zentrum von Kunst und Kultur, die Ausgaben für die Straßenreinigung zugunsten eines ausgeglichenen Haushaltes reduziert hatte.
Daran würde sich Pierre erst wieder gewöhnen müssen. Die Jahre auf dem Land hatten ihn empfindlicher gegen Schmutz, Lärm und Hektik gemacht. Der Luberon kam ihm dagegen geradezu vor wie eine riesige, liebevoll gepflegte Parkanlage. Sollten sie ihn wider Erwarten doch als Commissaire von Cavaillon berufen, das ähnlich betriebsam war wie Avignon, würde er sich erheblich umstellen müssen.
Pierre lenkte den Wagen über den Pont de l’Europe auf die Île de Piot und fuhr dort von der Hauptstraße ab, um in einem großen Bogen zu wenden. Endlich nahm er die Abzweigung in Richtung des Tals, und je weiter die Landschaft wurde, desto mehr hob sich seine Laune. Mit jedem Kilometer, dem er sich Sainte-Valérie näherte, löste sich die innere Anspannung. Pierre begann, die Fahrt in der alten Kiste zu genießen.
Wind drang durchs geöffnete Fenster und zerzauste ihm das Haar. Er war mild, ganz anders als der Mistral, der noch vor wenigen Tagen durchs Land gezogen war. Das tosende Ungetüm hatte einen sauber gewaschenen Himmel hinterlassen, dessen Blau die Farbe von Kornblumen hatte. Nun schien die Sonne auf zerrupfte Sträucher, abgeknickte Zweige und auf die Kirsch- und Mandelblüten, die sich aus den Knospen schoben und der Sonne entgegenreckten.
Als Pierre an der Abfahrt in Richtung Cavaillon vorbeifuhr, schaltete er das Radio ein. Auf Bleu Provence lief eines seiner Lieblingslieder, doch seine Aufmerksamkeit war ganz bei der Pracht, die sich ihm darbot. Der Kontrast zu den Eindrücken, die er noch vor wenigen Minuten gewonnen hatte, hätte kaum größer sein können.
Das ganze Tal war in ein rosa-weißes Blütenmeer getaucht, Felder und Wiesen schimmerten magenta, gelb und rot. Kaum ein Tourist, der im Hochsommer die D 900 entlangfuhr und am Straßenrand hielt, um die sattgrünen Weinberge bei Gargas zu fotografieren, ahnte, dass sich bereits zu Beginn des Nationalparks eine Apfelplantage an die nächste reihte, dazwischen Kirschbäume, Kürbis- und Zucchinifelder. Erst im Frühjahr, wenn die Natur die farbenfrohsten Bilder malte, wurde so manchem die vollumfängliche Fruchtbarkeit des Tales bewusst.
Pierre lächelte und summte zur Musik, während das Auto die steile Straße zum Dorf hinaufächzte.
Er liebte diese Jahreszeit. Die Temperaturen waren angenehm warm, die Luft war angefüllt mit dem betörenden Duft wildwachsender Blumen.
Hinter der letzten Kurve tauchte endlich das Dorf auf, ragte über die Landschaft wie eine Königin auf dem Thron. Sainte-Valérie, seine Heimat seit fast vier Jahren.
Beim Anblick der mittelalterlichen Mauern wurde ihm warm ums Herz. Doch bevor er durch das Stadttor zur Wache fuhr und seinen Dienst antrat, musste er noch diese schnaufende Karre loswerden.
Vor ihm tauchte ein gelbes Postauto auf der Gegenfahrbahn auf, der Fahrer grüßte fröhlich mit dem Fernlicht, wohl in der Annahme, der alte Carbonne säße hinter dem Lenkrad. Pierre erwiderte den Gruß mit einem Hupen – so wie es der Uhrmacher immer tat –, zog dabei den Kopf ein und rutschte ein wenig tiefer in den Sitz.
Inständig hoffte er, der Fahrer hatte ihn nicht erkannt, es könnte unweigerlich zu Nachfragen führen: was denn der Chef der police municipale während der Dienstzeit im Kastenwagen des alten Witwers machte und welch eigenartiger Einsatz ihn an Sainte-Valérie vorbeiführte. Das alles wäre an sich nicht tragisch, hätte Pierre dem Bürgermeister von seinem Vorhaben erzählt. Arnaud Rozier hasste es, unzureichend informiert zu sein. Und da dessen Standpauken oft eine gewisse Dramatik anhing, galt es, jeglichen aufkommenden Argwohn zu vermeiden.
Pierre trat das Gaspedal durch und umfuhr das Dorf in Richtung seines Bauernhauses. Vielleicht, so dachte er, käme er ja ungeschoren davon.
Als Pierre in die von dunklen Zypressen gesäumte Allee einbog, die zu dem alten Gehöft führte, musste er unwillkürlich lächeln. Jedes Mal wenn er sich seinem neuen Zuhause näherte, das er im vergangenen Jahr gekauft und mit Hilfe der örtlichen Handwerker renoviert hatte, ging ihm das Herz auf.
Nie hätte er gedacht, dass aus dem baufälligen Gebäude einmal etwas derart Beeindruckendes entstehen würde. Die Bruchsteine der Außenmauer waren ausgebessert und mit einem beigefarbenen Kalkputz versehen worden, die ehemals schiefen Fensterläden waren gerichtet und graublau gestrichen. Vor dem Eingang standen Töpfe mit Oleander, dessen Knospen sich langsam öffneten, an der Tür hing ein geflochtener Kranz aus Magnolienzweigen, Efeu und Kirschblüten – ein Geschenk von Charlotte, Chefköchin des Luxushotels Domaine des Grès, deren deutsche Großmutter Floristin war.
Sie eilte ihm schon entgegen, als er die Brücke erreichte, die über den Bach führte.
»Und?«, rief sie, kaum dass er den Wagen auf dem Kies zum Halten gebracht hatte. Die kastanienbraunen Locken hatte sie unter einem Tuch zurückgebunden und trug zur Jeans einen dickmaschigen Pullover. Damit sah sie aus wie geschaffen für die ländliche Umgebung. Wären da nicht die sorgfältig lackierten Nägel, die dieses Bild ein wenig durcheinanderbrachten. »Wie ist es gelaufen?«
»Nicht so laut! Carbonne …«, sagte Pierre, während er aus dem Wagen stieg. Außer Charlotte und seinem Assistenten Luc Chevalier wusste niemand von dem Ausflug nach Avignon, und das sollte auch so bleiben.
»Ach, der ist beschäftigt.«
Sie zeigte hinüber zu dem Alten, der bei der glyzinenumrankten Pergola auf der Gartenbank saß. Gerade zog er ein eingewickeltes Sandwich aus einem Korb und winkte Pierre fröhlich zu, bevor er mit sichtlichem Genuss hineinbiss.
»Er hat so hungrig ausgesehen. Da habe ich rasch eine Kleinigkeit zu essen gemacht«, erklärte Charlotte mit einem Schmunzeln, »pan bagnat.«
Pierre lief das Wasser im Mund zusammen. Am Morgen hatte er außer seinem café noir nichts herunterbekommen. Es käme ihm gerade recht, eines dieser köstlichen Sandwiches zu essen, bevor er zur Arbeit fuhr. »Ist auch eins für mich da?«
»Ja sicher, ich habe gleich ein paar mehr gemacht.«
Pierre beobachtete, wie Carbonne genussvoll die Augen verdrehte, während er sich mit einem einzigen Biss ein Drittel des Sandwiches in den Mund schob und mit vollen Backen kaute. Er sollte sich beeilen, bevor Carbonne das letzte auch noch verzehrte. Pierre liebte Charlottes pans bagnats, mit Olivenöl bestrichene Brötchen, deren Füllung aus saftigen Thunfischfilets und Tomaten, gekochten Eiern, Oliven, Zwiebeln und einer Vinaigrette das Innere durchtränkte.
Und er kannte Carbonne nur allzu gut …
»Ich erzähle dir gleich, wie es war«, sagte er und ging mit großen Schritten in Richtung des Terrassenplatzes.
»Carbonne!«, rief er, als er sah, dass der Alte immer rascher kaute und die Hand noch beim Schlucken wieder im Korb verschwinden ließ, ohne Pierre aus den Augen zu lassen. »Lass noch was für mich übrig.«
Carbonne winkte, als habe er ihn nicht verstanden, während er das nächste Sandwich mit erstaunlicher Geschicklichkeit auswickelte und es sich in den Mund schob.
»Beh?«, war das Einzige, was der Alte herausbekam. Unschuldig lächelnd, höflich, mit einem fragenden Ausdruck im Gesicht. Ein Stück Thunfisch drohte ihm aus dem Mund zu fallen, er griff nach der Serviette, die das Brötchen zusammengehalten hatte, und tat ganz furchtbar beschäftigt.
Dieser Halunke!
Pierre kam vor dem Tisch zum Stehen und spähte in den Korb, in dem nur noch eine einsame Tomate lag. »Du hättest mir ruhig etwas übrig lassen können.«
Carbonne schluckte das halb gekaute Brötchen herunter, nun schien er doch ein schlechtes Gewissen zu haben. Er hielt Pierre den Rest hin, den er zusammendrückte, so dass der Saft seitlich herausquoll und zwischen seinen schmutzigen Fingern entlanglief.
»Lass gut sein«, wehrte Pierre ab und griff stattdessen nach der Tomate, die in alle Richtungen spritzte, als er hineinbiss. Vielleicht war es besser so, dachte er, sein Bauchumfang war in den Wintermonaten in der Tat ein wenig gewachsen. Im Gegensatz zu dem von Didier Carbonne, dessen gähnend leerer Kühlschrank ihm noch vor Augen stand. So wie seiner damals. Aber das war vor Charlotte gewesen.
Pierre betrachtete den alten Mann, der sich die Hände an seinem Hemd abwischte und ihn ansah, als könne er kein Wässerchen trüben. Längst hatte er den alten Uhrmacher ins Herz geschlossen. Die Art, wie er sein karges Witwerdasein meisterte, rührte ihn. Langsam aber wurde selbst ihm die beharrliche Schnorrerei zu viel. So konnte es nicht ewig weitergehen, er musste mit Carbonne reden.
»Hör mal, Didier …«, begann er, als ein lautes Meckern erklang.
Pierre wandte den Kopf in Richtung des neuen Gatters seitlich des Stalls, wo ihn nun zwei Ziegen mit großen, erwartungsvollen Augen anstarrten.
»Sie haben Hunger«, kommentierte Carbonne.
»Da sind sie nicht die Einzigen.«
Pierre verschob die Standpauke auf einen anderen Zeitpunkt und ging hinüber zu Cosima, der weiß-braunen Ziege. Im vergangenen November hatte sie einen fremden Bock angeschleppt, den der Besitzer nur wenig später wieder abholte.
»Du kannst froh sein, dass der weg ist«, hatte Carbonne den Vorfall ungerührt kommentiert, als Pierre sich über den sturen Bauern geärgert hatte, der sein Kaufangebot ausgeschlagen hatte. »Der ganze Hof stinkt erbärmlich, wenn ein Bock erst heimisch wird.« Er hatte die Nase gerümpft und mit der Hand gewedelt, als wolle er einen Schwarm Fliegen verscheuchen. »Der Geruch dringt sogar in die Ziegenmilch, die kannst du dann direkt wegschütten, die schmeckt abscheulich!«
Essbares wegschütten? Wenn Didier Carbonne einen solchen Vorschlag machte, musste es sehr schlimm sein.
Pierre beugte sich über den Zaun und kraulte Cosima zwischen den Hörnern. Die kleine Ziege war schnell wieder fröhlich gewesen. Sie begann sich zu verändern, und erst als ihr dicker Bauch kaum noch zu übersehen war, wusste Pierre, dass es nicht an Charlottes reichlichen Mitbringseln lag: Hafer, Mais und Karotten. Anfang April hatte Cosima ein Zicklein zur Welt gebracht, das mit jedem Tag munterer und ungestümer wurde.
Pierre ging in den Schuppen, holte frisches Heu und legte es durch den Zaun hindurch in den Futtertrog. Er beobachtete, wie Cosima eifrig ein paar Halme hervorzog. Dann hockte er sich auf Höhe des noch immer namenlosen Ziegenmädchens, das sich gegen seine Mutter drängte.
»Na, Kleines«, sagte er leise und strich ihm über den Kopf. »Vielleicht sollten wir dich Marron nennen, wegen deines rotbraunen Fells.«
Das Zicklein schüttelte sich, sprang dann mit kleinen Hüpfern durch das Gehege und drehte sich schließlich so schnell um sich selbst, dass Cosima den Kopf hob und für einen Moment mit dem Kauen innehielt.
»Ich fahre dann mal wieder«, erklang Charlottes Stimme hinter ihm. Sie hatte inzwischen ihr Fahrrad geholt, ihre bunte Korbtasche baumelte am Lenker. »Meine Pläne überarbeiten.«
Sie hatte sich ein paar Tage Urlaub genommen, um sich endlich ihrem ureigenen Wunsch, einem eigenen Restaurant, zu widmen und ihm mehr Kontur zu verleihen. Seit Wochen hatte sie Zahlen hin und her geschoben und mit gewohnter Akkuratesse einen tragfähigen Businessplan erstellt, der selbst Finanzminister Sapin ein breites Lächeln entlockt hätte. Alles, aber auch wirklich alles war durchgeplant. Trotzdem war sie noch immer nicht zufrieden.
»Wenn ich in Sainte-Valérie ein eigenes Restaurant eröffnen möchte, mit regionalen provenzalischen Köstlichkeiten, dann ist das im Grunde genommen nichts Weltbewegendes«, hatte sie ihm gestern beim Abendessen eröffnet und seinen vehementen Widerspruch abgewehrt. »Das ist mein voller Ernst. Es gibt doch schon das Chez Albert, das eine sehr gute Küche hat. Und das Café le Fournil mit seiner hervorragenden Bistrokarte. Ich meine, warum jetzt auch noch ich? Das Dorf braucht doch gar keinen weiteren Anbieter.«
»Sainte-Valérie kann gar nicht genug Gastronomen haben. Und deine Art zu kochen ist etwas ganz Besonderes.« Er hatte ihr über die Wange gestrichen. »Du bist etwas ganz Besonderes. Die Leute werden sich darum reißen, einen Platz in deinem Lokal zu ergattern.«
Sie hatte gelächelt, doch es wirkte gequält. »Das ist es nicht allein. Ich habe alles mehrfach durchgerechnet. Von außen betrachtet, ist es zu machen, trotz der immensen Kosten für Raummiete und Personal, die sicher auf mich zukommen werden. Aber ich habe Angst, dass mir die Vorstellung, die Summe Monat für Monat aufbringen zu müssen, den Schlaf raubt. Was, wenn der Druck so groß wird, dass er mir das Kochen verleidet?« Leise hatte sie hinzugefügt: »Ich glaube, ich bekomme kalte Füße.«
ENDE DER LESEPROBE