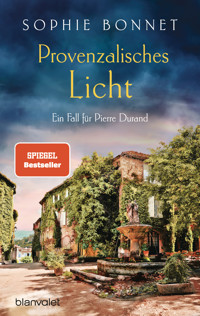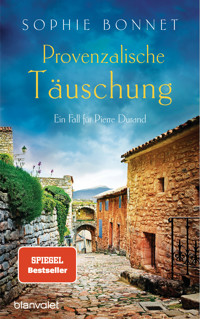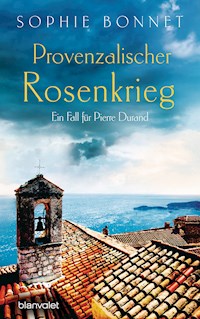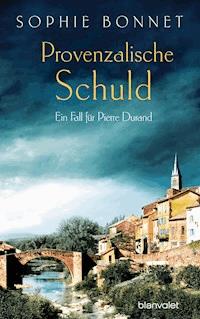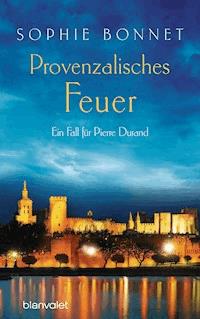
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Pierre-Durand-Krimis
- Sprache: Deutsch
Ein idyllisches Dorf in der Provence. Ein rauschendes Sommerfest. Doch einer der Gäste wird den Morgen nicht erleben.
Juni in der Provence. Im idyllischen Sainte-Valérie feiert man den Sommerbeginn mit einem traditionellen Fest. Noch spät in der Nacht wird im Schein des Feuers gegessen und getanzt – bis mitten im Auftritt der gefeierten Rockband Viva Occitània ein Journalist erstochen wird. Waren ihm seine Recherchen vor Ort zum Verhängnis geworden? Pierre Durands Ermittlungen führen ihn zu aufgebrachten Dorfbewohnern, zu den Hütern einer aussterbenden Sprache – und zu der Sängerin Aurelie Azéma, die sich für die Unabhängigkeit Okzitaniens einsetzt. Während Pierre in die Mythen der alten Provence eintaucht, ahnt er nicht, dass seine Schritte längst beobachtet werden. Und dass der Tod des Journalisten erst der Anfang war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Juni in der Provence. Im idyllischen Sainte-Valérie feiert man den Sommerbeginn mit einem traditionellen Fest. Noch spät in der Nacht wird im Schein des Feuers gegessen und getanzt – bis mitten im Auftritt der gefeierten Rockband Viva Occitània! ein Journalist erstochen wird. Waren ihm seine Recherchen vor Ort zum Verhängnis geworden? Pierre Durands Ermittlungen führen ihn zu aufgebrachten Dorfbewohnern, zu den Hütern einer aussterbenden Sprache – und zu der Sängerin Aurelie Azéma, die sich für die Unabhängigkeit Okzitaniens einsetzt. Während Pierre in die Mythen der alten Provence eintaucht, ahnt er nicht, dass seine Schritte längst beobachtet werden. Und dass der Tod des Journalisten erst der Anfang war.
Autorin
Sophie Bonnet ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin. Mit ihrem Frankreich-Krimi Provenzalische Verwicklungen begann sie eine Reihe, in die sie sowohl ihre Liebe zur Provence als auch ihre Leidenschaft für die französische Küche einbezieht. Mit Erfolg: Der Roman begeisterte Leser wie Presse auf Anhieb und stand monatelang auf der Bestsellerliste, ebenso wie die beiden darauf folgenden Romane Provenzalische Geheimnisse und Provenzalische Intrige. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Hamburg.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Sophie Bonnet
Provenzalisches Feuer
Ein Fall für Pierre Durand
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Troni und Susann Rehlein
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: Getty Images/Lonely Planet Images/Karl Blackwell
Illustration Karte: www.buerosued.de
AF · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-19810-7V008www.blanvalet.de
Karte
Prolog
Es ging ihm gut. Besser denn je. Die Farbenpracht, die ihn umgab, war berauschend, und er drehte sich langsam, um all das, was sich seinem Auge bot, in sich aufzunehmen. Die untergehende Sonne, die ihre letzten Strahlen über die fernen Bergkämme der Monts de Vaucluse schickte, war glühender als sonst. Auch das Tiefblau des Himmels, so schien ihm, war heute intensiver, besaß dort, wo sich die Nacht bereits über das Tal senkte, den violetten Schimmer reifer Johannisbeeren.
Und die Luft erst, diese warme, weiche Sommerluft …
Ergriffen trat er an das Balkongeländer, das Weinglas in der Hand. Ein exzellenter Corbière aus der Nähe von Carcassonne, den er heute, an diesem besonderen Tag, mit ausnehmendem Genuss trank.
Normalerweise bevorzugte er einfache Landweine, die trotz des niedrigen Preises inzwischen eine beachtliche Qualität erreicht hatten. Denn obwohl er dank einer Laune des Schicksals über ein gut gefülltes Bankkonto verfügte, hatte er niemals vergessen, aus welchen Verhältnissen er stammte. Und welche Entbehrungen es ihn gekostet hatte, dorthin zu kommen, wo er jetzt war.
Heute machte er eine Ausnahme. Dieser Wein, den er nun langsam im Glas schwenkte, war ein Geschenk gewesen. Eine Geste, die ihn tief anrührte. Es war der Beginn einer neuen Zeitrechnung.
Eine Weile lauschte er der Musik, die aus dem Haus drang. Dem Rhythmus der Tamburine, die einen mehrstimmigen Chor untermalten, der von der Schönheit Okzitaniens sang. Eines der anrührendsten Lieder, wie er fand, es drückte so viel mehr aus als all die anderen.
»Dera mar verda ará mar blùa«, stimmte er ein. »Vom grünen bis zum blauen Meer.«
Lächelnd hob er das Glas gegen die untergehende Sonne und betrachtete das Funkeln im Schwarzrot des Weines.
Alles war so, wie es sein sollte, dachte er und hob das Glas vor seine Nase. Beinahe perfekt.
Eine betörende Duftigkeit strömte ihm entgegen, der Geruch nach Schwarzkirschen und Holunder, verwoben mit einem Anklang von Mocca und Vanille. Dazu eine ungewöhnliche Komponente, die er nicht einordnen konnte.
Noch einmal atmete er das Bouquet ein. Es war grandios. Nein, exorbitant. Buchstäblich. Und endlich wusste er, woran es ihn erinnerte: an den Geschmack von Lakritze. An eine gesalzene Bitterschokoladenpraline. Oder an den herbsüßen Kuss einer Meerjungfrau.
Er gluckste und unterdrückte ein Kichern.
Wenn er all das, was er gerade empfand, in einem seiner Bücher schriebe, würden sich die Kritiker schütteln angesichts der hemmungslosen Wortwahl. Jetzt, in diesem Moment, bestanden seine emotionalen, visuellen und olfaktorischen Eindrücke fast ausschließlich aus einer Aneinanderreihung von Adjektiven: außergewöhnlich, lustvoll, strahlend, intensiv, berauschend.
Andächtig führte er das Glas an die Lippen und nippte am Wein, bewegte ihn mit der Zunge, bis sich die Aromen einer Explosion gleich an seinem Gaumen ausbreiteten und von dort direkt in seinen Verstand.
Was für ein Wein!
Ein Seufzen entwich ihm, dann ließ er den Tränen freien Lauf, bis er endlich hemmungslos weinte.
Mit einem Mal waren alle Querelen vergessen, all der Streit, all die zornigen Stimmen, die auf ihn eingeschrien hatten. Mit einer Wut, an der er, das musste er sich eingestehen, nicht ganz unschuldig gewesen war. Die offene Aggression jedoch, in die sie gipfelte, hatte ihn überrascht. Er hatte sich für unantastbar gehalten, über den Dingen stehend, stattdessen hatte er erkennen müssen, dass er verletzbar war.
Ein weiterer Schluck glitt seine Kehle hinab. Etwas Wein ging daneben, perlte an seinem Mundwinkel herab, beiläufig wischte er ihn fort.
»Vorbei«, flüsterte er. All das war nun Vergangenheit. Der erste Schritt war getan, bald schon würden die anderen folgen.
Der Gedanke an eine Aussöhnung war tröstlich. Er wollte ihn festhalten, doch er entwich seinem Gehirn, segelte fort wie eine bunte Seifenblase. Dafür nahm er nun umso mehr die Musik wahr, deren Lautstärke anzuschwellen schien. Er konnte jeden einzelnen Ton des Akkordeons fliegen sehen, jetzt kam wieder das Tamburin hinzu, wurde immer schneller, wirbelte mit dem Gesang im Kreis.
»Verdammt, was geht hier vor?«
Die Worte rissen wie Fetzen von seinen Lippen.
Ein heftiger Schwindel erfasste ihn. Mit der freien Hand griff er nach dem Balkongeländer und blinzelte gegen das grell-orange Licht des absteigenden Sonnenballs, das sich in Wellen auf ihn zubewegte. War der Boden immer schon so nah gewesen?
Irgendetwas stimmte nicht mit seinen Augen. Nein, mit seinem Verstand. Die Erde schien ihm entgegenzukommen. Und seine Finger … Sie sahen seltsam fremd aus, überdimensioniert, als gehörten sie nicht zu seinem Körper.
Unwillkürlich riss er sie in die Höhe. Wie in Trance sah er dem fallenden Glas nach, bis es auf den Fliesen zerschellte und der Wein über den Boden spritzte wie frisches Blut.
Eine plötzliche Ahnung stieg in ihm auf. Der Corbière war kein Geschenk der Versöhnung gewesen, sondern eine Abrechnung.
Er wollte um Hilfe schreien, doch seine Lippen bewegten sich nicht. Sie waren taub, er konnte sie ebenso wenig spüren wie seine Füße.
Du darfst jetzt keine falsche Bewegung machen!
Langsam sank er auf die Knie. Tastete nach der Hauswand in seinem Rücken. Versuchte, das zunehmende Gefühl drohender Ohnmacht abzuschütteln. Es war zwecklos. Wie von außen beobachtete er, dass sich sein Bewusstsein in einen dunklen Tunnel zurückzog, bis alles leer war. Und still. So furchtbar still.
Vier Jahre später
1
»Was ist denn hier passiert?«
Ungläubig schüttelte Pierre den Kopf und trat ein.
Eine wohltuende Kälte hing in den alten Gemäuern und legte sich auf die sonnenerhitzte Haut. Der Geruch frischer Farbe erfüllte die Luft.
»Da staunst du, was?« Arnaud Rozier grinste breit.
»Allerdings.«
Als der Bürgermeister die letzte Besprechung vor den Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende – den Feux de la Saint-Jean – nicht in der mairie ansetzte, sondern in der ehemaligen Burgruine, hatte Pierre sich schon gedacht, dass er ihm zeigen wollte, wie sehr die Renovierungsarbeiten im künftigen Museum für provenzalische Kunstgeschichte vorangeschritten waren. Bereits gestern war das Gerüst, das seit Monaten vor den Mauern gestanden hatte, wie von Zauberhand verschwunden, nur noch ein einsames Schild im Rasen zeugte von der Anwesenheit des Bauunternehmens aus Apt. Ja, Pierre hatte damit gerechnet, dass es etwas zu bestaunen gab. Aber das, was er nun sah, verschlug ihm doch die Sprache.
Sämtliche Lücken im Gemäuer waren ausgebessert worden, die Risse im Boden geglättet. Einige der Fensterrahmen waren bereits gestrichen und glänzten in dunklem Rot.
Neugierig folgte er dem Bürgermeister durch die Räume und stieß einen leisen Pfiff aus.
Im westlichen Teil, wo ein Absperrgitter die fehlende Wand ergänzt hatte, stand eine neue Natursteinmauer, die sich so gut anpasste, als wäre sie schon immer dort gewesen. Und an der Stirnseite des östlichen Saals befand sich eine kunstfertig gestaltete Flügeltür aus Holz, die ihm bei der letzten Besichtigung im Oktober gar nicht aufgefallen war. Was daran liegen mochte, dass es dunkel gewesen war. Und dass Charlotte ihn begleitet hatte.
Bei dem Gedanken an den heimlichen Ausflug auf die Plattform musste er schmunzeln. Ganz oben, hinter den Zinnen, hatten sie über das Dorf hinaus auf den nächtlichen Luberon gesehen und waren sich sehr nahe gekommen. Bis die neugierige Madame Duprais sie mit dem Strahl einer riesigen Taschenlampe aufgeschreckt hatte. Seit jenem Tag waren Charlotte und er fest zusammen. Und noch heute, acht Monate später, weitete sich sein Herz, wenn er an sie dachte.
Pierre machte eine Kopfbewegung in Richtung des Saals. »Liegt hinter der Tür nicht das Ölmuseum?«
»Genau so ist es«, erklärte Rozier, und seine Stimme hallte. »Wir wollen die Bereiche zusammenlegen, als Teil eines neuen Gesamtkonzeptes, bei dem alle Räume miteinander verbunden sind. Was noch fehlt, ist ein zentraler Einlass. Und die sanitären Anlagen sind noch nicht fertig. Der Rest ist reine Kosmetik. Die ersten Exponate sind bereits eingetroffen, und in fünf Wochen wird das Museum eröffnet. Am ersten August, wie geplant.« Rozier setzte ein Gesicht auf, als hätte er die Burg eigenhändig renoviert.
»Eine echte Punktlandung!«, entfuhr es Pierre, der eine solche Schnelligkeit bei hiesigen Bauprojekten noch nie erlebt hatte. »Seit wann kannst du zaubern?«
»Ich weiß eben, wie man Handwerker zu Höchstleistung motiviert.«
»Handwerker und Höchstleistung sind zwei Dinge, die sich in der Provence eigentlich ausschließen.«
»Nicht, wenn man eine gute Menschenkenntnis besitzt – und eine gehörige Portion Einfühlungsvermögen«, erwiderte der Bürgermeister.
Dabei zwinkerte er verschwörerisch, und Pierre verkniff sich die Bemerkung, dass Rozier und Einfühlungsvermögen sich ebenfalls ausschlossen.
Auch wenn sich sein Verhältnis zum Bürgermeister merklich entspannt hatte, seit der seinen Forderungen nach einer besseren Ausstattung der Polizei und Anhebung der Gehälter nachgekommen war, so war dieses Entgegenkommen eher Ausnahme als die Regel. Rozier hatte sich bei der Anschaffung von Schusswaffen, Schutzwesten und Funkgeräten lediglich dem Druck des Präfekten gebeugt, der Pierre in seinem Anliegen unterstützt hatte, und handelte trotz einer zur Schau gestellten Zugewandtheit vor allem zweckorientiert. Was zur Folge hatte, dass jeglicher Ausbruch von Freundlichkeit bei Pierre Misstrauen auslöste.
Wahrscheinlich hatte der Bürgermeister die Arbeiter eher durch Bestechung, Druck oder Drohungen motivieren können als mit aufmunternden Worten – gegen die die meisten Handwerker, die Pierre kannte, ohnehin immun waren. Seit er selbst im vergangenen Herbst ein renovierungsbedürftiges Bauernhaus erstanden hatte, konnte er ein Lied davon singen. Ohne die Hilfe der Dorfbewohner wären die Arbeiten nicht fertig geworden.
»Gratuliere«, sagte Pierre beeindruckt und klopfte Rozier auf die Schulter.
Was auch immer der Grund für diesen erstaunlichen Baufortschritt war, sie alle hatten ihre Wette verloren. Die Männer der eingeschworenen Gemeinschaft von Sainte-Valérie hatten nicht unbeträchtliche Summen darauf gesetzt, dass das Museum für provenzalische Kunstgeschichte mit einer Verzögerung von mehreren Monaten fertig werden würde. Pierres Assistent Luc Chevallier war hier noch einer der Optimistischeren gewesen und hatte als Einziger an eine Fertigstellung bis zum Ende des Jahres geglaubt.
Und nun war die Eröffnung bereits am ersten August!
»Das ist noch nicht alles!«, sagte Rozier mit der Zufriedenheit eines Mannes, der sich geradewegs über die Gesetze der Schwerkraft erhob. »Unsere neue Kuratorin, Marianne Levy, war derart begeistert von den historischen Kulturgütern und Schriften in unserem Stadtarchiv, dass sie mir eine Erweiterung empfahl, die ich nicht ausschlagen konnte: Wir werden das Augenmerk nun nicht nur auf die bildende Kunst setzen, sondern auch auf die heimische Kulturgeschichte. Der gesamte erste Stock ist dieser Thematik gewidmet, inklusive wechselnder Ausstellungen, die sämtliche Aspekte unserer Historie beleuchten sollen. Mit dem neu erschaffenen Museum für provenzalische Kunst- und Kulturgeschichte Sainte-Valérie katapultieren wir unsere Burg unmittelbar auf eine Stufe mit denen in Les Baux, Gordes und Tarascon. Ach, was rede ich, wir werden sie überflügeln!«
Nun lachte er und strahlte wie ein Kind vor dem Weihnachtsbaum.
Pierre überging das demonstrative Heischen nach Beifall. »Der erste Stock ist ebenfalls fertig?«, fragte er.
»Nicht ganz. Die Räume dort werden wir in Etappen renovieren, je nach Finanzlage. Aber der Kaminsaal war noch so gut erhalten, dass wir im Gemeinderat beschlossen haben, ihn von Anfang an einzubeziehen. Und genau darum sind wir hier. Die Flamme vom Berg Canigou, die unsere Lichtträger morgen Mittag nach Sainte-Valérie bringen, soll dort entzündet werden. Im Raum für okzitanische Kulturgeschichte, mit der wir die Präsentation unseres historischen Vermächtnisses eröffnen wollen.«
»Da oben?« Irritiert folgte Pierre dem Bürgermeister zum Fuß der Wendeltreppe und spähte hinauf. Die Stufen waren noch immer ausgetreten und rutschig, der Aufgang war schmal. »Warum machen wir das nicht vor dem Eingang der Église Saint-Michel? Wie im Vorjahr.«
»Weil ich es mir anders überlegt habe. Was gibt es Symbolträchtigeres, als das länderüberspannende Feuer der Freundschaft und der Zusammengehörigkeit im Raum der okzitanischen Kultur zu entzünden? Madame Levy war ganz begeistert von der Idee und hat bereits damit begonnen, den Raum entsprechend auszustatten.«
»Und was sagt der Pfarrer dazu?«
»Der hat mit der Segnung und Verteilung der Brotstücke schon genug Aufmerksamkeit. Nur zu, sieh es dir an. Du wirst gar nicht anders können, als mir zuzustimmen.« Rozier warf ihm einen aufmunternden Blick zu und schob sich an Pierre vorbei.
Angespannt folgte Pierre ihm die Treppe hinauf, den Blick auf die Stufen geheftet. Sie waren kurz, nichts für große Füße, vor allem nicht im Gedränge, das hier unweigerlich entstehen würde. Allein der Gedanke an die in Feierlaune befindlichen Dorfbewohner und Trachtengruppen, die hinter dem Flammenträger die schmale Stiege hinaufeilen würden – samt dem Rattenschwanz an Touristen und Fotografen –, ließ Pierre daran zweifeln, dass Rozier noch bei Verstand war. Er mochte sich gar nicht ausmalen, was alles passieren konnte, wenn jeder von ihnen mit einer eigenen Fackel dieses Nadelöhr wieder hinabdrängte, um den Reisighaufen zu entzünden.
Nein, das war nicht zu verantworten!
Die Sicherheit der Menschen ging vor. Wenn etwas passierte, würde man ihn dafür haftbar machen. Da wäre der Bürgermeister einer der Ersten.
Kopfschüttelnd erklomm er die letzte Stufe zur ersten Etage. Was ihn dort erwartete, war, das musste er widerwillig zugeben, in der Tat beeindruckend.
Der große Saal war über und über mit Fahnen geschmückt, den rot-gelb gestreiften der urtümlichen Provence im Wechsel mit denen Okzitaniens, dem gelben Tolosanerkreuz auf rotem Grund. Über dem reich verzierten Kamin, der beinahe die gesamte Wandfläche einnahm, hing ein historischer Teppich mit dem Dorfwappen von Sainte-Valérie.
Pierre musste gestehen, dass er noch nie so genau hingesehen hatte, obwohl die Fahne des Dorfs neben der französischen und der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur über dem Eingang der mairie wehte. In dieser Größe aber war das Wappen derart beeindruckend, dass er einen plötzlichen Stolz für seine neue Heimat empfand. Links war der Burgturm eingewebt, gelb auf rotem Grund, und rechts eine weiße Ziege, die sich vor provenzalischem bleu auf die Hinterbeine stellte.
»Und hier«, sagte Rozier und trat zu einem Podest, auf dem eine altmodische Gaslampe thronte, »werden wir die heilige Flamme verwahren, die unsere Gesandten morgen Mittag in Arles entgegennehmen. Nun, was sagst du? Einen besseren Rahmen kann man sich kaum vorstellen, nicht wahr?«
Wie er so dastand, inmitten der Szenerie, und die Arme weit ausstreckte, als sei er der König dieser Burg, schwante Pierre, warum Rozier hier in diesem Raum die Zeremonie abhalten wollte. Auf Fotos würde sich das ganze symbolträchtige Tamtam sicher gut machen. So gut, dass Pierre sich fragte, ob der Bürgermeister bereits auf die nächsten Wahlen schielte, die zu Beginn des kommenden Jahres über eine neue Amtszeit entscheiden sollten.
Unwillig schüttelte Pierre den Kopf. »Das wird nicht funktionieren.«
»Ich habe dich nicht um deine Zustimmung gebeten!« Roziers Stimme war schneidend. »Als Chef de police municipale stehst du unter meiner Führung. Wenn ich etwas anordne, dann hast du dich dem zu beugen.«
»Nicht, wenn ich damit gegen die Vorschriften verstoßen muss.«
»Wovon zum Teufel redest du? Es ist doch nur eine Frage der Organisation. Man kann die Leute, die ihre Fackeln entzündet haben, ja auch einzeln die Treppe wieder hinunterlassen, da passiert nichts.«
»Mehrere hundert? Dann sind wir noch am Sankt Nimmerleinstag zugange.« Pierre verschränkte die Arme. »Nicht mit mir.«
Der Bürgermeister zog die Brauen zusammen und wollte wohl gerade zu einer scharfen Erwiderung ansetzen, als ein Ruck durch seinen Körper ging und sein Mund sich zu einem engelsgleichen Lächeln verzog.
»In Ordnung, Pierre«, begann er sanft. »Ich kann das verstehen. Wahrscheinlich hast du jetzt ein ganz furchtbares Bild im Kopf, und das ist auch richtig so. Denn du bist für die Sicherheit im Dorf zuständig, gerade bei solchen Veranstaltungen. Da lastet eine Menge Druck auf deinen Schultern, nicht wahr?«
»Allerdings«, bestätigte Pierre und runzelte die Stirn. Was war denn mit dem los?
»Es bleibt natürlich dir überlassen, ob du es dir zutraust, das zu regeln«, fuhr Rozier fort. »Aber bevor du dich vorschnell festlegst, möchte ich dich an eine ähnliche Situation erinnern, die wir alljährlich wie selbstverständlich und ohne jede Komplikation meistern. Denk nur an all die Messen, an denen der Pfarrer den Kinderchor mit den Kerzen in der Hand einziehen lässt. Glaubst du, da sind dann mehr Flammenträger im Gang unterwegs als bei unserem Fackelzug oder weniger?«
»Soll das eine Frage sein?«
»Ja. Na, los. Was schätzt du?«
Irritiert sah Pierre den Bürgermeister an, zuckte dann aber die Schultern. Er war zwar kein Kirchgänger, aber die Antwort war denkbar einfach.
»Bei den Feux de la Saint-Jean sind es weit mehr. Nicht nur, dass die gesamte Dorfgemeinschaft daran teilnimmt, es kommen ja auch noch Besucher von außerhalb.«
»Und wie viele von denen tragen eine Fackel?«
Da musste Pierre genauer nachdenken. Im vergangenen Jahr waren es vor allem die Mitglieder des Kulturvereins und ein paar Jugendliche gewesen. »Rund dreißig Personen.«
»Es sind weniger, Pierre, ich habe mir die Bilder dazu angesehen. Es waren vielleicht zehn, fünfzehn Leute, die eine Fackel mitbrachten. Damit dürften es weit weniger sein als die Chorkinder, die an Festtagen mit Kerzen einziehen.« Rozier lächelte gütig. »Hast du jemals von einem Feuer gehört, das während der heiligen Messe ausgebrochen ist?«
»Nein, aber der Mittelgang der Kirche ist auch breiter.«
»Dafür gehen die Kinder paarweise durch die Reihen. Durch dicht besetzte, wohlgemerkt, vor allem an Weihnachten. Glaubst du, der Pfarrer würde so etwas zulassen, wenn es irgendwelche Sicherheitsbedenken gäbe?« Der Bürgermeister hob eine Braue, ohne das Lächeln zu vermindern. »Gerade bei Kindern!«
»Wahrscheinlich nicht.« Pierre seufzte. Rozier hatte sein Bild mit einem simplen Vergleich ins Wanken gebracht, und das ärgerte ihn. Noch schlimmer allerdings war es, wie ein Hasenfuß dazustehen, der in puncto Vorsicht noch den Pfarrer zu überflügeln drohte.
»Wenn es wirklich höchstens fünfzehn Personen sind«, überlegte er laut, »wäre das tatsächlich machbar. Man würde nach der Zeremonie die normalen Zuschauer zuerst wieder hinauslassen, damit sie auf dem Burgplatz ein Spalier bilden. Wenn man dann die Fackelträger einzeln hinunterschickt, müsste es den Sicherheitsstandards genügen.«
»Eine gute Entscheidung, Pierre. Ich wusste doch, dass du ein kluger Mann bist.« Rozier trat näher und nahm ihn bei den Schultern. »Der beste, den ich habe.«
Er sagte es mit einer Theatralik, die Pierre einen Schritt zurücktreten ließ, so dass der Bürgermeister seine Hände – nach einem bestärkenden Nicken – wieder fortnahm und einen Schlüssel aus der Jackentasche kramte.
»Hier«, sagte er, »am besten, du sperrst die anderen Räume mit einem Polizeiband ab, damit die Leute nicht auf falsche Gedanken kommen. Nicht, dass wir das Ganze noch einmal renovieren müssen, was?« Er lachte. »Und nun an die Arbeit. Meine Rede ist noch nicht einmal zur Hälfte fertig.«
Pierre nahm den Schlüssel entgegen und nickte matt. Auch wenn er das Zugeständnis freiwillig gemacht hatte, fühlte er sich komplett überrumpelt. Und das war etwas, das er überhaupt nicht mochte.
Bevor er noch etwas erwidern konnte, knackte es in seinem Funkgerät. Pierre hob es auf Höhe seines Gesichts und drückte den Sprechknopf.
»Ja?«
»Wo steckst du denn?«, hallte es blechern durch den Raum. »Geht dir der Alte etwa wieder auf den Sack?« Es folgte ein jungenhaftes Kichern. »Kommst du zum Platz bei der Bühne? Du wirst hier gebraucht.«
Es war Luc Chevallier, sein Assistent. Pierre stieß einen Stoßseufzer aus.
»Bin schon auf dem Weg«, sagte er und nickte Rozier, dessen Gesichtsfarbe gerade ins Dunkelrot wechselte, achselzuckend zu. Dann eilte Pierre an ihm vorbei und die Treppe hinunter zum Ausgang. Er musste Luc unbedingt noch einmal darauf aufmerksam machen, dass bei Funkgeräten – im Gegensatz zum Mobiltelefon – jeder mithören konnte. Auch der Bürgermeister.
2
Er fand seinen Assistenten an der Ladeluke eines gewaltigen Transporters, von dem Pierre sich fragte, wie er durch die engen Gassen hatte gelangen können. Normalerweise war der Bereich um die Place du Village für Autos gesperrt, nur in den frühen Morgenstunden legte man die Poller um, damit die ansässigen Geschäfte beliefert werden konnten. Auch für die Marktbestücker mit ihren großen Anhängern öffnete man den Platz, aber dafür gab es die Zufahrt beim Bürgermeisteramt, die als einzige breit genug war.
Im Gegensatz zu dieser hier.
Mit eingezogenem Bauch kämpfte Pierre sich durch den engen Spalt zwischen Wagen und Mauer und stieß einen Fluch aus, als er auf dem Dach des Transporters Reste einer Wäscheleine samt Baumwollschlüpfern sah.
»Bist du denn von allen guten Geistern verlassen?«, rief er Luc entgegen. »Das Ding hier versperrt die gesamte Gasse! Da kommt ja kein Mensch mehr durch.«
Sein Assistent, der gerade einige Metallstangen entgegennahm, hielt inne. »Was?« Er blickte um sich und runzelte erstaunt die Stirn, als hätte er sich darüber noch keine Gedanken gemacht. Dann zuckte er die Schultern. »Warte, bin gleich wieder da.«
Wankend ging er mit seiner Last in Richtung des Platzes, auf dem die Bühne aufgebaut werden sollte, und legte sie neben dort bereits aufgetürmte Metallkisten.
»Der ist gleich weg, Chef«, sagte er, als er zurück war, und wischte sich mit dem Handrücken über das schweißnasse Gesicht. »Wenn alle mit anpacken, geht das ganz schnell.«
»Warum hast du dem Fahrer nicht die übliche Zufahrt zugewiesen?«
»Ich habe den Schlüssel für den Poller in der Wache vergessen.«
»Und warum hast du ihn nicht rasch geholt? Der Wagen hat eine Wäscheleine samt Anhang mitgerissen.«
»Oh.« Luc trat einen Schritt zurück und begutachtete das Malheur mit zusammengekniffenen Augen. »Die sind von Madame Germain. Ich bringe sie ihr nachher zurück.«
Woher Luc wusste, wie die Unterhosen der Frau des Poststellenleiters aussahen, wollte Pierre lieber nicht ergründen. Also atmete er tief durch und blies mit dicken Backen die Luft aus. »Na schön, warum hast du mich gerufen?«
»Dein Typ wird verlangt.« Er wandte sich in Richtung des Platzes. »Hallo«, rief er winkend, »kommen Sie? Mein Chef ist da.«
Eine junge Frau, die auf dem Brunnenrand gesessen hatte, erhob sich und kam auf sie zu. Sie trug Jeans und T-Shirt, war nicht groß, aber sehr schlank und hatte einen geschmeidigen Gang, der ihr dunkles hüftlanges Haar bei jedem Schritt sanft bewegte.
»Sie möchten mich sprechen?«, fragte sie. »Ich bin Aurelie Azéma.«
»Sehr erfreut, Pierre Durand.« Er hatte sie erkannt, noch bevor sie sich vorstellte. Das Gesicht der Sängerin, die beim morgigen Konzert der Band Viva Occitània! einen Gastauftritt haben sollte, prangte auf den Plakaten, die seit Wochen an Mauern und Einfahrten klebten. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Mir? Ich dachte …« Sie sah Luc fragend an. »Sie haben mich doch gerade zu sich gewunken?«
»Ähm.« Luc grinste dümmlich. Dabei wurde er rot bis an die Haarwurzeln. »Es tut mir leid, da ist mir wohl mein Blick …« Er sah wieder in Richtung des Brunnens. »Eigentlich meinte ich den Herrn da.«
Er lächelte noch einmal entschuldigend und wartete, bis sich die Sängerin schulterzuckend entfernte, dann zeigte er auf einen Mann mit Strohhut, der sich inzwischen genähert hatte.
»Das ist Maxim Sachet, er ist Journalist.«
Sachet trug eine hochgekrempelte Hose und ein weißes Hemd, das am Bauch spannte. Er mochte Anfang sechzig sein, vielleicht war er auch jünger. Das Gesicht zeigte deutliche Spuren eines Lebens, das ganz auf Genuss ausgerichtet war; mit rotgeäderten Wangen und einem üppigen Doppelkinn.
»Wie schön, ich habe Sie schon überall gesucht«, sagte er mit sonorer Stimme und streckte Pierre seine Hand entgegen. »Ich habe ein paar Fragen zum Fall …« Er stockte. »Sie sehen anders aus, als ich Sie mir vorgestellt habe. Waren Sie denn vor vier Jahren auch schon Leiter der hiesigen police municipale?«
»Ja. Das heißt, mein Dienst begann im September. Der Mann, der vor mir Chef de police war, hieß Gilbert Fortin.«
»Wissen Sie, wo ich ihn finden kann?«
»Er ist im Ruhestand. Soweit ich weiß, ist er damals auf die andere Seite des Tals gezogen. Nach Ménerbes.«
»Lebt er da noch?«
»Ich denke schon. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört.«
Sachet rieb sich das Kinn. »Das ist seltsam. Finden Sie nicht auch?«
»Was soll daran seltsam sein?«
»Normalerweise pflegen die Bewohner dieses Landstriches doch lebenslange Freundschaften. Vor allem zu jemandem, der wichtiger Teil der Gemeinschaft gewesen sein soll.«
»Es ist nicht mehr alles so wie früher«, entgegnete Pierre. »Die Leute werden mobiler, selbst die Alten.«
Insgeheim jedoch musste er sich eingestehen, dass der Mann Recht hatte. Die Stelle als Chef de police war völlig unverhofft frei geworden, angeblich aus gesundheitlicher Notwendigkeit, daher hatte er sich nichts dabei gedacht, dass die Einweisung nicht durch seinen Vorgänger erfolgt war. Doch nun fiel ihm auf, dass Fortin, der ihm zu Beginn von so manchem Bewohner von Sainte-Valérie als Tausendsassa präsentiert worden war, als unerschütterlicher Held im Dienste des Dorfes, darüber hinaus keinerlei Erwähnung mehr fand.
Sachet hatte währenddessen damit begonnen, auf seinem Smartphone herumzutippen. Jetzt schüttelte er den Kopf. »Nichts. Kein einziger Eintrag zum Namen Fortin in Ménerbes. Können Sie seine Adresse für mich herausfinden? Es wäre wirklich sehr wichtig.«
»Ich denke schon …« Pierre zögerte. »Was wollen Sie denn von ihm wissen?«
»Pressegeheimnis«, erwiderte Sachet schmunzelnd. »Ich würde es Ihnen wirklich gerne sagen, aber ich will hier keine falschen Gerüchte in die Welt setzen.« Dann sah er wohl ein, dass er so nichts erreichen würde, und nahm Pierre beiseite, bis sie außer Hörweite waren. »Ich bin da an einer Sache dran, die höchst explosiv werden könnte. Ihr Vorgänger hatte, soweit ich weiß, einen guten Einblick. Ich benötige seine Einschätzung.«
»Na schön, ich werde sehen, was sich machen lässt. Wo kann ich Sie erreichen?«
»Ich habe ein Zimmer in der Auberge Signoret. Wenn Sie mich nicht antreffen, hinterlassen Sie einfach eine Nachricht am Empfang.«
Maxim Sachet hatte ihn neugierig gemacht. Nicht nur, dass er wissen wollte, wie es dem alten Fortin, den er selbst nie kennengelernt hatte, in der Zwischenzeit ergangen war, sondern auch, weil die Andeutung des Journalisten so geheimnisvoll gewesen war. Etwas Explosives wollte er recherchieren, was er damit wohl gemeint hatte?
Also ging Pierre direkt in die Wache, um in den Adressdateien nach Fortins Wohnort zu schauen.
Als er die Tür aufsperrte, empfing ihn das leise Summen der mobilen Klimaanlage, die vor wenigen Tagen hier Einzug gehalten hatte. Seitdem war die Hitze, die das Arbeiten in den Sommermonaten nahezu unmöglich gemacht hatte, einer angenehmen Raumtemperatur gewichen.
Pierre drehte das Abwesenheitsschild an der Fenstertür um und ging direkt in sein Büro, fuhr den Computer hoch und durchforstete die Kontaktdaten. Nichts. Weder im digitalen Adressbuch noch im hölzernen Karteikasten, den sein Vorgänger ihm hinterlassen hatte.
Nach einer Weile musste er einsehen, dass es verschwendete Zeit war, er würde besser Gisèle anrufen. Die betagte Empfangsdame des Bürgermeisteramtes war bestens sortiert. Außerdem hatte sie Einblick in sämtliche Akten der Verwaltung.
»Monsieur Durand«, flötete sie mit einer Begeisterung durch die Leitung, als hätten sie sich nicht gerade gestern gesehen. »Wie geht es Ihnen?«
Seit einem knappen Jahr hatte sich Gisèles sprödes Wesen, mit dem sie anderen Menschen im Allgemeinen begegnete, ihm gegenüber in eine Art mütterlicher Fürsorge verwandelt. Woran es gelegen hatte, konnte Pierre nicht sagen. Es war ganz plötzlich geschehen, von heute auf morgen. Abgesehen davon, dass es Gisèle erstaunlich sympathisch machte, erleichterte es auch die Zusammenarbeit.
»Danke, bestens«, antwortete Pierre und kam gleich zur Sache. »Haben Sie die Telefonnummer von Gilbert Fortin? Ein Journalist hat sich nach ihm erkundigt, und ich möchte gerne vorfühlen, ob es Fortin überhaupt recht ist, dass ich sie weiterleite.«
»Was will er denn?«
»Das hat er nicht gesagt. Aber es geht wohl um etwas, das vor vier Jahren vorgefallen ist.«
»Ach …«, sagte sie nur. Und dann, mit ironischem Unterton: »Na, da wird sich Gilbert aber freuen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, es hat hier eine Menge Aufregung gegeben, aber das soll er Ihnen lieber selbst erzählen. Ich mische mich da nicht noch einmal ein. Warten Sie, ich schaue mal nach …«
Pierre hörte das Aufziehen und Zuschlagen von Schubladen, dann das Rascheln von Papier.
»Ich habe die Telefonnummer gefunden«, sagte Gisèle endlich. »Aber ich weiß nicht, ob sie noch aktuell ist. Brauchen Sie auch die Adresse?«
Pierre ließ sich beides geben und legte auf.
Nachdenklich betrachtete er das Notierte. So schnell hatte Gisèle noch nie ein Gespräch beendet. Was meinte sie damit, dass es eine Menge Aufregung gegeben hätte? Pierres Neugier wuchs. Kurzerhand rief er die Nummer an und ließ es ausdauernd klingeln. Gerade wollte er auflegen, als doch jemand ranging.
»Oui?« Die Stimme klang müde.
»Monsieur Gilbert Fortin? Ich hoffe, ich störe nicht.«
»Wer spricht denn da?«
»Mein Name ist Pierre Durand, Chef de police municipale von Sainte-Valérie. Ich bin Ihr Nachfolger.«
»Ah. Hab schon von Ihnen gehört.«
»Ich hoffe, nur Gutes.«
Es hatte ein Scherz sein sollen, um das Gespräch ein wenig aufzulockern, aber es misslang kläglich. Am anderen Ende der Leitung war nur ein Grunzen zu hören.
»Monsieur«, fuhr Pierre unbeirrt fort, »ich wollte nur wissen, ob es Ihnen recht ist, wenn ich Ihre Telefonnummer an einen Journalisten weitergebe. Er heißt Maxim Sachet, und er …«
»Unterstehen Sie sich!«
Ungläubig starrte Pierre auf den Hörer und schüttelte den Kopf. Der Mann hatte einfach aufgelegt.
3
Als Pierre sich am Abend neben Luc an den Ausgabetresen des Café le Fournil stellte und ihm mit einem bière blonde zuprostete, hatte der Himmel bereits die Farbe reifer Aprikosen angenommen.
Die Strahlen der untergehenden Sonne ließen die bunten Fassaden der Häuser leuchten und hüllten den Ort in einen samtenen Schimmer. Die Luft war warm und weich und erfüllt von dem Geruch der vielfältigen Speisen, die die Menschen in den Lokalen rund um die Place du Village genossen. Auf der Außenterrasse des Chez Albert wurden mehrere Tische zusammengeschoben, an denen die soeben eingetroffene Band samt Entourage Platz nahm. Fünf Musiker und drei weitere Männer, und mittendrin die Sängerin Aurelie Azéma, deren wohlklingendes Lachen über den Platz hallte.
»Laut Wetterdienst soll es morgen wieder weit über dreißig Grad geben«, sagte Luc in diesem Moment und zog den Saum seines Shirts hoch, um sich Luft zuzufächeln. Dabei setzte er den Duft eines neuen Rasierwassers in Bewegung, der Pierre schon vor einigen Tagen angenehm aufgefallen war. »Ich hoffe, wir bekommen wenigstens etwas Wind.«
Pierre trank einen großen Schluck aus der Flasche. Das Bier rann ihm kühl den Hals hinunter, und zum ersten Mal an diesem Tag verspürte er so etwas wie Entspannung.
»Ja, eine erfrischende Brise wäre nicht schlecht«, nickte er. »Oder Regen. Aber besser erst nach dem Fest.«
Pierre stellte das Bier ab und biss in sein Sandwich mit poulet rôti, das noch warm vom Grill war, als vom Chez Albert verhaltenes Trommeln herüberschallte. Pierre hielt kauend inne und wandte den Kopf.
Die Musiker hatten sich zueinandergebeugt, einer von ihnen klopfte den Takt auf die Tischplatte, während ein weiterer begann, rhythmisch zu klatschen. Ein sonores Summen setzte ein, das in einen verhaltenen, aber dennoch weit über den Platz wahrnehmbaren Gesang mündete. In einer Sprache, von der Pierre nur wenige Worte verstand, offenbar eine Variante des Provenzalischen, das er nur bruchstückhaft kennengelernt hatte. Es war eine traditionelle, melancholische Melodie, die mit jeder einsetzenden Stimme unmittelbar an Dynamik gewann. Vor allem die des Mannes mit dem schulterlangen Haar, in dem Pierre den Bandleader von Viva Occitània! erkannte, hob sich mit großer Eindringlichkeit von den anderen ab, war wie ein Vibrieren, das direkt in die Magengrube fuhr.
Spaziergänger blieben stehen, kamen näher, um dem unverhofften Spektakel beizuwohnen. Es wurden Stühle herangezogen und Hälse gereckt, und als Aurelie Azéma ihre dunkle Stimme über den Klangteppich erhob, spürte Pierre, dass er am ganzen Körper Gänsehaut hatte.
Erste Zuschauer wippten zum Takt der Musik, einer von ihnen tanzte mit geschlossenen Augen, klatschte dabei frenetisch in die Hände, bis zwei Kellner die Szene beendeten, indem sie mehrere gefüllte Teller durch die Menge balancierten und auf der Tafel der Musiker abstellten.
»Et voilà, bon appétit!«
Stille breitete sich aus, die Zuschauer verharrten, auf eine Zugabe hoffend, bis die Musiker sich lachend abklatschten und dann ihrem Essen zuwandten.
»Toll, nicht wahr?«, wisperte Luc ehrfürchtig. »Aurelie Azéma hat für ihren Gesang schon bedeutende Preise gewonnen. Und der Große dort, der mit dem dunklen langen Haar, ist Léo Turpin, der kann mit seiner Stimme Massen bewegen. Als die Band auf dem Festival Rio Loco gespielt hat, ist ganz Marseille ausgeflippt.«
Das war natürlich schamlos übertrieben. Aber da Viva Occitània! den Ruf besaß, einen Pulk Fans zu mobilisieren, die ihren Idolen zu den Auftritten hinterherreisten, hatte Pierre neben Feuerwehr, Sanitätern und Helfern auch Kollegen von der Gendarmerie angefordert, um die örtliche police municipale bei der Regelung des Verkehrs und der Sicherheit während der Veranstaltung zu unterstützen.
Inzwischen hatten sich die Zuschauer zerstreut, und das abendliche Stimmengewirr setzte langsam wieder ein. Pierre lehnte sich an den Tresen und ließ den Blick über den Platz schweifen. Dabei verspürte er eine Unruhe in sich aufwallen, von der er nicht sagen konnte, ob sie aus freudiger Erwartung resultierte oder aus plötzlicher Sorge.
Hastig nahm er einen weiteren Schluck von seinem Bier, als könne er die innere Spannung damit hinwegspülen.
Alles war bereit.
Dort drüben, bei der Église Saint-Michel stand die große Bühne, flankiert von drei weißen Pavillons, in denen gegrillte chorizo au taureau mit frites angeboten werden sollte und tourtou, eine Art Crêpe, nach alter Tradition mit Buchweizenmehl gebacken. Den dritten Stand hatte Philippe gemietet, der Inhaber der Bar du Sud, der seine gesamte Verwandtschaft zusammengetrommelt hatte, um während des Fests Getränke auszuschenken. Der Bereich beim Bouleplatz, wo man den Reisighaufen für das Feuer aufgetürmt hatte, war abgesperrt, und überall zwischen Bäumen und Straßenlaternen hingen kreuz und quer über den ganzen Platz gelbe Fähnchen im Wechsel mit roten. Die Farben Okzitaniens und der Provence, mit denen auch der Kaminraum in der Burg dekoriert worden war.
»Ich frage mich gerade«, sagte Pierre nachdenklich, »warum die Provenzalen ein Fest feiern, das seinen Ursprung in einer katalonischen Tradition hat.«
»Okzitanien ist überall«, sagte Luc und sah ihn mit erstauntem Blick an. »Von Katalonien über die Provence bis in das Piemont. Wusstest du das nicht?«
»Bis in das Piemont hinein?«
»Ja, das alte Okzitanien reicht bis in die Täler von Cuneo, zum Teil sogar in die Provinz Imperia. Die Flamme beschwört eine uralte Gemeinschaft, über zwei Landesgrenzen hinweg.«
»Erstaunlich«, sagte Pierre. Ob der Bürgermeister sich der Bedeutung bewusst war, die dieses Fest mit sich trug?
Als Rozier vor drei Jahren den Gemeinderat davon überzeugte, diese in vielen Orten wiederbelebte Tradition auch in Sainte-Valérie einzuführen, hatte er das vor allem als wunderbare Möglichkeit zur kulturellen Erbauung der Gäste präsentiert.
»Ein Fest in den Sommermonaten ist geradezu prädestiniert, in unseren Veranstaltungskalender aufgenommen zu werden«, hatte er geworben. »Damit wird unser Ort für die Urlauber noch attraktiver.«
Die Feux de la Saint-Jean waren allerdings weniger zugkräftig als gehofft. Bis der Bürgermeister in diesem Jahr selbst die Leitung übernommen hatte und sogar Radio-Spots schalten ließ, natürlich mit ihm selbst in der Hauptrolle.
»Kommen Sie nach Sainte-Valérie«, hatte Rozier über den Äther geschickt, »und erleben Sie einen berauschenden Abend, den Sie nie mehr vergessen werden!«
In diesem Moment, als Pierre daran dachte, ahnte er, dass der Bürgermeister ihn am Morgen übers Ohr gehauen hatte. Wenn Roziers Plan aufging, würde es die größte Veranstaltung werden, die Sainte-Valérie jemals erlebt hatte. Wie viele der Besucher würden wohl eine eigene Fackel mitbringen?
»Zut!«
Pierre trank den letzten Schluck seines Biers und stellte die leere Flasche auf den Tresen. Er ärgerte sich, dass er nicht standhaft geblieben war. Aber nun war es zu spät. Die Männer der freiwilligen Feuerwehr waren informiert, mehr konnte er momentan nicht tun. Außer beten.
»Was hast du gesagt?«, fragte Luc.
»Ach, nichts. Ich habe überlegt, ob ich noch in die Bar du Sud gehen soll. Kommst du mit?«
»Nein, Florence hat gleich Feierabend.« Sein Assistent wies mit dem Kopf in Richtung des Café le Fournil, in dem seine neue Freundin als Serviererin arbeitete. »Heute gehen wir früh ins Bett.« Luc grinste breit. »Aber nicht das, was du denkst. Wir wollen morgen früh um fünf aufstehen. Kräuter sammeln.«
»Seit wann interessierst du dich für so etwas?«
»Schon immer! Jedenfalls am Johannistag.« Luc zeigte in den Himmel, dessen Saum inzwischen violett schimmerte. »In der Nacht vom 23. auf den 24. Juni herrscht auf Erden die stärkste Energie des ganzen Jahres. Diese fließt auch in die Kräuter von Saint-Jean, dem heiligen Apostel Johannes: Schafgarbe, Wermut, Hauswurz, Gundelrebe, wilde Gänseblümchen, Johanniskraut und Salbei. In dieser Nacht füllen sie sich mit purer Magie. Deshalb muss man sie morgens sammeln. Wenn sie noch vom Tau bedeckt sind, dann ist die Kraft am größten.«
»Das ist nicht dein Ernst!«
»Doch! Das ist Teil eines uralten Wissens. Man kann damit sogar einen Liebestrank brauen.« Luc zwinkerte ihm verschwörerisch zu. »Willst du wirklich noch in die Bar? Was ist mit Charlotte? Diese Nacht sollte man mit seiner Liebsten verbringen.«
»Sie muss arbeiten«, antwortete Pierre knapp.
Seit sie als Chefköchin in der Domaine des Grès gekündigt hatte, war sie nahezu täglich im Restaurant eingesetzt worden, um ihren Nachfolger in kürzester Zeit einzuweisen. Pierre hatte sie in den vergangenen Wochen kaum noch zu Gesicht bekommen, was sich hoffentlich sehr bald ändern würde.
Mit einem Mal wurde es wieder laut auf dem Platz. Aus der Bar du Sud drang Geschrei. Dann wurde die Tür aufgestoßen, und der Journalist stolperte heraus, verfolgt von einem Schwall wilder Flüche. Er strauchelte, fing sich wieder, dabei flog sein Strohhut zu Boden. Sichtlich aufgebracht hob er ihn wieder auf und klopfte ihn ab.
»So schnell werdet ihr mich nicht los!«, schrie er in Richtung Bar und stapfte dann mit einem Kopfschütteln davon.
Pierre, der sich schon bereit gemacht hatte, einzugreifen, entspannte sich wieder. Ein Streit zwischen Betrunkenen, es würde sicher nicht bei diesem einen bleiben.
»Kommst du, mon loup?«
Florence war unbemerkt neben sie getreten. Die mollige junge Frau mit dem blond gefärbten, hochgesteckten Haar schmiegte sich an Lucs Brust, die nicht mehr ganz so schmächtig war – dem beharrlichen Muskeltraining sei Dank.
»Oui, ma puce.«
Luc hob ihr Kinn und küsste Florence mit einem derart innigen Zungenspiel, dass Pierre den Rest seines Sandwichs einwickelte und sich mit einem knappen Gruß entfernte.
Wolf und Floh. Grundgütiger!
Grummelnd durchquerte er die beleuchteten Gassen und bog in die Rue des Oiseaux, wo er den Wagen geparkt hatte. Die Lust auf einen Besuch in der Bar war ihm vergangen. Er würde jetzt nach Hause fahren, eine Flasche Rotwein öffnen und sich früh schlafen legen.
4
Er hatte in ein Wespennest gestochen. In ein gewaltiges, wie sich zeigte. Am Anfang war es nur eine Ahnung gewesen, die Idee einer großen Story. Es hatte sein Jagdfieber geweckt, nun aber war er auf der richtigen Spur, ganz nah dran. Die Sache hatte sich auf eine Weise entwickelt, die er nie für möglich gehalten hätte. Die Lösung war fast schon perfide, kein Wunder, dass niemand sie in Erwägung gezogen hatte.
»Haben Sie schon gewählt? Die Küche schließt bald.«
Er blickte auf. Die Kellnerin stellte ein Glas auf den Tisch und goss mit einer gekonnten Bewegung den Rotwein ein. Dann stellte sie die Flasche ab und lächelte ihn an. Die flackernde Kerze des Windlichts beleuchtete ihr Gesicht. Sie war jung und hübsch, hatte einen knackigen Po, das war ihm bereits vorhin aufgefallen, als er den besten Wein auf der Karte geordert hatte, um seine Wut hinunterzuspülen.
»Ja, das habe ich.« Er lehnte seinen Arm über die Stuhlkante, so dass er die wohlgeformte Rundung mit seinen Fingern beinahe berühren konnte. Dann warf er einen Blick auf die Karte. »Die artichauts à la barigoule klingen verlockend. Womit sind die Artischocken denn gefüllt?«
»Mit geräuchertem Speck und einem mit Thymian aromatisierten Gemüseconfit.«
»Die nehme ich.«
»Gerne. Darf ich Ihnen einen Hauptgang empfehlen?«
»Nur zu. Ich möchte Fleisch.« Er lehnte sich ein Stück zur Seite und streckte die Finger aus. Nur noch wenige Millimeter …
»Dann empfehle ich Ihnen das côte de veau. Das Kalbskotelett wird serviert mit kandierten Feigen in Rotweinsauce, Zwiebelkonfitüre und pommes noisettes.«
»Wunderbar. Den Nachtisch wähle ich später.«
»Sehr gerne, Monsieur.«
»Sie dürfen mich Maxim nennen.«
Sie lächelte hilflos, trat dann zurück, stieß dabei mit ihrem Po gegen seine Hand. »Oh, Verzeihung«, sagte sie erschrocken und entfernte sich rasch.
Grinsend sah er ihr nach. Seine Laune hatte sich schlagartig gebessert.
Zufrieden lehnte er sich zurück und genoss das luxuriöse Ambiente. Aus den Lautsprechern tönte leiser Jazz. Von seinem Platz aus konnte er über die lavendelbepflanzten Kübel hinweg direkt in den gepflegten Garten der Domaine des Grès sehen. Akkurat gestutzte Buchsbäume, Blumen mit üppigen weißen Blüten und Ruhe-Inseln aus Korbgeflecht.
Es war eine gute Idee gewesen, hierherzufahren, auch wenn es eigentlich zu spät war für ein ganzes Menü. Dies war genau der richtige Ort, um seine Wunden zu lecken und Kraft zu tanken für den morgigen Tag. So schnell würde er sich nicht geschlagen geben. Es gab andere Wege, um ans Ziel zu kommen.
Er trank einen Schluck Rotwein, ganz ohne das übliche Ritual des Schwenkens, Schlürfens und Kauens, und dachte an seine Recherchen, die Ungeahntes aus den Tiefen der Vergangenheit heraufbefördert hatten.
Ein Mörder war ungeschoren davongekommen, weil er glaubte, an alles gedacht zu haben.
Ein Irrtum!
Er würde ihn enttarnen. Schon bald würde er mit allen relevanten Personen gesprochen haben. Und dann würde er die Bombe platzen lassen.
5
Als Pierre erwachte, war es draußen noch grau. Er hatte nicht gut schlafen können, sich über Stunden gewälzt, und als er endlich in einen Dämmerzustand glitt, hatte er wirres Zeug geträumt von Fackeln und einer Feuerwand, so dass er erschrocken auffuhr und sich überrascht umsah, froh, dass es nur ein Traum gewesen war.
Erschöpft rieb er sich die Augen und versuchte, das Gespenst düsterer Vorahnung zu vertreiben, bis er einsah, dass er es nicht loswerden würde, wenn er nicht aufstand und sich einen Kaffee machte.
Vorsichtig setzte Pierre sich auf und sah zu Charlotte, die neben ihm lag und tief und fest schlief. Die Locken ihres braunen Haars verdeckten ihr Gesicht, doch ihr Mund lag frei. Es war ein außergewöhnlich schön geschwungener Mund, dachte er, einer, der ansteckend lachen, sich spöttisch verziehen und wunderbar küssen konnte.
Charlotte, die einen Schlüssel zu seinem Haus besaß, war kurz vor Mitternacht noch vorbeigekommen, müde von der Arbeit, und hatte sich wortlos zu ihm ins Bett gelegt. Sie hatte ihren warmen Körper an seinen geschmiegt und war augenblicklich eingeschlafen, während er hellwach dalag angesichts ihrer plötzlichen Nähe.
Sanft strich Pierre ihr nun eine dunkle Locke aus dem Gesicht und hauchte einen Kuss auf das Haar, bevor er sich leise vom Bett erhob.
»Guten Morgen, mon policier.«
Er wandte sich um. »Du bist wach?«
Sie nickte, ohne die Augen zu öffnen. »Ich habe mir vorgenommen, mit dir aufzustehen.«
»Es ist viel zu früh, gerade einmal fünf.«
»Ach?«
Mit einem Seufzer drehte sie sich auf die Seite und begann kurz darauf, tief und gleichmäßig zu atmen.