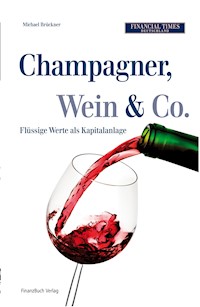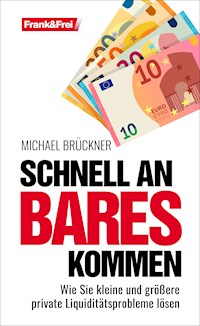15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Geldwertes Wissen für Privatanleger. Filialbanken bieten oftmals schlechten Service und überteuerte Produkte an. Kein Wunder, dass Direktbanken einen enormen Zulauf erfahren – vieles ist einfacher und geht schneller. Günstige Konditionen bei Kontoführung, Tagesgeld, Krediten oder Wertpapiergeschäften locken mehr und mehr Privatkunden an. Bankgeschäfte können bequem per Internet, Telefon, Fax oder Brief getätigt werden. Doch worauf sollten Privatanleger achten, wenn sie von ihrer Hausbank zu einer Direktbank wechseln möchten? Welche Direktbank ist die richtige? Ist die Geldanlage wirklich sicher? Wie werden Konten und Depots eröffnet? Michael Brückner gibt Antworten auf diese und viele weitere Fragen – leicht verständlich und sehr anschaulich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Michael Brückner
Ratgeber Direktbanken
Michael Brückner
Ratgeber Direktbanken
Die clevere Alternative, um mehr aus Ihrem Geld zu machen
Unter Mitarbeit von Dr. Ulrich Ott
Bibliografische Information der Deutschen Bibkiothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet dies Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
ISBN: 978-3-636-01586-0 | Print-Ausgabe
ISBN: 978-3-86881-077-6 | E-Book-Ausgabe (PDF)
E-Book-Ausgabe (PDF): © 2009 by Redline Verlag, FinanzBuch Verlag GmbH, München www.redline-verlag.de
Print-Ausgabe: © 2008 by Redline Wirtschaft, FinanzBuch Verlag GmbH, München
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Jarzina Kommunikation-Design, Holzkirchen Satz: Jürgen Echter, Redline GmbH Druck und Bindearbeiten: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Starter-Checkliste: „Sind Sie ein Direktbanking-Typ“
1. Wie Direktbanken die Branche aufmischen
Weshalb Kunden ihren Filialbanken den Rücken kehrenVom Nischenanbieter zur HausbankGroßes Potenzial für DirektbankingDirektbanking, Direktbrokerage oder Onlinebanking?Direktbanken sind älter als das InternetWie eine Notlösung den Markt revolutionierteTelefonbanking ersetzt das BriefbankingDas Geschäftsmodell der DirektbrokerPhase der KonsolidierungDie „Non-and-near-Banks“Die Fakten auf einen Blick2. So finden Sie die passende Direktbank
Typologie: Die unterschiedlichen BankkundenHaupt- oder Zweitbankverbindung? Sie haben die Wahl!Welche Direktbank ist die richtige?Die wichtigsten Direktbanken im ÜberblickDie Fakten auf einen Blick3. Direktbanking – wirklich sicher?
Die kleinen, aber feinen Unterschiede in der EinlagensicherungDie Kommunikation mit DirektbankenSchutz vor Betrügern im InternetTrojaner – wirklich hinterlistigSchwer zu durchschauen: der Mann dazwischenPC-Sicherheit ist kein LuxusKarte verloren – was tun?Was erfährt der Fiskus?Die Fakten auf einen Blick4. Direktbanking in der Praxis
Legitimation per PostIdent-VerfahrenDas Girokonto – Drehscheibe für alle FinanztransaktionenBanking à la carteKreditkarten von DirektbankenWas ist mit Dollar, Schweizer Franken & Co.?Schnell und einfach – die DepoteröffnungDie Fakten auf einen Blick5. Sparen und Anlegen bei Direktbanken
Sparen ja – Sparbuch neinTagesgeldkonten als BestsellerLaunische GeldmarktfondsFestgeldkonten – Warten wird belohntWertpapierdepots bei DirektbankenDas Wertpapierangebot von (A)ktien bis (Z)ertifikateBörsenwissen kompaktSchwarze Schafe im Grauen MarktAnleihen – auf die Bonität der Emittenten achtenFonds für alleDie unterschiedlichen FondsartenBeim Fondskauf bares Geld sparenDie Fakten auf einen Blick6. Verbraucherkredite von Direktbanken
Die unterschiedlichen KreditartenDer „Dispo“: bequem und flexibel, aber oft teuerGünstiger, aber inflexibel: der RatenkreditBei Anruf Cash: die AbrufkrediteDer Lombardkredit – Geld gegen PfandSchuldner zwischen Schufa und ScoringSo umgehen Sie die wichtigsten SchuldenfallenDie Fakten auf einen Blick7. Die eigenen vier Wände direkt finanzieren
Die drei Gruppen von BaufinanzierernDie Vorteile der AnnuitätentilgungDen günstigen Anschluss nicht verpassenBaugeld auf Vorrat: das Forward-DarlehenDie Fakten auf einen Blick8. Versichern und vorsorgen
Handlungsbedarf bei der privaten AltersvorsorgeZulagen und Steuervorteile bei der Riester-RenteFormen der privaten AltersvorsorgeDie Fakten auf einen BlickAusblick
(Direkt-)Banken-Glossar
Wichtige Webadressen
Einleitung
Wie lautet eine zeitgemäße Definition des fast schon inflationär verwendeten Begriffs „Kundennähe“? Die Frage erscheint berechtigt in einer Zeit, da fast 70 Prozent aller Deutschen regelmäßig das Internet nutzen. Die Onlinequote hat sich damit seit der Jahrtausendwende mehr als verdoppelt – bei weiter steigender Tendenz. Entfernungen spielen keine entscheidende Rolle mehr bei der Auswahl eines Anbieters.
Von sehr personennahen Dienstleistungen abgesehen, lässt sich Kundennähe somit nicht mehr länger geografisch erklären. Denn letztlich ist keine Bankfiliale, keine Buchhandlung und kein Reisebüro näher als der eigene Computer mit Internetzugang, über den die Verbraucher Geldgeschäfte abwickeln, Lesestoff bestellen und die nächste Urlaubsreise buchen können. Dennoch wird der Faktor Nähe gerade von den Finanzdienstleistern gern ins Feld geführt, wenn es gilt, die Vorteile eines mehr oder minder engmaschigen Geschäftsstellennetzes zu preisen. Nähe statt Anonymität, Beratung statt reiner Transaktionen, Individualität statt Massenmanagement – so lauten die Argumente der Filialbanken im Wettbewerb mit den zentralisiert arbeitenden Direktbanken.
Das klingt zunächst einmal überzeugend, zumal das Bedürfnis der Menschen nach Individualität wächst. Doch wie sieht die tägliche Praxis aus? Die langjährige Mitarbeiterin einer großen deutschen Sparkasse brachte es vor einiger Zeit auf den Punkt. Nachdem ihr Vorstandsvorsitzender zuvor wortreich über Kundennähe und Kundenbegeisterung referiert hatte, die eben nur durch Geschäftsstellen vor Ort möglich seien, verblüffte die Bankerin ihren Chef mit einer einzigen Frage: „Wie sollen wir unsere Kunden in der Geschäftsstelle begeistern, wenn immer weniger kommen und diese wenigen oft genug von unseren Azubis bedient werden, weil wir uns im Backoffice um die Bürokratie und die Vorbereitung der nächsten Meetings kümmern müssen?“
Allein die Präsenz vor Ort ist somit kein Merkmal mehr für wirklich gelebte Kundennähe. Das mag vor 20 Jahren noch anders gewesen sein. Individualität als Ausdruck der Nähe wiederum würde zum Beispiel voraussetzen, den Kunden ganz persönlich und objektiv zu beraten. Doch genau an diesem Punkt offenbart sich ein weiteres Dilemma der Filialbanker. Ein Geschäftsstellennetz ist teuer, weshalb in den vergangenen Jahren zahlreiche Niederlassungen an wenig lukrativen Standorten geschlossen oder durch elektronische Zweigstellen mit automatischen Serviceterminals ersetzt wurden. Eine Filiale macht betriebswirtschaftlich nur dann Sinn, wenn sie sich als erfolgreicher Vertriebsstandort erweist. Das heißt, wenn die dort tätigen Mitarbeiter/innen nicht nur Standardleistungen erbringen, die im wahrsten Sinne des Wortes kundennäher am heimischen PC abgewickelt werden könnten, sondern wenn sie in nennenswertem Umfang Bankprodukte verkaufen. Doch daran mangelt es in der Praxis. Vielfach wird sogar das „V-Wort“ konsequent gemieden. Bankmitarbeiter sind Berater, keine Verkäufer. Berater klingt nach Objektivität, nach einer maßgeschneiderten Betreuung des Kunden. Doch letztlich geht es um den Verkauf von margenstarken – in der Regel bankeigenen – Produkten. Das ist zwar durchaus legitim, allerdings gerät der Berater bzw. Verkäufer in diesem Fall schnell in einen Interessenkonflikt. Er will einerseits natürlich seinen Kunden zufriedenstellen, andererseits muss er zum wirtschaftlichen Erfolg seines Arbeitgebers – eben der Bank – beitragen. Man stelle sich vor, ein Steuerberater würde vom Finanzamt bezahlt. Wer könnte in diesem Fall noch Mandantenorientierung erwarten?
Wirkliche Kundennähe lässt sich daher weder durch die Niederlassung vor Ort noch durch die heute in vielen Filialbanken übliche Beratung überzeugend begründen. Zielführender erscheint es allemal, den Bankkunden das zu geben, was sie brauchen. Zum einen fundierte Informationen möglichst aus neutralen Quellen und zum zweiten bedarfsgerechte Produkte zum Vermögensaufbau und -er-halt, zur privaten Vorsorge und zur Finanzierung, aus denen die Verbraucher frei wählen können. Selbstbestimmt handelnde Kunden – das ist die ideale Klientel für Direktbanken. Neben vielen anderen Faktoren hat zum Erfolg der filiallosen Geldinstitute sicher die Tatsache beigetragen, dass die Fülle von nutzwertigen Büchern sowie die zahlreichen Beiträge in den Printmedien sowie in Rundfunk, Fernsehen und nicht zuletzt im Internet die Bankkunden umfassend informieren. Allein das Internet öffnet den Menschen heute Nachrichtenkanäle, die noch vor wenigen Jahren allein den Profis vorbehalten waren. Keine Frage, der Informationsvorsprung ist geringer geworden, Kunde und Bankberater kommunizieren heute vielfach schon auf gleicher Augenhöhe.
Ein Kunde, der weiß, was er will, kommt mit einer Direktbank sehr gut zurecht – und profitiert darüber hinaus von günstigen Konditionen. Doch ungeachtet des Erfolgs dieser Geldinstitute gibt es noch viele Verbraucher, die zögern, zu einer filiallosen Bank zu wechseln. Manche unterhalten dort zwar schon ein Spar- oder Tagesgeldkonto, doch eignen sich diese Finanzdienstleister auch als Hausbank?
Direktbanking, Internetbanking, Onlinebroker, Autobanken, dazu die vielen Offerten von branchenfremden Anbietern (von C&A bis Lidl) – wer soll sich da noch zurechtfinden? Und wie sicher ist das Geld bei diesen Instituten? Wie funktioniert die Baufinanzierung bei einer Direktbank? Ist die Versorgung mit Bargeld garantiert oder muss der Kunde bei Bedarf zehn Kilometer bis zum nächsten Geldausgabeautomaten fahren? Wie bekomme ich einen Kredit und lohnt es sich, bei einer Direktbank ein Wertpapierdepot zu eröffnen, oder sind die klassischen Discountbroker vorzuziehen? Vor allem aber: Wie kann ich mich vor der zunehmenden Internetkriminalität bestmöglich schützen?
Diese und zahlreiche weitere Fragen rund ums Direktbanking beantwortet der vorliegende Praxisratgeber. Die Leser profitieren von den Detailkenntnissen eines erfahrenen Insiders und der kritischen Distanz eines unabhängigen Finanzjournalisten. Dieses Buch wendet sich nicht gegen Filialbanken, auch wenn es deren Achillesfersen thematisiert. Es geht ferner nicht darum, zufriedene Kunden von Filialbanken zu Direktbanken zu locken. Im Vordergrund steht das Ziel, Direktbanking transparent zu machen und für den Kunden nachvollziehbar darzustellen, wie das Geschäft der filiallosen Geldinstitute funktioniert. Ob er dann zu einer Direktbank wechselt oder nicht, entscheidet am Ende allein der Leser – als informierter und autonom handelnder Verbaucher.
Lindau (Bodensee), Mai 2008
Michael Brückner Dr. Ulrich Ott
Über Fragen, Hinweise und Kritik freuen sich die Autoren. Schreiben Sie einfach an:
Starter-Checkliste: Sind Sie ein „Direktbanking-Typ“?
Die Statistik spricht eine deutliche Sprache: Direktbanking ist besonders gefragt bei den 20- bis 45-Jährigen, während die Generation der über 60-Jährigen mehrheitlich den Filialbanken und Sparkassen die Treue hält. Doch für wen ist Direktbanking eigentlich geeignet? Welche Voraussetzungen sollte der potenzielle Kunde mitbringen, um rundum zufrieden zu sein? Und für wen ist Direktbanking weniger empfehlenswert?
Machen Sie mit uns den Praxistest:
1. Führen Sie bei Ihrer Bank Ihr Girokonto bereits online oder per Telefon?
Ja ( ) Nein ( )
2. Können Sie auf den persönlichen Kontakt mit Ihrem Bankberater/Ihrer Bankberaterin verzichten, wenn Sie dafür bessere Konditionen erhalten?
Ja ( ) Nein ( )
3. Nutzen Sie beruflich und/oder privat oft das Internet?
Ja ( ) Nein ( )
4. Falls Sie die Frage 3 mit „Nein“ beantwortet haben: Verfügen Sie über Handy oder eine moderne Telefonanlage?
Ja ( ) Nein ( )
5. Informieren Sie sich regelmäßig über Möglichkeiten der Geldanlage und privaten Vorsorge?
Ja ( ) Nein ( )
6. Bilden Sie sich in finanziellen Dingen gern ein eigenes Urteil?
Ja ( ) Nein ( )
7. Sind Sie grundsätzlich etwas skeptisch gegenüber den Empfehlungen Ihres Bankberaters?
Ja ( ) Nein ( )
8. Wünschen Sie eine Bank, die Sie rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche erreichen können?
Ja ( ) Nein ( )
Je häufiger Sie mit „Ja“ geantwortet haben, desto mehr kommt Direktbanking für Sie infrage.
Für wen Direktbanking weniger geeignet ist:
Kunden, die über die Jahre ein starkes Vertrauen zu ihrem Bankberater/ihrer Bankberaterin aufgebaut habenFirmen und andere juristische Personen (Direktbanking konzentriert sich derzeit vorrangig auf das Geschäft mit Privatkunden)Menschen, die aus ganz persönlichen Gründen den Umgang mit modernen Kommunikationstechnologien ablehnenMenschen, die aus gesundheitlichen Gründen auf Hilfe bei der Erledigung ihrer Bankgeschäfte angewiesen sind1. Wie Direktbanken die Branche aufmischen
Über Jahre hinweg war Sandra S. eine typisch deutsche Bankkundin. Als sie mit 18 Jahren gleich nach dem Abitur ihr erstes Konto eröffnete, ging sie zur Sparkasse vor Ort, mit der schon ihre Eltern und Großeltern zusammenarbeiteten. Richtig zufrieden freilich war die heute 37-jährige Juristin aber nie mit dieser Bankverbindung. Wie oft hatte sie sich schon über wenig kundenfreundliche Öffnungszeiten und über hohe Gebühren geärgert. Und wie oft hatte sie sich vorgenommen, endlich zu einer günstigeren Bank zu wechseln. Doch dann scheute die gestresste Fachanwältin den Aufwand, der mit einem Umzug zu einem anderen Kreditinstitut verbunden ist. Eine deutsche Bankverbindung hält im Schnitt länger als eine deutsche Ehe – bis vor gar nicht allzu langer Zeit traf diese Feststellung durchaus zu.
Ihre Kollegen in der Kanzlei wunderten sich bisweilen etwas über Sandra S.: Die sonst so energische Fachanwältin für Steuerrecht, die sich tagein, tagaus mit Finanzthemen und dem Geld ihrer Mandanten befasste, ließ privat die Zügel schleifen. Hauptsache, die Finanzen machten wenig Arbeit und raubten der Juristin möglichst wenig von ihrer ohnehin schon sehr knappen Zeit. Dafür akzeptierte sie hohe Kontoführungsgebühren und eine schlechte Guthabenverzinsung, und wenn sie sich von ihrer flotten Anlageberaterin wieder einmal von einem angeblich chancenreichen Fonds überzeugen ließ, berappte Sandra S. ohne zu murren einen fünfprozentigen Ausgabeaufschlag. Auf die Idee, nach einer Guthabenverzinsung für ihr Girokonto zu fragen, wäre die Juristin gar nicht erst gekommen. Seit Jahren wickelte sie ihre Bankgeschäfte zudem nur noch im Online-Verfahren oder telefonisch ab, denn wann immer die Juristin Zeit gehabt hätte, ihre Filiale aufzusuchen, hatte diese mit ziemlicher Sicherheit geschlossen.
Als dann aber vor ein paar Jahren die Zinsbindungsperiode ihrer Baufinanzierung ablief und Sandra S. von ihrer Sparkasse ein Prolongationsangebot erhielt, nahte die Stunde der Scheidung. Die Konditionen waren deutlich schlechter als bei einem Neuabschluss – und das, obwohl sich die Anwältin über zehn Jahre hinweg als verlässliche Schuldnerin erwiesen und einen Großteil ihres Darlehens bereits abgetragen hatte. Bei Neukunden zeigte sich die Sparkasse großzügig, bei Bestandskunden – wie es im Bankerjargon leicht despektierlich heißt – langte sie zu. In ihrem Ärger holte sich Sandra S. Alternativangebote ein, darunter auch von einer Direktbank. Bisher hatte die Anwältin noch nie mit einer filiallosen Bank zusammengearbeitet, denn für sie war der persönliche Kontakt sehr wichtig. Schließlich war ihre Beraterin sehr freundlich und machte einen kompetenten Eindruck. Da störte es Sandra S. zunächst nicht, dass sie ihre Beraterin schon seit mindestens zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte. Alle Fragen wurden telefonisch geklärt.
Nun also, nach vielen Jahren der Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Sparkasse, hielt die Anwältin das Angebot zur Anschlussfinanzierung für ihre Penthouse-Wohnung in Händen. Und was sie las, klang sehr überzeugend: Nicht nur, dass die Zinsen selbst bei einer 15-jährigen Bindungsperiode deutlich geringer ausfielen als bei ihrer Sparkasse. Darüber hinaus räumte ihr das Angebot der Direktbank mehr Flexibilität ein. So konnte Sandra S. zum Beispiel einmal pro Jahr auf Wunsch eine Sondertilgung vornehmen, ohne Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen zu müssen. Und auf die kleinlichen Kontoführungsgebühren von ein paar Euro, die Sandra S. an ihre bisherige Hausbank abzuführen hatte, verzichtete die Direktbank ebenfalls. Noch zwei Telefonate mit dem Callcenter des filiallosen Geldinstituts – und Sandra S. hatte ihre Anschlussfinanzierung zu günstigen Konditionen unter Dach und Fach gebracht. Mehr noch: Die Juristin interessierte sich zunehmend für die anderen Produkte der Direktbank, die ebenfalls kundenfreundlicher waren. Bei ihrem nächsten Telefongespräch mit ihrer Kundenberaterin ließ die Anwältin erstmals durchblicken, dass sie komplett zu einer Direktbank wechseln wolle. An das Verhalten der Sparkassenmitarbeiterin erinnert sich Sandra S. noch heute, macht es doch deutlich, wie man einen abwanderungswilligen Kunden erst richtig vergrault. Zunächst appellierte die Bankerin an die Kundenloyalität von Sandra S.:
„Aber Frau S., wir arbeiten doch seit Jahren so gut zusammen. Sind Sie irgendwie unzufrieden?“
„Ja, Ihre Konditionen sind schlechter und die Gebühren höher als bei einer Direktbank.“
„Mag ja sein, dass diese sogenannten Direktbanken Kunden mit dem einen oder anderen Dumping-Angebot locken, aber bei uns bekommen sie doch eine persönliche Beratung. Wir sind mit unserer Filiale in ihrer Nähe. Das kostet natürlich etwas und daher sind wir ein bisschen teurer als diese sogenannten Direktbanken.“
„Na ja, Frau H., Sie sind schon deutlich teurer als die Direktbanken. Und mit dem persönlichen Service ist das auch so eine Sache. Wenn ich mal Zeit habe, ist Ihre Filiale schon geschlossen.“
„Aber Sie können doch rund um die Uhr online mit uns kommunizieren. Und für dringende Angelegenheiten habe ich Ihnen meine Handy-Nummer gegeben ...“
„Wenn ich meine Geldgeschäfte telefonisch oder online abwickeln muss, dann kann ich gleich zu einer Direktbank gehen und muss nicht Ihr teures Filialnetz über hohe Preise und schlechte Konditionen finanzieren ...“
„Frau S., wollen Sie denn wirklich bei Ihrer Vermögensanlage auf unsere Beratung verzichten?“
„Der Fonds, den sie mir verkauft haben, steht aktuell mit 5 Prozent in den Miesen.“
„Aber Frau S., Sie wissen doch, das ist das allgemeine Marktrisiko.“
„Hätte ich den Fonds bei einer Direktbank ohne Ausgabeaufschlag gekauft, hätte ich trotz der Marktschwankungen zumindest noch keinen Verlust eingefahren ...“
„Und überhaupt, Frau S., wissen Sie eigentlich, ob Ihr Geld bei dieser Bank wirklich sicher ist? Wenn bei dieser sogenannten Direktbank etwas passiert, werden Sie mit dem europaweiten Mindestbetrag von 20.000 Euro abgespeist. Das war’s dann.“
„Entschuldigung, aber versuchen Sie bitte nicht, mich für dumm zu verkaufen. Ich habe mich natürlich diesbezüglich erkundigt. Die Direktbank ist dem deutschen Einlagensicherungsfonds angeschlossen. Mein Geld ist dort genauso sicher wie bei Ihnen ...“
„Wer’s glaubt … Aber ich sehe schon, Frau S., Sie legen keinen Wert mehr auf eine Zusammenarbeit. Schade. Wenn’s nicht klappt mit dieser sogenannten Direktbank, können Sie ja wieder zu uns kommen.“
Mit diesen Worten ging eine über 19-jährige Geschäftsbeziehung zu Ende. Sandra S. hat mittlerweile die Direktbank zu ihrer Hausbank gemacht – und diese Entscheidung im Großen und Ganzen bis heute nicht bereut. Noch mehr als die günstigen Konditionen gefällt ihr, dass sie ihre Bank rund um die Uhr erreichen kann, natürlich auch am Wochenende und an Feiertagen.
Weshalb Kunden ihren Filialbanken den Rücken kehren
So wie Sandra S. haben viele Bankkunden in Deutschland und auch in den Nachbarländern, wie etwa Österreich, gehandelt: Sie kehrten ihrer Hausbank entweder komplett den Rücken oder aber sie behielten dort lediglich noch ihr Girokonto und verlagerten ihre Sparkonten, Depots und oftmals auch ihre Immobilienfinanzierungen zu den Direktbanken, die in der Folge mit atemberaubenden Wachstumsraten aufwarteten. Allein beim deutschen Marktführer in Sachen Direktbanking – der ING-DiBa – stiegen die Kundenzahlen zwischen 2002 und 2008 von 1,8 auf über 6,5 Millionen.
Das Nachsehen haben vor allem die regional verankerten Sparkassen sowie die genossenschaftlichen Volks- und Raiffeisenbanken, bei denen nach wie vor die meisten Privatkunden ihre Konten unterhalten. Sie geraten in einen wahren Teufelskreis: Wegen ihrer kosten-trächtigen Filialnetze weisen diese Institute naturgemäß eine ganz andere Kostenstruktur auf als eine Direktbank, die – falls sie dieses Geschäftsmodell stringent umsetzt – auf Filialen, Geschäftsstellen oder andere Formen des stationären Vertriebs verzichtet. „Unsere Bank hat so viele Mitarbeiter wie die deutschen Sparkassen Vorstände“, brachte es einmal der Chef einer deutschen Direktbank auf den Punkt. Keine Filialbank kann – von kurzfristigen Aktionen einmal abgesehen – dauerhaft in einen Wettstreit um die günstigsten Konditionen mit filiallosen Instituten eintreten. Daher betonen Sparkassen und Genossenschaftsbanken den Wert der sprichwörtlichen Nähe zum Kunden: Diese Institute sind vor Ort, die Direktbank unter Umständen ein paar hundert Kilometer entfernt. Um sich im härter gewordenen Wettbewerb der Finanzdienstleister weiterhin behaupten zu können, mussten die Filialbanken aber ihre Kosten reduzieren, was zu einer großen Zahl von mehr oder weniger gelungenen Fusionen und zu Filialschließungen führte. Das Argument der Kundennähe verlor dadurch an Überzeugungskraft.
Auch viele Kunden von Filialbanken wickeln ihre Standardgeschäfte (Überweisungen, Einrichten von Daueraufträgen sowie den Kauf und Verkauf von Wertpapieren) inzwischen ebenfalls im Onlineverfahren oder telefonisch ab. Nur noch viele ältere Kunden nehmen ihre Bankfiliale für solche Geschäfte in Anspruch – oft aus Gründen der Tradition. Die Bankfiliale gehört für diese Menschen zum sozialen Umfeld wie der Bäcker, der Hausarzt oder die Apotheke. Für das dauerhafte Überleben des Geldinstituts vor Ort ist das zu wenig. Dabei gibt es durchaus Lichtblicke für die Zukunft der Filialbanken: Vor einiger Zeit veröffentlichte das Mannheimer Ipos-Institut eine bemerkenswerte Studie, wonach sogar 60 Prozent der Direktbanken-Kunden den persönlichen Kontakt zu ihrem Geldinstitut für wichtig halten. Bei den Filialbanken-Kunden liegt dieser Wert bei rund 75 Prozent. Besonders dann, wenn es um höhere Summen und um langfristige Entscheidungen geht, legen die Kunden offenbar größeren Wert auf das persönliche Gespräch. Hier könnten mithin langfristige Chancen für die Filialbanken liegen, allerdings nur dann, wenn die Präsenz in der Fläche mit ausreichender Kompetenz ergänzt wird. Und genau daran mangelte es in den vergangenen Jahren: Die Filialen dienten überwiegend dem einfachen Standardgeschäft, bei komplexeren Finanz- und Vorsorgeentscheidungen wurden die Kunden oft an die Zentrale verwiesen. Mit einfachen Finanzdienstleistungen indessen lässt sich kaum Geld verdienen; jedenfalls nicht so viel, um ein kostenintensives Filialnetz dauerhaft aufrechterhalten zu können. Immer mehr Filialen wurden geschlossen, an ihre Stellen traten vollautomatisierte Stützpunkte, die mit Serviceterminals, Geldausgabeautomaten und Kontoauszugsdruckern ausgestattet sind. Von persönlicher Nähe kann in diesen Fällen keine Rede mehr sein und viele Kunden wechselten daher gleich zu einer Direktbank und sicherten sich in der Regel bessere Konditionen.
Vom Nischenanbieter zur Hausbank
Dass die Direktbanken gerade auf dem deutschen Markt reüssieren konnten, lässt sich jedoch nicht allein mit den unbestritten günstigeren Kostenstrukturen dieser filiallosen Geldinstitute erklären. Zumal Direktbanken einerseits zwar Miete und Mitarbeitergehälter für die Geschäftsstellen vor Ort sparen, auf der anderen Seite aber erhebliche Summen ins Marketing investieren müssen, um Neukunden zu gewinnen oder Bestandskunden für das sogenannte Cross-Selling-Geschäft zu aktivieren, sprich: ihnen weitere Bankprodukte zu verkaufen. Ein zusätzlicher, nicht minder wichtiger Grund für das starke Wachstum der filiallosen Kreditinstitute war die offene Flanke der etablierten Konkurrenz. Tatsächlich hatten die Banken häufig ein äußerst ambivalentes Verhältnis gegenüber ihren Privatkunden. Bis in die 1980er-Jahre hinein erschienen die Institute wie behördenähnliche Einrichtungen, in denen „Bankbeamte“ mehr oder minder motiviert ihren Dienst verrichteten. Viele Kunden liebten ihre Bank daher fast mit derselben Inbrunst wie das Finanzamt.
Ende der 1990er-Jahre konzentrierten sich die Geldinstitute mehr und mehr auf das margenstarke Investmentbanking-Geschäft. Sie brachten Unternehmen an die boomende Börse, organisierten Unternehmensverkäufe und Fusionen, was in einer Zeit, da manche an ein immerwährendes Wirtschaftswunder glaubten, ein außerordentlich einträgliches Geschäft war. Das Privatkundengeschäft fokussierte sich zunehmend auf die einkommensstarke private Banking-Klientel mit einem Anlagevolumen mindestens im sechs-stelligen Bereich. Die privaten Großbanken gingen in dieser Zeit dazu über, weniger lukrative Privatkunden in Tochtergesellschaften auszugliedern.
Für die Sparkassen und Genossenschaftsbanken blieben die Privatkunden neben kleinen und mittelständischen Unternehmen zwar die wichtigste Säule ihres Geschäfts, doch die Konditionen überzeugten nur selten. Guthaben auf den Girokonten blieben unverzinst, weil man mit diesem „Bodensatz-Kontokorrekt“, wie es im Bankerjargon bisweilen heißt, recht gut verdienen konnte. Selbst den treuesten Sparern bot man nur Magerzinsen. Und wer um Konditionen feilschte, kam sich schon vor wie ein Bittsteller. Irgendwann in dieser Zeit spotteten die Medien über die „3-6-3-Banker“: 3 Prozent geben sie auf Spareinlagen, 6 Prozent verlangen sie für Kredite und um 3 Uhr gehen sie Golf spielen. Zumindest im Geschäft mit den Privatkunden waren die Strukturen reichlich verkrustet, als die ersten Direktbanken in Deutschland auf den Markt kamen. Sie zielten genau auf die Achillesfersen der etablierten Konkurrenz. Die empfand das zwar als ärgerlich, schenkte den Jeans- und Baseballmützen-Bankern, wie es ein Sparkassenvorstand einmal formulierte, jedoch wenig Aufmerksamkeit. Die Direktbanken agierten als Nischenbanker, boten einfachste Sparprodukte (wie etwa Tagesgeldkonten) und Konsumentendarlehen. Keiner der Verantwortlichen in den Vorstandsetagen der Filialbanken hätte damals geglaubt, dass diese „Aldi-Banken“ einmal zu einer sehr ernsten Konkurrenz aufsteigen könnten. Obgleich der unübersehbare Erfolg des Lebensmittel-Discounters „Aldi“ eigentlich hätte zu denken geben müssen.
Während sich die privaten Großbanken auf das lukrative Investmentbanking konzentrierten und die Sparkassen sowie die Genossenschaftsbanken nicht an den wirklich nachhaltigen Erfolg der filiallosen Kreditinstitute glaubten, liefen die Kunden massenweise zu den Direktbanken über. Dennoch geriet nicht jedes Geschäftsmodell der damals am Markt befindlichen Direktbanken zum Erfolg. Einige Anbieter verschwanden wieder, wurden von ihren Muttergesellschaften reintegriert oder sie fusionierten mit anderen Instituten. Trotzdem hatte die etablierte Konkurrenz in starkem Umfang Privatkunden verloren, was umso mehr schmerzte, als nach dem Börsencrash zwischen 2001 und 2003 das Investmentbanking kollabierte, da sich in diesem negativen Umfeld kein Unternehmen an die Börse traute. Plötzlich waren Privatkunden wieder gern gesehen, doch die meisten hatten sich aufgrund der wenig erfreulichen Erfahrungen mit ihren früheren Hausbanken schon dauerhaft für eine Geschäftsbeziehung mit Direktbanken entschieden. Längst verfügten diese Kunden über einschlägige Praxiserfahrungen und wussten, dass Direktbanking wirklich funktioniert – auch ohne den persönlichen Kontakt in der Filiale.
Keine Frage, die etablierten Banken haben die Konkurrenz durch die filiallosen Geldinstitute zunächst unterschätzt und zu spät reagiert. Begünstigt wurde der Erfolg der neuen Herausforderer ferner durch die schnelle Verbreitung des Internet sowie die zunehmende Bereitschaft der Kunden, die vielfältigen Informationsangebote rund um die Geldgeschäfte zu nutzen und sich ein eigenes Bild zu machen. Dank einschlägiger Bücher, Fachmagazine und vor allem der zahlreichen Angebote im Internet bedarf es in vielen Fällen keiner Berater mehr. Der Kunde ist autonom, besonders ehrgeizige Zeitgenossen sind mitunter sogar besser informiert als der Bankberater.
Großes Potenzial für Direktbanking
Bemerkenswert erscheint es schon, dass die etablierten Banken den Trend in Richtung Direktbanking lange Zeit nicht erkannten oder negierten. Schon zum Jahreswechsel 2003/2004 erschien immerhin eine Studie des Marktforschungsinstituts infas TTR, die mit spektakulären Zahlen und Prognosen überraschte. Im Jahr 1997 hatte der Bankenfachverband ein Direktbanken-Potenzial von 5,4 Millionen Kunden vorhergesagt. Sechs Jahre später war diese Zahl bereits erreicht. Kein Wunder, dass die Marktforscher ihre Prognosen für die nächsten Jahre deutlich heraufsetzten. Bis zum Jahr 2012 rechnen sie mit rund 18 Millionen Direktbanken-Kunden, langfristig könnten es sogar mehr als 30 Millionen sein. Diese Prognosen scheinen keineswegs allzu optimistisch, schließlich setzen mittlerweile sogar die Sparkassen und Genossenschaftsbanken auf eigene Direktbanken. Das Problem ist dabei die Dezentralität dieser Bankengruppen. Jede Sparkasse und jede Volks- oder Raiffeisenbank stellt ein eigenes Unternehmen dar. Gründete zum Beispiel eine Genossenschaftsbank in Kiel eine Direktbank, könnte sie Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet gewinnen – dank Internet überhaupt kein Problem. Genau die Furcht vor einem solchen Kannibalisierungseffekt lähmte die beiden größten Bankengruppen und verhinderte eine schnelle Reaktion auf den Erfolg der Direktbanken.
Unter dem Druck der wirtschaftlichen Fakten setzte mittlerweile ein Umdenken ein. Mehrere Genossenschaftsbanken hoben bereits eigene Direktbanken aus der Taufe. Zu dieser Avantgarde gehören neben den Volksbanken Gießen, Eisenberg und Hannover in erster Linie genossenschaftliche Kreditinstitute aus Rheinland-Pfalz und Westfalen. Die Volksbank Eisenberg in Thüringen zählte zu den ersten, die auf den neuen Trend reagierten. Sie ging schon im Jahr 1995 mit Telefonbanking und einem einfachen Tagesgeldkonto an den Markt. Das erledigten die Mitarbeiter in den Filialen gleichsam noch nebenbei, denn die Nachfrage hielt sich zunächst in Grenzen. Erst als die Medien im Jahr 1998 über die innovativen Thüringer berichteten und die genossenschaftlichen Direktbanker 2002 sogar eine auf ethische und ökologische Geldanlagen spezialisierte Tochter gründeten, stieg das Interesse sprunghaft. Auch im Sparkassen-Sektor gibt des Direktbanken-Ansätze. Die bekanntesten Institute dürften die Frankfurter Sparkasse 1822direkt sowie die DKB Bank sein. Das zeigt: Aus einem Geschäftsmodell, das manche etablierten Banken zunächst noch milde belächelten, wurde unversehens eine zukunftsträchtige Alternative zu den konventionellen Bankgeschäften.
Die wichtigsten Gründe für den Wechsel zu einer Direktbank
1. Günstigere Konditionen
2. Hohe Sicherheitsstandards bei Direktbanken
3. Größere Unzufriedenheit mit derzeitiger Bankverbindung
4. Stärkere Nutzung der neuen Medien im eigenen Haushalt Quelle: infas TTR
Ein Blick ins Nachbarland
Der Erfolg filialloser Geldinstitute ist derweil nicht nur ein deutsches Phänomen. In Nachbarstaaten wie Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien, aber auch in den USA, Kanada und Australien boomt das Geschäft ebenfalls. Doch warum in die Ferne schweifen, werfen wir einen kurzen Blick nach Österreich, wo Ende des Jahres 2007 ebenfalls eine sehr interessante Studie veröffentlicht wurde, die bei den etablierten Banken nicht eben mit Wohlgefallen aufgenommen worden sein dürfte. Die Untersuchung der Universität Innsbruck ergab, dass rund 3,3 Millionen Österreicher potenzielle Direktbanken-Kunden sind. Gut 1,7 Millionen davon könnten der Studie zufolge schon mittelfristig gewonnen werden, der Rest eher langfristig und mit entsprechend größeren Anstrengungen seitens der Anbieter.
Schauen wir uns noch einige weitere Ergebnisse dieser österreichischen Studie an, die sich im Großen und Ganzen von ähnlichen Untersuchungen in Deutschland nur unwesentlich unterscheiden. Rund 48 Prozent der befragten Verbraucher in Österreich äußerten die Überzeugung, Direktbanken seien günstiger als die klassischen Institute, knapp 22 Prozent halten die filiallosen Banken zudem für innovativer. Insgesamt sagte eine Mehrheit von 55,5 Prozent der Befragen, Direktbanken seien eine wertvolle Ergänzung des bestehenden Filialbanken-Systems, und 45 Prozent äußerten die Überzeugung, dass die Präsenz von Direktbanken den Wettbewerb belebt und zu günstigeren Konditionen geführt habe.
Direktbanking, Direktbrokerage oder Onlinebanking?
Vielleicht haben Sie sich diese Frage auch schon gestellt: Was genau ist eigentlich Direktbanking? Wie unterscheidet es sich von Direktbrokerage und vor allem von Onlinebanking, das mittlerweile so gut wie jede Bank und Sparkasse in Deutschland anbietet? Sorgen wir an dieser Stelle für Klarheit und nehmen hierzu einige Begriffe unter die Lupe, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen, hinter denen aber zum Teil ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle stehen. Die noch immer vorherrschende Begriffsverwirrung führte in den vergangenen Jahren häufig zu einer gewissen Verunsicherung, da alle filiallosen Finanzdienstleister gleichsam „in einen Topf geworfen“ wurden.