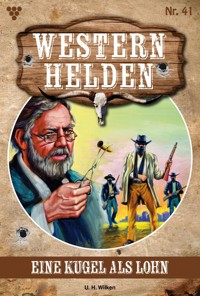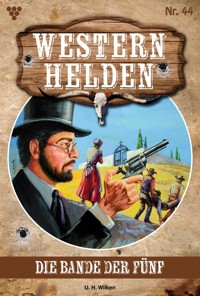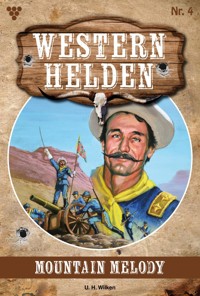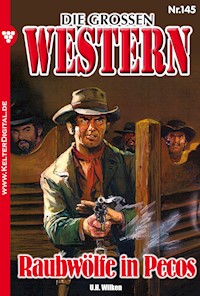
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Die Fliegendrahttür filtert die gleißend hellen Sonnenstrahlen. Milliarden von Staubteilchen tanzen im breiten Lichtstrahl, der durch das geöffnete Fenster in den sauberen kleinen Wohnraum fällt. Draußen flimmert und flirrt die windstille Luft von der Glut der Sonne. Hier im Raum herrscht wabernde Hitze. Die alte Frau im Stuhl am Fenster bewegt sich ein wenig, das graue Haar schimmert so hell wie Gletschereis im Sonnenschein. Sie blickt gedankenversunken auf die saubere Tischplatte, auf der kleine Sonnenkreise tanzen und spielen. Mrs Pamela Carter denkt an ihre Söhne. Auf der breiten sonnendurchglühten Straße rollt die Conrad-Kutsche entlang. Staub breitet sich wallend nach beiden Seiten aus. Das Geschirr klirrt, dumpf pochen die Hufe. Die alte Frau blickt hinaus. »Die Postkutsche«, murmelt sie. »Sie ist wieder gut durch das Indianergebiet gekommen. Comanchen und Kiowas sind ruhig. Gott sei Dank. Und der Krieg ist aus.« Ihre Stimme verklingt im Raum. Ihre Gedanken sind jenseits des Pecos River. Ihre Augen sind noch immer klar, und ihr Blick wandert nun über die staubige Straße, über das gegenüberliegende Haus hinweg zu den vielen Hügeln und Bergen, über denen sich ein stahlblauer wolkenloser Himmel dehnt. »Meine Söhne.« Sie lächelt irgendwie schmerzvoll, schluckt bitter und grübelt. Seit Jahren grübelt sie nun schon, diese alte Frau, die zwei prächtige Söhne hat. Die Kutsche hält vor dem Postoffice. Stimmen ertönen auf der Straße. Einwohner nähern sich. Die gewölbte Tür der Kutsche wird geöffnet. Ein hagerer, großer Mann kommt hervor. Seine grauen Augen sehen nur kurz auf den Kutschfahrer, der vom Bock klettert. Postsäcke werden ins Office getragen. Die Leute drängen heran. Der große Mann steht
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 145 –Raubwölfe in Pecos
U.H. Wilken
Die Fliegendrahttür filtert die gleißend hellen Sonnenstrahlen. Milliarden von Staubteilchen tanzen im breiten Lichtstrahl, der durch das geöffnete Fenster in den sauberen kleinen Wohnraum fällt.
Draußen flimmert und flirrt die windstille Luft von der Glut der Sonne. Hier im Raum herrscht wabernde Hitze.
Die alte Frau im Stuhl am Fenster bewegt sich ein wenig, das graue Haar schimmert so hell wie Gletschereis im Sonnenschein.
Sie blickt gedankenversunken auf die saubere Tischplatte, auf der kleine Sonnenkreise tanzen und spielen.
Mrs Pamela Carter denkt an ihre Söhne.
Auf der breiten sonnendurchglühten Straße rollt die Conrad-Kutsche entlang. Staub breitet sich wallend nach beiden Seiten aus. Das Geschirr klirrt, dumpf pochen die Hufe.
Die alte Frau blickt hinaus.
»Die Postkutsche«, murmelt sie. »Sie ist wieder gut durch das Indianergebiet gekommen. Comanchen und Kiowas sind ruhig. Gott sei Dank. Und der Krieg ist aus.«
Ihre Stimme verklingt im Raum. Ihre Gedanken sind jenseits des Pecos River. Ihre Augen sind noch immer klar, und ihr Blick wandert nun über die staubige Straße, über das gegenüberliegende Haus hinweg zu den vielen Hügeln und Bergen, über denen sich ein stahlblauer wolkenloser Himmel dehnt.
»Meine Söhne.«
Sie lächelt irgendwie schmerzvoll, schluckt bitter und grübelt. Seit Jahren grübelt sie nun schon, diese alte Frau, die zwei prächtige Söhne hat.
Die Kutsche hält vor dem Postoffice. Stimmen ertönen auf der Straße. Einwohner nähern sich. Die gewölbte Tür der Kutsche wird geöffnet. Ein hagerer, großer Mann kommt hervor. Seine grauen Augen sehen nur kurz auf den Kutschfahrer, der vom Bock klettert. Postsäcke werden ins Office getragen. Die Leute drängen heran.
Der große Mann steht auf der Straße. Er lehnt sich an die Kutsche, hinter der die Leute nach Post fragen. Seine Rechte nimmt den festen Krückstock. Als er langsam über die Fahrbahn humpelt, steigen noch zwei Reisende aus der Kutsche.
Robert Carter sieht nach vielen Jahren seine Heimatstadt Pecos wieder. Sein Blick ruht auf den Häusern, Gehsteigen und Vordächern. Pecos hat sich nicht verändert, es ist alles noch so wie früher. Nichts ist getan oder neu geschaffen worden. Die alten Holzhäuser haben noch immer keine neue Farbe erhalten, und auch die Sidewalks sind wie damals brüchig und ausgetreten.
Er lächelt auf einmal sanft. In seinen grauen Augen ist plötzlich jener stille Frieden, den ein Mann empfinden muss, wenn er nach schlimmen Kriegsjahren zum ersten Mal wieder seine vertraute Heimat sieht. Hier verlebte er die sorgenfreie Zeit seiner Kindheit, nur wenn die Comanchen Pecos angriffen, war auch in dieser Stadt kein Frieden.
Sein Elternhaus steht am Ortsrand. Er warf einen ernsten, suchenden Blick hinaus, als die Kutsche vorbeirollte, und er sah das silbern schimmernde Haar seiner Mutter.
Nun geht er langsam am Rand der Straße entlang.
»Das ist doch – verdammt, das ist doch Rob Carter.«
Er hört die brüchige Stimme und dreht sich um. Ein alter Mann kommt heran.
Carter lächelt.
»Ja, Old Logan«, sagt er und verlagert sein Körpergewicht aufs linke Bein. »Der Krieg ist aus.«
»Du warst im Krieg, Robert?«, fragt der Oldtimer. »Wir alle dachten, dass du mit deinem Bruder Ted Cowboy in Texas bist.«
»Wir waren es auch, Old Logan«, murmelt Carter, »aber dann kam der Krieg, und wir gingen freiwillig. Sieh dir mein Bein an, ein Andenken an den verdammten Krieg.«
»Es sieht schlimm aus, Robert.«
»Ja, es ist völlig steif.« Carter lächelt bitter. Er sieht sich um. »Und hier in Pecos ist alles so geblieben, nicht wahr?«
Old Logan nickt.
»Yeah. Und die Indsmen sind jetzt ruhig. Aber es wird wohl nicht immer so bleiben. Wo ist dein Bruder, Rob?«
»Ich habe ihn zwei Jahre nicht mehr gesehen«, erwidert Carter dumpf. »Wer weiß, ob er das alles überstanden hat. Ich weiß nicht, wo er ist, Old Logan.«
»Er wird schon noch kommen.«
»Ja, vielleicht.«
»Sam Ballard ließ seine Söhne nicht in den Krieg reiten«, sagt der Alte schleppend. »Er zwang sie richtig, hierzubleiben. Ja, er kümmerte sich gar nicht um unseren Krieg. Und er war in den ganzen vergangenen Jahren nur wenige Male in der Stadt. Auch er hat sich nicht geändert. Wir alle nicht, Rob. Pecos ist das Pecos von damals geblieben.«
»Wo sind die anderen jungen Männer der Stadt?«
»Auch sie sind fortgeritten. Einige stehen auf Ballards Lohnliste. In der Stadt leben nur wir Alten. Und Lucas Corey ist noch immer unser Sheriff.«
Carter lächelt einen Atemzug lang.
»Der alte dicke Lucas?«
»Er ist noch fetter und fauler geworden. Es waren ruhige Jahre in Pecos. Vielleicht wird es jetzt anders, wie?«
»Möglich. Wir sehen uns noch.« Carter nickt ihm zu und geht dann langsam weiter.
Der Oldtimer blickt ihm nachdenklich und ernst nach, wie er durch den Straßenstaub humpelt und das steife Bein schwer nachzieht.
Dann steht Robert Carter vor dem kleinen Haus und atmet schwer. Er verspürt eine stille Furcht. Die Mutter wird fragen, immer nur nach Ted fragen, und er wird keine gute Antwort geben können.
Drinnen horcht die alte Frau und blickt starr zur Tür. Sie hört schwere, humpelnde Schritte. Jetzt ist es draußen vor dem Haus still. Ihre abgearbeiteten Hände krampfen sich ineinander. Robert betritt den Raum.
Die Frau kommt mit einem Ruck hoch. Ihre Augen beginnen zu leuchten, ihr ganzes faltiges Gesicht zittert auf einmal.
»Robert. Mein Junge«, flüstert sie erstickt.
Er ist kein Junge mehr. Er ist ein verschlossener, ernster Mann, der ein hartes Schicksal tapfer ertragen will. Tiefe Hautkerben durchziehen sein kantiges Antlitz.
»Ja, Mutter«, sagt er ganz rau und schluckt hart.
Er sagt nichts mehr, jedes Wort bereitet ihm Mühe. Er fühlt sich wieder leer, ausgehöhlt und irgendwie überflüssig. Aber man sieht es ihm nicht an.
Seine Mutter starrt mit bangen Augen auf sein rechtes Bein und auf den Krückstock, seufzt leise.
»Du warst im Krieg, mein Junge? Oder bist du vom Pferd gestürzt?«
Sie spricht so sachlich, denkt er, so furchtbar sachlich. Sie wird gleich weinen, wenn sie so spricht.
Er nickt langsam und sagt schleppend: »In Atlanta traf mich ein Granatsplitter. Es ist schon bald ein Jahr her. Im September war’s. Jetzt ist Sommer in Texas, der Krieg ist für uns verloren.«
Sie schluckt trocken.
»Ja«, sagt sie seltsam heiser, »ja. Und ich dachte immer …« Sie verstummt und kommt langsam zu ihm. Sie muss den Kopf zurücklegen, um ihm in die Augen sehen zu können. »Wo ist dein Bruder? Wo ist Ted?«
Ganz leise kommt diese brennende Frage über ihre blassen Lippen.
Alle fragen sofort nach Ted, denkt er. Nach Ted und diesem verdammten Bein. Und ich weiß nicht, wo Ted ist.
»Wir waren Cowboys. Dann brach der Krieg aus. Wir meldeten uns. Und schon bald verloren wir uns. Ich hörte nichts mehr von Ted. Ich weiß auch nicht, wo er kämpfte.«
»Mein Himmel«, flüstert sie. »Ihr kämpftet für den Süden, nicht wahr? Und der Süden verlor den Krieg. Viele Tausend Soldaten kamen um im Krieg – und Ted auch.«
Nach ihren Worten entsteht eine beklemmende Stille. Er muss sich zusammenreißen.
»Das darfst du nicht sagen, Mutter. Ted ist ein kluger Mann. Er wird durchkommen.«
Ihre Augen schimmern feucht. Dann blenden Tränen ihren Blick.
»Mein Junge, es ist gut, dass du zurückgekommen bist. Ich bin froh und glücklich darüber. Ich habe nicht beide Söhne verloren. Du bist hier.«
Aber sie macht keinen glücklichen Eindruck. Sie sitzt reglos und voller Kummer auf ihrem Stuhl und weint lautlos.
»Warum hast du mir nicht geschrieben, Robert? Warum nicht?«
»Es wäre nicht besser dadurch geworden, Mutter. Du hättest dir viele Sorgen gemacht. Wir wollten, dass du denkst, wir wären noch Cowboys. Und wir wollten ja auch zurückkommen. Ja, ich bin hier, und auch Ted wird zurückkommen. Du musst daran glauben, Mutter.«
Sie erhebt sich langsam und geht zum Herd.
»Ich werde dir einen starken Kaffee kochen, mein Junge. Du wirst durstig sein.«
Ihre Stimme klingt jetzt anders, sie hat sich wieder gefasst. Sie wird ihm nicht mehr ihre Tränen zeigen.
Und er atmet tief und nickt nur, während sie den Kessel auf das Herdloch stellt und Holz nachwirft.
»Wirst du noch reiten können, Robert?«, fragt sie plötzlich.
»Ja, aber nicht mehr so gut wie früher.«
»In der Stadt gibt es kaum Arbeit.«
»Ich werde zu Ballard reiten.«
»Ja, versuch es, mein Junge. Vielleicht hat Sam Ballard Arbeit für dich. Er sucht Reiter. Seine Ranch ist in diesen Jahren noch größer geworden. Nun will er das herrenlose Vieh in Texas zusammentreiben. Das erzählt man sich in Pecos. Deshalb sucht er wohl noch Reiter.«
»Morgen reite ich zu ihm.«
Das Wasser im Kessel summt. Die Frau stellt die Tasse auf den Tisch. Dann braut sie den Kaffee und gießt wenig später den duftenden schwarzen Kaffee in die Tassen.
*
Im Osten flammt die Morgenröte. Die Luft ist frisch und riecht nach taufeuchtem Gras und kühler Erde. In den Niederungen wallen noch die feinen Schleier des Frühnebels.
Ein Reiter schält sich aus der Nebelwand am Weidecreek und strebt der Bodenwelle zu. Das Pferd klettert langsam hinauf. Robert Carter hält sich am Sattelhorn fest. Er würde sonst vom Sattel rutschen, weil er sich nicht mit beiden Beinen fest und sicher halten kann.
Oben auf der Bodenwelle verharrt er und blickt in das vor ihm liegende Tal hinab. Die dunkle Masse einer Rinderherde lagert dort. Das rote Auge eines Morgenfeuers leuchtet durch den Dunst des erwachenden Tages. Cowboys lagern am Campfeuer. Leise und verzerrt kommt der raue Klang ihrer Stimmen herüber.
Carter reitet weiter.
Die Morgenröte verblasst über dem Pecos River, als er das Haupttal mit dem Ranchhaus und den Stallungen und Corrals erblickt. Er hockt reglos im Sattel und sieht hinunter. Eine Mannschaft reitet gerade vom großen Hof und jagt durchs Tal davon. Die Corrals sind leer. Das einstöckige Herrenhaus ragt wie eine Burg empor. Oben in Höhe des Stockwerks wuchert eine breite Veranda hervor, darunter ist der breite Hauseingang. Davor liegt die Terrasse. Der Hof wird umsäumt von Schuppen, Ställen und vom Bunkhaus.
Die Ballard-Ranch.
Sie ist größer geworden, viel größer.
Er lenkt sein Pferd ins Tal und nähert sich dem Ranchhaus.
Auf der Terrasse steht ein breitschultriger Mann. Sein eckiges, kantiges Gesicht ist verkniffen. Die Augen blicken dem Reiter forschend entgegen.
Carter zügelt sein Pferd dicht vor der Terrasse. Er ist allein auf dem Hof. Vor ihm steht Sam Ballard, der einzige mächtige Mann am Pecos, der nun für seine Ranch, Söhne und Rinder lebt, der hier alles aufbaute, Comanchen mit Kugeln vertrieb und nun ein gewaltiges Rinderreich besitzt.
Nichts in seinem Gesicht verrät, was er denkt. Kein Lächeln, kein gutes Leuchten in den Augen. Ein abweisendes Gesicht, in dem eine harte, raue Zeit ihre Spuren eingebrannt hat.
Sie gleichen sich – Carter und Ballard. Aber sie wissen es nicht. Ballard kümmert sich nicht um die Vorgänge in Pecos, ebenso wenig um die Menschen, die dort leben. Für ihn ist die Welt an den Grenzen seines gewaltigen Weidelandes zu Ende.
»Tag, Mister Ballard.«
Es ist noch nie Robert Carters Art gewesen, freundlich zu sein. Und jetzt, da er sich manchmal zum alten Eisen zählt, ist es ihm schon fast ein Gräuel. Aber er muss freundlich sein, denn er sucht Arbeit. Und er will darüber hinwegkommen, dass er nur noch ein halber Mann ist, dass er nur ein Bein richtig bewegen kann.
Er braucht einen neuen Anfang.
Er will nicht aufgeben.
Sam Ballard neigt den kantigen Schädel etwas nach rechts und starrt ihn scharf und abtastend an.
»Sie haben sich verändert, Carter«, sagt er nun. »Sie sitzen nicht gut im Sattel.«
»Ich war im Krieg, Mister Ballard.«
Ballard macht eine heftige Bewegung mit der Rechten.
»Krieg«, knurrt er rau. »Ein Mann ist ein großer Narr, wenn er sich vom Krieg überrennen lässt. Und er ist ein Dummkopf, wenn er für die verbrecherischen Geldbonzen im Süden kämpft.«
»Wie meinen Sie das, Ballard?«, fragt Carter murmelnd.
»So, wie ich’s sage, Mann. Was ist mit Ihrem Bein? Der Krieg, nicht wahr?«
»Ja.«
»Hab’s mir schon gedacht. Sie waren damals ein guter Reiter, Carter, zu gut, um von einem störrischen Gaul abgeworfen werden zu können. Sie waren in Texas, auf der anderen Seite des Pecos?«
Carter nickt kurz.
»Dort unten war kein Krieg«, sagt Ballard rau. »Sie meldeten sich also freiwillig, wie? Aah, Sie brauchen nichts zu sagen, Carter. Sie und Ihr Bruder glaubten natürlich, das Richtige zu tun, und jetzt ist Ihr Bein zum Teufel.«
»Ich weiß, dass Sie Ihre Söhne nicht reiten ließen, Ballard«, sagt Carter kühl. Er beherrscht die aufkommende Wut. Ballard verurteilt, zerrt alles in den Dreck.
»Und?«, knurrt Ballard. »Warum sollte ich meine Söhne reiten lassen? Damit sie zerschossen und zerstückelt werden? Damit ich alles hier umsonst gemacht habe? Verdammt, sagen Sie mir nichts vom Krieg, Carter. Es interessiert mich nicht, warum Sie mitgemacht haben. Was wollen Sie von mir?«
Robert Carter atmet tief ein. Es ist sehr schwer für ihn, jetzt zu antworten. Vor diesem verdammten Beginn hat er sich monatelang gefürchtet. Und nun muss er es aussprechen.
»Ich suche einen Job, Ballard.«
Seine Stimme ist frostig, klingt gepresst. Er starrt Ballard an und sucht in dessen Gesicht die Ablehnung, aber Ballard verzieht keinen Muskel.
»Arbeit?«
»Ja. Hörte, dass Sie noch Reiter suchen.«
»Das stimmt. Ich will das herrenlose Vieh über den Pecos holen. Während des Krieges vermehrten sich die Rinder. Das ist das einzige Gute am Krieg. Jetzt muss man zugreifen. In einigen Jahren ist die gute Zeit vorbei. Ja, Reiter brauche ich, aber doch nicht Sie, Carter!«
»Ich kann reiten.«
»Machen Sie sich doch nichts vor, Carter. Ein Mann muss das Pferd bei der Herdenarbeit mit den Schenkeln lenken. Das können Sie nicht mehr. Ich kann Sie nicht nehmen, Carter.«
»Versuchen Sie es.«
Sam Ballard lacht plötzlich hart auf.
»Mit dem Bein da? Sie sind ein Krüppel, Carter. Sie können meinem Koch helfen, mehr nicht. Ich brauche harte, gesunde Männer.«
Carters Augen sprühen vor Wut. Er schluckt hart. Seine Hände umkrallen das Sattelhorn.
»Sagen Sie das noch einmal, Ballard«, flüstert er heiser. »Sie und Ihre Söhne, Sie haben sich hier verkrochen, während Tausende von Männern für unser Land kämpften und ihr Blut dafür gaben. Unter all diesen tapferen Männern gab es keinen einzigen Narren, keinen Feigling. Wir alle taten es für unser Land, auch für Sie, Ballard. Ja, für Sie, damit Sie hier in aller Ruhe ein Rinderreich aufbauen konnten. Sie kennen keinen Dank, und wir alle wollen auch keinen Dank. Was wir wollen, ist ein klein wenig Anerkennung, ein wenig Hilfe für den neuen Anfang. Mehr nicht. Und jeder von uns wird wieder das leisten, was er früher leistete. Aber Sie, Ballard, kennen ja keinen Anstand. Sie ließen Ihre Söhne auch nicht weg, weil Sie sie unbedingt hier brauchten. Für Sie ist diese Ranch alles, und die Ranch sollen Ihre Söhne später einmal erben. Deshalb ließen Sie keinen fortreiten. Und Ihren Söhnen war es wohl auch verdammt recht, denn wenn sie wie ihr Vater sind, dann können sie ja auch nicht richtig empfinden und fühlen. Ach, was rede ich noch. Ich bettele nicht um den Job, Ballard. Sie müssen wissen, was Sie tun.«
»Das weiß ich«, schnappt Ballard. »Soll ich hier etwa eine Mannschaft aus Krüppeln haben? Niemand hat euch gezwungen, freiwillig zu kämpfen. Als die Wehrpflicht ausgerufen wurde, war es anders. Stimmt! – Aber Sie sind doch schon vorher in den Krieg gezogen, nicht wahr? Hören Sie auf mit dem Blödsinn. Verdammt, sehen Sie denn nicht jetzt ein, dass dieser Krieg schon vom ersten Tag an sinnlos gewesen ist? Sie haben ein steifes Bein. Und wofür? Der Süden verlor. Nein, Carter, versuchen Sie es in der Stadt, nicht hier. Ich hätte Sie sofort genommen, aber mit dem Bein da? Nein.«
»Well«, sagt Carter stockheiser, »well, Ballard.«
Er strafft die Schultern. Sein Blick schweift durch das Tal, kehrt zu Ballard zurück und saugt sich an ihm fest.
»Vielleicht kommt noch einmal eine andere Zeit, Ballard«, murmelt er bitter, »eine Zeit, in der wir Männer aus dem Krieg euch Feiglingen zeigen, was wir noch zu leisten vermögen.«
Ballard schwillt der Hals. Zornesröte steigt in sein Gesicht. Aber er erwidert nichts. Vielleicht erkennt er, dass Robert Carter recht hat. Er wendet sich mit einem Ruck ab, lässt Carter allein auf dem Hof und stapft mit schweren Schritten zum Haus.
Robert Carter nimmt den Zügel und reitet von der Ranch.
Der Rancher steht an der Tür und starrt ihm nach.
»Du Narr«, knurrt er. »Ich musste es dir verflucht deutlich sagen, aber du wirst daraus schon eine Lehre ziehen.«
Der Koch kommt auf den Hof.
»Sag Jube, er soll mein Pferd satteln«, ruft Ballard ihm zu und geht mit einem Fluch ins Haus.
In Robert Carter tobt und wühlt es. Einmal schlägt er sich die Faust aufs Bein. Kein Fluch kommt über seine Lippen. Sein Antlitz wird immer härter und verschlossener.
Du musst den Krieg vergessen. Und dein Bein. Du musst allen zeigen, dass du der Carter von damals bist, dass sich nichts geändert hat. Du musst es durchstehen, auch ohne Ballard. Ballard ist ein feiger Hundesohn. Vergiss seine Worte.
Das denkt er.
Einsam und voller Bitterkeit reitet er durch das Land.
Als er Pecos erblickt, hat er eine starke Wandlung durchgemacht. Er ist erst dreißig Jahre alt, aber schon von einem tiefen Ernst durchdrungen. Fast hätte der Krieg ihn zu einem Entwurzelten werden lassen, doch sein starker Wille lässt ihn einen anderen Weg gehen.
An diesem heißen Mittag steht er am Anfang dieses rauen Weges.
Vor dem Saloon von Pecos stehen drei Sattelpferde.