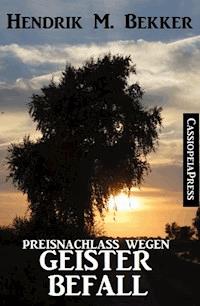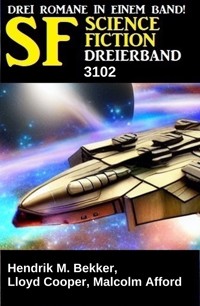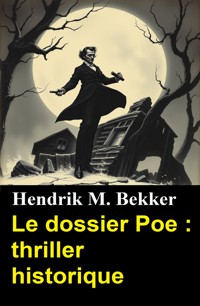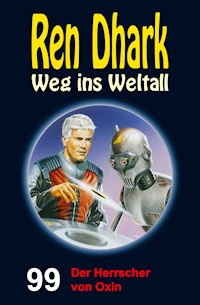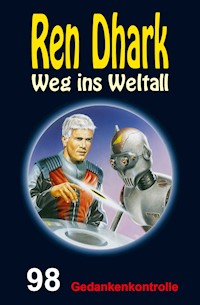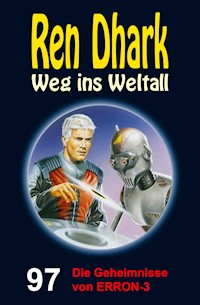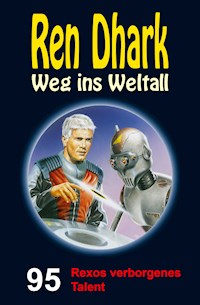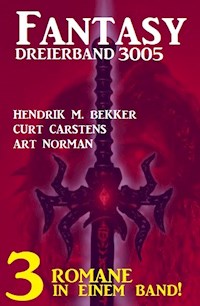12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HJB Verlag & Shop KG
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Auf Terra sind die Arbeiten an der POINT OF endlich abgeschlossen. Ren Dhark und seine Gefährten brechen wieder in den Weltraum auf. In der Ringpyramide auf Nicondo erfährt Arjun Chatterjee von den Heiwahr. Diese haben im Weltraum ein Relikt der Balduren entdeckt und auf ihren Planeten gebracht. Bei der Untersuchung des gefundenen Schebekaisen ziehen sie unbeabsichtigt die Aufmerksamkeit einer uralten dunklen Macht auf sich, die bald ihr ganzes Volk bedroht. In der Hoffnung, dass wenigstens ein Heiwahr überlebt, entwickeln sie den Zeittorus... Hendrik M. Bekker, Jessica Keppler und Nina Morawietz verfassten diesen faszinierenden SF-Roman nach dem Exposé von Anton Wollnik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ren Dhark
Weg ins Weltall
Band 107
Der Zeittorus
von
Jessica Keppler
(Kapitel 1 bis 6)
Hendrik M. Bekker
(Kapitel 7 bis 12)
Nina Morawietz
(Kapitel 13 bis 19)
und
Anton Wollnik
(Exposé)
Inhalt
Titelseite
Vorwort
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Empfehlungen
Simulacron-3/Welt am Draht
Ren Dhark Classic-Zyklus
Ren Dhark Extra
Z Revolution
Impressum
Vorwort
Eigentlich hatte ich das Vorwort für diesen Band längst geschrieben, das Buch war quasi fertig … Dann veröffentlichte die Fachzeitschrift Nature Communications eine interessante Studie, von der ich Ihnen jetzt unbedingt berichten muss. Liebe Leser, ich habe den Eindruck, dass es immer schwieriger wird, Science Fiction zu schreiben, denn inzwischen werden Dinge wahr, von denen wir früher nur träumen konnten.
In der erwähnten Studie geht es um die Kommunikation mittels Gehirnstromwellen. Bei dem Probanden handelte es sich um einen schwerstbehinderten Patienten mit fortgeschrittener Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Er konnte sich inzwischen gar nicht mehr rühren, sich also auch nicht mehr mitteilen – weder durch kontrollierte Bewegungen, etwa der Augen, noch durch Geräusche. Allerdings war er nach wie vor bei vollem Bewusstsein, wie man an der Gehirnaktivität erkennen konnte. Dieser Zustand wird in der Medizin als Locked-in-Syndrom bezeichnet.
Wenn ein Mensch sich bewegt, sendet das Gehirn normalerweise bestimmte Impulse. Daher suchten die Forscher nach einer Möglichkeit, die Gehirnstrommuster des Probanden mit Bewegungen in Verbindung zu bringen. Sie pflanzten ihm mit Genehmigung der Familie zwei Implantate ins Gehirn, mit denen die neuronalen Ströme gemessen wurden.
Bewegte man den rechten Finger des Patienten konnte man dieser passiven Bewegung tatsächlich ein Muster zuordnen. Man bat den Probanden daraufhin, sich vorzustellen, wie er beispielsweise seine Hand oder seinen Fuß bewegte. Hierbei waren allerdings keine eindeutigen Muster zu identifizieren, sodass er das herkömmliche Brain-Computer-Interface (BCI) nicht mehr benutzen konnte.
Am sechsundachtzigsten Tag änderte man die Strategie und verlegte sich auf auditive Rückmeldung neuronaler Aktivität. Abhängig von der neuronalen Aktivität des Probanden wurde nun ein Ton generiert. Schon beim ersten Versuch gelang es dem Mann, den Ton aktiv zu steuern. Einige Tage später war er sogar in der Lage, gezielt bestimmte Impulsfrequenzen zu erzeugen, was ihm mithilfe eines Tonspektrums auditiv vermittelt wurde. Bei bestimmten Gehirnstrommustern erzeugte das Programm am nebenstehenden Computer ein bestimmtes Tonspektrum, das »ja« beziehungsweise »nein« zugeordnet wurde.
Als nächstes sollte der Proband versuchen, mittels »ja« und »nein« eine Matrix anzusteuern. Diese Matrix bestand aus mehreren Reihen von Buchstaben sowie Zusatzfunktionen wie beispielsweise »Zurück« und »Ende«. Mithilfe bewusst erzeugter Gehirnströme konnte der Patient nach einiger Zeit ganze Sätze formulieren, indem er Buchstabe für Buchstabe auswählte. Das dauerte natürlich ziemlich lange, aber am Ende konnte er unter anderem »mixer fuer suppen mit fleisch« sowie weitere Gedanken ausdrücken.
Ich finde, das ist ein unglaublicher Fortschritt. Man stelle sich einmal vor, man könnte eines Tages drei oder sogar mehr Zustände in einem Computer nur mithilfe von Gehirnaktivitäten kontrollieren! Die Gedankensteuerung, die wir aus unserer Lieblingsserie REN DHARK kennen, würde Wirklichkeit werden.
Falls die Studie Sie ebenfalls interessiert, liebe Leser, suchen Sie nach »Spelling interface using intracortical signals in a completely locked-in patient enabled via auditory neurofeedback training« von Ujwal Chaudhary, Ioannis Vlachos, Jonas B. Zimmermann et al. Auf der Internetseite von Nature Communications finden Sie auch zwei Videos, in denen Sie sehen können, wie der Proband den Computer steuert.
Düsseldorf, im März 2022
Anton Wollnik
Prolog
Am 21. Mai 2051 startet die GALAXIS von Terra aus zu einer schicksalhaften Reise in den Weltraum. Durch eine Fehlfunktion des »Time«-Effekts, eines noch weitgehend unerforschten Überlichtantriebs der Terraner, springt das Raumschiff über beispiellose 4.300 Lichtjahre. Genau einen Monat später erreicht es das Col-System, wo es auf dem Planeten Hope landet. Weil ein Weg nach Hause unmöglich erscheint, beschließen die Raumfahrer, auf dem Planeten zu siedeln, und gründen die Stadt Cattan.
Rico Rocco schwingt sich zum Diktator auf und lässt sämtliche Kritiker verfolgen und auf den Inselkontinent Deluge verbannen. Dieses Schicksal trifft auch den zweiundzwanzigjährigen Ren Dhark, seinen besten Freund Dan Riker sowie eine Reihe weiterer Terraner. Doch damit endet die Geschichte nicht. In einer Höhle entdecken die Verbannten nicht nur Artefakte einer mysteriösen fremden Hochkultur, sondern auch ein unvollendetes Raumschiff, das eine prägnante Ringform aufweist.
Nachdem Rico Rocco bei einem Angriff der Amphi umgekommen ist, wird Ren Dhark zum neuen Stadtpräsidenten Cattans gewählt. Er lässt den Ringraumer reparieren, welcher später von Pjetr Wonzeff auf den Namen POINT OF INTERROGATION, kurz POINT OF, getauft wird. Im April 2052 bricht der Ringraumer unter Dharks Kommando zu seinem Jungfernflug zur Erde auf. Damit beginnt ein neues Kapitel in der terranischen Raumfahrt. Nicht zuletzt dank Dharks Forscherdrang entdecken die Menschen weitere Hinterlassenschaften der Mysterious, die es ihnen ermöglichen, neue Ringraumer zu bauen und immer weiter in die Tiefen des Weltraums vorzudringen. Die POINT OF jedoch bleibt trotz allem einzigartig, was nicht zuletzt am Checkmaster liegt, dem eigenwilligen Bordgehirn dieses Raumschiffes.
Ren Dhark bleibt der Kommandant der POINT OF und erforscht mit seiner Mannschaft in den folgenden Jahren nicht nur das Weltall, sondern rettet auch immer wieder die Menschheit und sogar ganze Galaxien. Im Mai 2074 lässt sich der unvermutet aktivierte Schutzschirm um Terra nicht mehr abschalten. Die Erde ist damit vom Rest des Universums isoliert. Niemand ahnt, dass es sich in Wahrheit um einen von den Thanagog installierten Zweitschirm handelt, um Ren Dhark zu einer Reise nach ERRON-3 zu bewegen. Dort wollen sie in den Besitz des Schebekaisen gelangen, eines Artefakts, das mutmaßlich von den Balduren stammt. Ihr Plan geht auf. Doch auch andere Expeditionsteilnehmer bedienen sich zu Dharks Leidwesen fleißig im zentralen Wissensarchiv der Worgun, allen voran Terence Wallis’ Sicherheitsberater Arjun Chatterjee.
Zurück in der Milchstraße zeigen die Thanagog ihr wahres Gesicht: Dabei kommt nicht nur die Wahrheit über den angeblich entarteten Schutzschirm um Terra heraus, sondern auch, dass die transitierende Sonne eigentlich das Mutterschiff der Schemenhaften ist. Bei dem Versuch, das Artefakt der Balduren von den Thanagog zurückzuholen, wird Ren Dhark Zeuge davon, wie die Wächter den Kern des Sonnenschiffes und damit die Lebensgrundlage eines ganzen Sternenvolkes zerstören. Shamol, der Herrscher der Thanagog, vernichtet das Schebekaisen und wendet sich in seiner Verzweiflung an Dhark. Er habe das alles nur getan, um sein Volk vor der buchstäblichen Auflösung zu bewahren. Weil die Erde nicht mehr in Gefahr schwebt, willigen der Commander und seine Experten ein zu helfen. Die Thanagog können gerettet werden, indem sie zu einem Megawesen verschmelzen, und fliegen in die Weiten des Weltraums hinaus.
Kurz darauf verschwindet Arjun Chatterjee mit dem worgunschen Wegweiser sowie den entwendeten Daten aus ERRON-3. Auf Bitte von Terence Wallis sucht Ren Dhark diskret nach ihm, denn der Inhalt der gestohlenen Speicherkristalle darf auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. Auf einem vereisten Planeten entdeckt Chatterjee währenddessen die Hinterlassenschaften eines Sternenvolkes, das anscheinend den Balduren begegnet ist …
1.
Als Jos Aachten van Haags Bewusstsein langsam zurückkehrte, war das Erste, was er spürte, ein dumpfer Schmerz, der durch jede einzelne Muskelfaser seines Körpers pulsierte. Er stöhnte leise. Seine Gedanken bewegten sich zäh, als wäre sein Schädel mit Teer gefüllt. Kopfschmerz hämmerte gegen seine Schläfen. Er lag mit dem Rücken auf dem Fußboden, seine Fingerkuppen erfühlten Teppichfasern.
Plötzlich stieß etwas heftig in seine rechte Rumpfseite. Seine Instinkte schrien auf, wollten ihn die Augen aufreißen lassen, aber etwas klebte diese zu. Er wollte gleichzeitig aufspringen, doch seine Muskeln versagten ihm den Dienst, zuckten nur einmal schwach. Verstärkter Schmerz, ausgelöst durch die versuchte Bewegung, jagte als Welle über ihn hinweg und ließ ihn neuerlich aufstöhnen. Das Objekt erreichte durch den künstlichen Fettanzug nicht seine Rippen.
Er brauchte einige Augenblicke, ehe er begriff, warum seine Muskeln ihm den Dienst versagten. Das mussten die Nachwirkungen des Parastrahls sein, den Brent Cavendish auf ihn abgefeuert hatte. Rauschen aus dem Hintergrund drang an sein Ohr, welches immer mehr die akustische Gestalt von Stimmen annahm, je mehr seine Gedanken die Ohnmacht abschüttelten. Die Sprechenden befanden sich direkt über ihm. Die Worte klangen gedämpft zu ihm durch, als würden sie unter Visieren hervordringen. Der harte Unterton war jedoch nicht zu überhören.
»Vielleicht sollten wir ihm ein paar Ohrfeigen verpassen, damit er schneller zu sich kommt?«, schlug eine Männerstimme vor.
»Lassen Sie das!«, kam die Antwort in schneidendem Tonfall. »Wenn er eine Gehirnerschütterung hat, werden Schläge das Ganze noch verstärken und die Vernehmung erschweren. Und behalten Sie Ihren Stiefel bei sich!«
Der Druck in van Haags Seite verschwand.
Vernehmung, dachte er träge, und leise Unruhe machte sich in ihm breit, kämpfte sich durch die geistige Benommenheit, die als Reste der Bewusstlosigkeit seine Sinne benebelten. Gleichzeitig begann er seinen Körperzustand immer mehr wahrzunehmen. Diese Schmerzen sind nicht nur die Nachwirkungen des Parastrahls, sondern auch die der blutigen Prügelei. Cavendishs Schläge und Tritte waren wirklich brutal. Wie viel hat der Fettanzug meiner Tarnung von seinen Attacken abmildern können? Wie schwer bin ich verletzt?
Erneut kämpfte er gegen die schweren Lider an. Das linke Auge blieb halb geschlossen; etwas verklebte den Lidrand.Das rechte Auge öffnete sich indes gänzlich – und blickte in den Lauf eines Multikarabiners. Die Waffe schwebte nur wenige Zentimeter vor seinem Gesicht.
»Keine falsche Bewegung!«, warnte der Bewaffnete.
Die langsam klarer werdenden Gedanken des Geheimagenten begannen zu rasen. Um ihn herum standen dunkel gekleidete Männer, die finster auf ihn herabblickten. Zumindest glaubte er das, denn er nahm sie nur verschwommen wahr. Sein Blick schärfte sich nur allmählich. Allerdings hatte er bereits Besuch von solchen Gestalten bekommen, die ihn anschließend abgeführt und zu Madame Friedel gebracht hatten. Vor wenigen Wochen hatte die Dame ihn als Mitarbeiter angestellt. Was diese Einheit jetzt zu ihm führte, ließ sich nicht sagen, doch die bedrohliche Atmosphäre war überdeutlich.
»Bitte … nicht schießen«, stieß van Haag hervor. Die Worte kamen nur stockend über seine Lippen, die Zunge fühlte sich pelzig an. Sich ergebend hob er beide Hände, was jedoch nicht so recht gelang, denn seine Arme bebten vor Anstrengung. Dabei bemerkte er die aufgerissenen Fingerknöchel vom Faustkampf gegen Cavendish. »Ich bin John McFurry … ich wohne hier!«
Falls die Schwarzgekleideten seinem »hier« widersprachen, hatten sie ihn aus McFurrys Apartment geschafft. Doch niemand korrigierte ihn.
Seine aufgeplatzten Lippen schmerzten beim Sprechen, und er schmeckte Blut. Mit der Zunge fuhr er rasch die Vorderzähne entlang. Keiner war locker.
Wenigstens wird meine Heldenstatue im GSO-Hauptquartier nicht mit einer Zahnlücke aufgestellt, dachte er mit Galgenhumor.
Eine der verschwommenen Gestalten machte ein Geräusch, das nach Ungeduld klang. »Helft ihm auf die Beine!«, sagte der Mann befehlsgewohnt. Vielleicht der Anführer des Trupps.
»Ich wurde überfallen«, setzte van Haag erneut an, diesmal mit stärker weinerlichem Tonfall, wie man es von seinem Alias John McFurry erwarten würde.
Sogleich wurde er an den Armen gepackt und hochgehievt. Der Lauf des Multikarabiners vollzog die Bewegung nach und zielte weiterhin auf sein Gesicht. Die Schwarzgekleideten stellten ihn aufrecht hin, aber seine Beine waren wabbelig wie Wackelpudding, sodass sie ihn stützen mussten.
»Bitte seien Sie vorsichtig«, jammerte der angebliche Systementwickler wie ein Häufchen Elend. »Ich bin schwer verprügelt worden …« Gespielt verängstigt blickte er auf die Waffe. »Warum tun Sie das? Warum zielen Sie auf mich? Ich bin der Bewohner dieses Apartments! Das habe ich doch gerade gesagt! Sie zielen auf den falschen Mann, der Eindringling …«
»Sie sind die einzige Person, die wir hier gefunden haben«, unterbrach ihn der mutmaßliche Anführer des Einsatzteams. Der breitschultrige Mann war genauso groß wie van Haag und trug wie alle seine Männer einen tiefschwarzen Kampfanzug mit ebenso dunkler Schutzweste.
Mit einer Geste deaktivierte er seinen Helm, welcher sich im Nacken zusammenfaltete und ein strenges, kantiges Gesicht mit langsam ergrauendem Haar entblößte. Stahlgraue Augen richteten sich scharf auf McFurry.
»Der Einbrecher ist weg?«, hauchte McFurry gespielt erleichtert und ließ sich halb in die ihn festhaltenden Arme fallen. »Bei den Sternen … er ist bestimmt geflohen, weil er wusste, dass der Sicherheitsdienst kommt.«
Mit dieser indirekten Frage hoffte er, an mehr Informationen zur Identität der Gestalten in den schwarzen Kampfuniformen und zu seiner Situation zu gelangen. Er erhielt zwar keine Antwort, vermutete jedoch, dass es sich um Madame Friedels Leute handelte.
Jos hustete. Sein Zwerchfell zog sich dabei schmerzhaft zusammen. Die Grimasse brauchte er nicht zu spielen. Nun, da er sich in der Senkrechten befand, spürte er, wie warme Flüssigkeit aus seinen Nasenlöchern über seine Oberlippe lief. Cavendishs brutale Schläge hatten ihn schwer getroffen, besonders jener gegen den Kopf, auch wenn er diesen halb hatte abwehren können. Er fühlte sich jämmerlich, und äußerlich musste er erbärmlich aussehen – was ihm für seine Rolle als Häufchen Elend jedoch zupasskam.
»Kann ich mich bitte setzen? Mir tut alles weh«, flehte McFurry und stützte sich dabei absichtlich schwer auf die ihn gepackt haltenden Arme, um seinen hilflosen Eindruck zu verstärken, obgleich seine Kräfte langsam zurück in seine Glieder krochen.
In meinem derzeitigen Zustand kann ich nicht kämpfen, begriff er, während er von allen Seiten beobachtet wurde. Eine Flucht vor dieser Kampfeinheit war unmöglich. Nun würde sich zeigen, wie gut die von seinen GSO-Kollegen erstellte Tarnung einer Überprüfung standhielt. Dabei stellte sich jedoch eine wichtige Frage: Wie sehr hatte seine Verkleidung als pummeliger John McFurry unter der Prügelei mit der Beulenpest gelitten? Niemand machte Anstalten, ihm die Verkleidung vom Leib zu reißen. Vermutlich bedeckte der blutbesudelte, stellenweise zerrissene Schlafanzug den möglicherweise beschädigten Fettanzug hinreichend. Zumindest wagte van Haag das zu hoffen.
Der Anführer des Einsatztrupps musterte McFurry eingehend mit diesen grauen Augen, die wie glatte Metallscheiben wirkten, und nickte schließlich knapp in Richtung der Männer, die das vermeintliche Pummelchen festhielten. »Setzen Sie ihn auf das Sofa.«
»Vielen Dank, Sir«, buckelte der Verletzte. »Ich danke Ihnen.«
Seine beiden Wächter verfrachteten ihn zur ledernen Sitzgelegenheit, wobei sie darauf achteten, um den zerschlagenen Glastisch zwischen den Sitzmöbeln einen Bogen zu machen.
»Da hat der Wahnsinnige mich reingeworfen«, stöhnte van Haag alias McFurry mit Blick auf die Glasscherben und bemerkte aus den Augenwinkeln, wie der Multikarabiner, der bislang auf ihn gerichtet gewesen war, auf eine Befehlsgeste des Anführers hin halb gesenkt wurde.
»Setzen Sie sich einfach hin«, befahl der Breitschultrige anschließend mit stahlharter Stimme, als hätte er einen Verdächtigen vor sich.
Er scheint mir zu misstrauen, ging es van Haag durch den Kopf. Zweifelt er an meiner Behauptung, dass ich das Opfer sei? Wenigstens sah es nicht danach aus, dass man ihn sofort hinrichten wollte.
Der Anführer trat mit eiserner Miene an den vermeintlichen Systementwickler heran. Glasscherben knirschten unter seinen schweren Stiefeln. Van Haag musste nun zu ihm aufblicken und gab sich angemessen eingeschüchtert.
Sekunden verstrichen, in denen der Mann sein Vernehmungsobjekt in Grund und Boden starrte. Schließlich wirkte er zufrieden mit dem Resultat seiner einführenden Einschüchterungstaktik, denn er befahl einem seiner Leute, etwas zum Abwischen für die Nase des Verletzten zu besorgen.
Kurz darauf bekam McFurry ein Kunstfasertuch aus der Küche in die Hand gedrückt. »Danke«, nuschelte er und tupfte sich vorsichtig das Blutrinnsal von Oberlippe, Nase sowie anderen Wunden im Gesicht. Dabei tastete er behutsam nach der Nasenwunde und fühlte dabei bereits angetrocknetes Blut. Er musste folglich schon eine Weile bewusstlos auf dem Boden gelegen haben, ehe er erwacht war.
Hatte Cavendish also schon Madame Friedels Hauptgebäude erreicht, um sie zu treffen? Dann wäre der leichtgläubige Bodybuilder wahrscheinlich längst tot oder Schlimmeres.
Das Ganze hatte wirklich den schlimmstmöglichen Weg genommen.
Das Atmen verursachte Jos kleine Stiche im Brustkorb. Im Rückenbereich fühlte er stellenweise ein schmerzhaftes Ziehen, wenn er sich bewegte. Diese Schmerzensstiche hielten sich jedoch in Grenzen. Wahrscheinlich handelte es sich dabei nur um blutverkrustete Schnitte, verursacht durch den Glastisch, in den Cavendish ihn geschleudert hatte, und keine darin steckenden Glassplitter. Alles in allem schien der Fettanzug ihn vor wirklich ernsthaften Verletzungen bewahrt zu haben. Das Schwindelgefühl hatte weitgehend aufgehört, und die Nebenwirkungen des Parastrahls ebbten ebenfalls bereits ab.
»Ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen«, ergriff der Anführer der Bewaffneten erneut das Wort, »und Sie werden wahrheitsgemäß antworten. Lassen Sie nichts aus. Machen Sie sich und uns keine Schwierigkeiten.«
McFurry nickte schwach und presste sich das Kunstfasertuch an die Nase, die glücklicherweise nicht gebrochen war. »Ich will Ihnen doch keine Schwierigkeiten machen, Sir. Ich versichere Ihnen meine vollste Unterstützung«, versprach er mit leidendem Unterton. »Ich sage Ihnen natürlich alles, was Sie wissen wollen. Sie müssen unbedingt diesen Wahnsinnigen fassen, der mich überfallen hat. Schließlich sind Sie zu meinem Schutz hier, nicht wahr?«
Während er sprach, versuchte er, seine Schmerzen in einen hinteren Winkel seines Bewusstseins zu schieben, um sich besser konzentrieren zu können. Das würde er nicht lange durchhalten können, aber doch lange genug, um nicht seine Tarnung zu verlieren und etwas zu sagen, das einen unbeabsichtigten Angriffspunkt bot.
Van Haags Sicht hatte sich mittlerweile so weit geklärt, dass er das Chaos um sich herum wahrnehmen konnte – und die Anzahl der Männer, die sich in seinem Apartment umsahen. Es waren ein halbes Dutzend. Ein paar von ihnen standen nahe bei ihrem Anführer. Ihre Multikarabiner waren zwar nicht direkt auf den Systementwickler gerichtet, wurden aber derart offen präsentiert, als wollte man, dass er die Waffen sah.
»Wir sind in der Tat zum Schutz hier«, antwortete der Truppenleiter auf McFurrys Frage. Er präzisierte jedoch nicht, ob er damit den Schutz des Verletzten meinte oder ob sie hier waren, um Störenfriede für Madame Friedel auszuschalten. »Sie werden nun im Detail alles berichten, was sich hier zugetragen hat, Mister McFurry, damit der Fall rekonstruiert werden kann. Beginnen Sie mit Ihrem Besuch.« Auch hier sagte er nicht, welchen Besuch er meinte – jenen der Frau oder den von Cavendish.
Van Haag bezweifelte nicht, dass sein Gegenüber von beiden wusste. Wenigstens schien dieser anzunehmen, dass er wirklich McFurry war.
Der vermeintliche Systementwickler ließ seine Schultern sinken, als würde er sich gutgläubig entspannen, als er das Wort »Schutz« hörte. »Ich werde Ihnen alles berichten, damit Sie dem Verbrecher das Handwerk legen können«, versicherte er erneut seine Unterstützung und stöhnte dann besonders laut auf. »Dürfte ich nur vorher bitte eine Schmerzkapsel haben? Ich halte das kaum noch aus, die Schmerzen sind wirklich schlimm, vor allem diese Kopfschmerzen … jetzt, wo Sie vom Sicherheitsdienst hier sind, kann mir ja nichts mehr passieren, oder?«
Der Anführer brummte etwas Unverständliches und ließ dann nach kurzem Schweigen McFurrys Bitte erfüllen, welcher sich erneut überschwänglich bedankte und die Schmerzkapsel mit etwas Wasser im gereichten Glas herunterschluckte.
Wenige Momente später wirkte die schmerzlindernde Substanz an den Nervenrezeptoren und ließ den Verletzten aufatmen. »Schon viel besser«, seufzte er.
»Dann beantworten Sie nun die Frage«, verlangte der Vernehmer. »Sie hatten Besuch. Also?«
»Ich hatte sogar zweimal Besuch«, korrigierte McFurry scheinbar gewissenhaft und holte absichtlich weit aus. »Alles begann mit dieser wunderschönen Frau. Ich habe die vergangene Nacht mit ihr verbracht. Das war die beste Nacht meines Lebens, das können Sie mir glauben!
Die Frau war so gar nicht mit meiner baldigen Ex-Frau vergleichbar – im positiven Sinne! Wenn ich nur an diese Furie auf Babylon denke, kriege ich Gänsehaut.«
»Bleiben Sie bei der Sache, McFurry.«
»Äh, natürlich, entschuldigen Sie. Also, der Frau bin ich schon vorher begegnet. Unser erstes Näherkommen erfolgte im Kasino, wo ich das erste Mal ihre Aufmerksamkeit beim Schwingen meines Tanzbeins erregte. Ich bin ein wirklich guter Tänzer, müssen Sie wissen, und …«
Eine ungeduldige Geste unterbrach den plappernden Redefluss. »Was wissen Sie über diese Frau? Name?«
»Sie hat sich mir nicht vorgestellt«, bedauerte McFurry und deutete auf seine rundliche Statur, die den blutbesudelten, stellenweise zerrissenen Schlafanzug wölbte. »Alles, worum es ihr ging, war mein Körper. Und ich war ehrlich gesagt viel zu überwältigt von ihr, um nach ihrem Namen zu fragen. Sie fühlte sich im Kasino so angezogen von mir, dass sie herausfand, wo ich wohne, und mich aufsuchte. Mann, wie scharf die auf mich war …«
Der Anführer des Kampftrupps schnitt ihm abermals mit einer Geste das Satzende ab. Seine Miene machte den Eindruck, als hätte er McFurry am liebsten am Kragen gepackt und die wichtigen Informationen aus dem nervigen Wortwasserfall herausgeschüttelt. »Bleiben Sie bei den wichtigen Details«, mahnte er. »Schildern Sie den Überfall. Hat die Frau etwas damit zu tun?«
»Ich wollte gerade dazu kommen …«
»Dann tun Sie das, Mister McFurry.«
»Natürlich, Sir.« Der vermeintliche Systementwickler nickte, tupfte wieder an der Nasenwunde herum, betrachtete kurz das blutige Kunstfasertuch – alles, um noch ein paar Sekunden zu schinden. Das Plappern hatte ihm die notwendige Zeit verschafft, nachzudenken. Er musste sich entscheiden, ob Liv Sanders womöglich mit Madame Friedels Wissen manipuliert worden war oder nicht, denn das beeinflusste, was er erzählen musste, um das Verhör zu überstehen.
Sollte er zugeben, dass die Frau den Safe gewaltsam geöffnet hatte? Das würde die unbeholfene Ex-Polizistin jedoch unnötigerweise in Madame Friedels Fokus setzen, falls diese Verbrecherin nichts mit der Manipulation zu tun hatte und somit nichts von Livs Diebstahl wusste.
Oder sollte van Haag sich für die zweite Variante entscheiden und Cavendish alles unterschieben? Sollte Madame Friedel für die Manipulation von Liv verantwortlich sein, hatte auch dieser Kampftrupp davon Kenntnis, und dann wäre van Haags Tarnung bedroht, falls er sich für die zweite Option entschied.
Allerdings könnte er die Lüge, sollte sie denn auffliegen, damit begründen, dass es McFurry peinlich sei, von einer zierlichen Frau überfallen worden zu sein, die gar nicht seinen Körper begehrt hatte, sondern den Inhalt seines Safes.
»Es war schrecklich«, brach es gespielt unglücklich aus ihm heraus, während er wieder das Kunstfasertuch an die nur noch schwach blutende Nase presste. Er traf seine Entscheidung. »Leider verließ die Frau mich kurz darauf, was ich sehr bedaure. Ich hätte zu gern mehr Zeit mit ihr verbracht.« Als er weitersprach, verzerrte sich seine Miene. »Und dann … klopfte es urplötzlich an der Tür. Bei den Sternen, ich hätte nicht öffnen sollen!«
Van Haag beobachtete jede Regung der Mimik seines Gegenübers. Dort zeigte sich nichts, das verriet, dass die Lüge erkannt worden war, was jedoch nichts heißen musste.
»Sie öffnen nachts einfach die Tür, wenn jemand klingelt?«, hakte der Vernehmer nach. »Haben Sie Ihren zweiten Besuch etwa erwartet?«
»Nein! Wo denken Sie hin? Es war ja schließlich mitten in der Nacht! Ich dachte, meine Traumfrau wäre zurückgekommen, deshalb habe ich nicht vorher die Außenkamera aktiviert, um zu sehen, wer vor meiner Tür steht. Ich dachte, sie hätte es sich anders überlegt. Wie sehr ich mich da irrte … Ich öffnete also die Tür, da wurde ich schon zurückgestoßen, und ehe ich mich versah, drang ein muskelbepackter Hüne in mein Apartment ein! Er überfiel mich, bedrohte mich mit einer Waffe!« McFurry schluckte schwer, als würde er mit der schrecklichen Erinnerung kämpfen.
»Was wollte er?«, verlangte der Vernehmer zu wissen.
»Er wollte mich zwingen, Informationen über Madame Friedels Organisation und irgendwelche Silberwürmer preiszugeben«, antwortete McFurry und rang die Hände. »Er war überaus aggressiv und fordernd, als wäre er auf einer fanatischen Mission. Bei dem waren eindeutig irgendwelche Sicherungen im Hirn durchgebrannt!«
»Haben Sie ihn erkannt?«
Jos hörte den lauernden Unterton. »Natürlich!«, sagte er wahrheitsgemäß und log dann weiter: »Ich wusste sofort, dass dieser Muskelprotz der amoklaufende Bodybuilder sein musste, der überall gesucht wird. Erzählungen über ihn hört man an jeder Straßenecke. Wie sollte ich das nicht mitbekommen?«
Der Anführer des Kampftrupps betrachtete McFurry eingehend, als würde er etwas in dessen Miene suchen. »Sie sind ihm vorher noch nie begegnet?«
»Nein, an diesen Wahnsinnigen würde ich mich erinnern.«
»Also gehört er nicht zu Ihren Kontakten, die Sie geschäftlich unterhalten? Als … Systementwickler?« Das letzte Wort betonte der Vernehmer auf merkwürdige Art.
Das soll wohl eine Anspielung auf John McFurrys Hackeraktivitäten sein, erkannte van Haag. »Nein, ich hatte diesen aggressiven Kerl zuvor noch nie gesehen.«
»Dann hatten Sie wohl bisher Glück. Dieser riesige Muskelprotz ist also bei Ihnen eingedrungen, sagen Sie, und er hat Sie bedroht. Wieso haben Sie zu keiner Zeit den Sicherheitsdienst alarmiert?«
McFurry gab sich verzweifelt. »Ich wollte schon Hilfe rufen, aber die Waffe … ich fürchtete, der Kerl würde mich einfach niederschießen. Dann verlangte er auf einmal, dass ich mich bei Madame Friedel einhacken soll. Er drohte mir an, mir alle Knochen zu brechen, wenn ich ihm nicht gehorche. Er beschrieb, wie sehr das schmerzen würde und empfahl mir, das nicht ausprobieren zu wollen. Und wenn ich nach der Folter dann immer noch nicht gehorche, sagte er, würde er mich töten. Ich hatte Todesangst, Sir!«
»Und dann haben Sie mit ihm zusammengearbeitet?«
»Was? Nein!«, wehrte McFurry mit aufgerissenen Augen ab. »Ich bin Madame Friedels Sicherheitsberater! Ich bin ein loyaler Arbeitnehmer, das wäre sonst schlecht für meine Reputation in meinem Metier. Außerdem respektiere ich Madame Friedel und ihre Arbeit, weshalb ich sie niemals betrügen würde. Das würde meiner Gesundheit ohnehin auch schlecht bekommen. Und darüber hinaus habe ich gar nicht verstanden, was dieser Irre genau von mir wollte.«
»Hat er denn erwähnt, welche Informationen Sie besorgen sollen?«
»Eben nicht, deshalb habe ich sein Anliegen ja auch nicht verstanden. Und als er nicht zu seinem Willen kam, sollte ich plötzlich meinen Safe für ihn öffnen. Ich habe mich geweigert …« McFurry stockte, als quälte ihn allein der Gedanke an diese Erinnerung. »Da rastete der Kerl von einer Sekunde auf die andere vollkommen aus. Er schrie etwas von Silberwürmern und dass ich es bereuen würde, ihm nicht zu helfen, und … und begann erbarmungslos auf mich einzuprügeln. Ich habe mich gewehrt, so gut ich es vermochte.«
»Was für Silberwürmer?«
»Keine Ahnung! Der schrie etwas von einer Invasion der Silberwürmer. Der hatte nicht mehr alle Tassen im Schrank!«
Der Anführer nickte langsam und betrachtete McFurry mit verengten Augen. »Statt Hilfe zu rufen, haben Sie also lieber den Kampf mit ihm aufgenommen. Habe ich das richtig verstanden? Dafür, dass das eine brutale Prügelei mit einem bewaffneten Amokläufer gewesen ist, sind Sie ja noch mal glimpflich davongekommen. Glück gehabt, könnte man meinen.«
Glaubt er, die verwüstete Wohnung sei gestellt?, fragte sich Jos unwillkürlich. »Das war kein Glück, ich habe zurückgeschlagen«, antwortete er in einem gespielt grimmigen Tonfall und ließ das blutige Kunstfasertuch sinken. Das Nasenbluten hatte aufgehört. »Ich habe ihn mit Schlägen bearbeitet, wann immer ich es konnte. Ich habe geschrien, aber niemand kam zu Hilfe. Und der Muskelprotz ließ nicht von mir ab, prügelte auf mich ein. Wie sollte ich da einen Notruf tätigen?« McFurry hob seine blutigen Fingerknöchel. »Ich konnte nur ausweichen und austeilen. Was der Kerl an Muskelmasse hatte, habe ich versucht, mit meinem Gewicht zu kompensieren – und mit meiner Flinkheit.
Der Bodybuilder hatte nämlich eindeutig mit seinem Training übertrieben. Vielleicht war das mein Glück. Er hatte zwar eine wuchtige Statur, war aber dadurch in seinen Bewegungen eingeschränkt. Deshalb sieht die Wohnung auch so verwüstet aus.
Ich habe alles versucht, um den Schlägen dieses Wahnsinnigen zu entgehen. Und ich hätte den Mistkerl wirklich fast besiegt! Aber dann hielt er plötzlich einen Paraschocker in der Hand und schoss mich nieder. Ich kann froh sein, dass er bloß mit einer paralysierenden Waffe auf mich zielte …«
Eine Weile starrten diese metallfarbenen Augen van Haag an, in der Miene des Vernehmers arbeitete es. Der Geheimagent tat gelassen, als hätte er nichts zu verbergen.
»Ich frage mich«, sagte der Uniformierte langsam, »woher dieser Muskelprotz wusste, wo Sie wohnen und wann Sie zu Hause sind, Mister McFurry. Haben Sie dazu eine Vermutung?«
Alle seine Fragen sind merkwürdig gestellt, als würden sie einen doppelten Boden verbergen. Glaubt er etwa wirklich, ich hätte mich mit Cavendish hier verabredet?
McFurry zuckte ratlos mit den Schultern, ehe er antwortete: »Ich gehe jeden Tag denselben Weg zur Arbeit und zurück. Ich dachte nie daran, dass mir jemand folgen könnte. Ich dachte, Madame Friedels Viertel wäre sicher.« In den letzten Worten ließ er einen leisen Vorwurf mitschwingen, weil er zuvor die Vermutung geäußert hatte, er würde denken, den Sicherheitsdienst vor sich zu haben. »Warum wollen Sie wissen, wie er mich gefunden hat?«
»Wie gesagt, diese Vernehmung dient dem Zweck, den Fall des Amokläufers zu rekonstruieren und seine Bewegungsmuster nachzuvollziehen. Hat er gesagt, wo er war, ehe er Sie aufsuchte?«
»Nein. Alles, was er zu mir gesagt hat, habe ich Ihnen erzählt.«
»Er erwähnte auch nicht, wohin er gehen wollte?«
McFurry verneinte erneut.
»Bedauerlich. Was war in dem Safe?«
»Wie bitte?«
Die Miene des Vernehmers verhärtete sich. »Sie haben die Frage verstanden, Mister McFurry. Sie sagten, der Eindringling habe von Ihnen verlangt, Ihren Safe zu öffnen. Was befand sich darin, dass er unbedingt den Inhalt sehen wollte?«
Der vermeintliche Systementwickler mit dubioser Vergangenheit auf Babylon leckte sich zögerlich über die Lippen. »Darin war ein Großteil meiner Ersparnisse, mehrere Tausend Credits, ein Handnadelstrahler … und für mich sehr wertvolle Speicherkristalle mit sensiblen Daten, weshalb ich auf den besten Safe bestanden habe.«
Sobald er die Aufzählung beendet hatte, veränderte sich sein Gesichtsausdruck, als wäre ihm bei seinen eigenen Worten plötzlich etwas wie Schuppen von den Augen gefallen. »Moment mal, warum sprechen Sie von dem Inhalt meines Safes in der Vergangenheitsform?«
»Ich bedaure, Ihnen sagen zu müssen, dass der Safe bis auf wenige Credit-Chips vollkommen ausgeräumt wurde.«
»W… was? Der Safe ist leer?« McFurry öffnete und schloss fassungslos den Mund. »Die Speicherkristalle …?«
»Die Speicherkristalle, der Handnadelstrahler sowie vermutlich auch die meisten Ihrer Credit-Chips sind verschwunden«, zählte der Anführer auf und beobachtete McFurry dabei aufmerksam.
Dessen Miene war noch einige Sekunden ein Schauspiel der Fassungslosigkeit, dann schien er zu begreifen, was man ihm da gerade berichtet hatte. »Das kann nicht sein!«, polterte er los. Seine Worte begannen sich fast zu überschlagen, so aufgeregt sprudelten sie aus ihm heraus. »Meine Speicherkristalle sind weg? Alle? Das darf nicht wahr sein, bei den Sternen!«
»Was für Daten waren auf den Trägern gespeichert?«, hakte der Uniformierte nach. »Hatte es der Amokläufer darauf abgesehen?«
»Das waren sensible Geschäftsdaten«, antwortete McFurry prompt, als hätte er diesbezüglich etwas zu verbergen – ganz so, wie die Geschichte seines Alias von der GSO gestrickt worden war. »Und ich weiß nicht, ob die Speicherkristalle das Ziel dieses Amokläufers gewesen sind, aber vielleicht will er mich damit erpressen!«
Den von seinen GSO-Kollegen in die Welt gesetzten Gerüchten zufolge hatte der Systementwickler John McFurry auf Babylon einige krumme Dinger gedreht, und diese ließen vermuten, dass sich auf den Speicherkristallen diverse Daten diesbezüglich fanden. Entsprechend musste sich McFurry aufgewühlt geben.
Er sprang wutentbrannt auf. »Wie kann es sein, dass die Sicherheitsvorkehrungen dieses Hotels derart unterirdisch sind? Ich kann es nicht fassen!« Seine künstlichen Speckwangen bebten vor Zorn. Van Haag sollte eine Schauspieltrophäe erhalten. »Der Dieb muss sofort gefasst werden, ich brauche die Speicherkristalle umgehend wieder!«
»Beruhigen Sie sich.«
»Der Safe ist einbruchsicher, wurde mir versichert!«, wollte sich McFurry nicht bremsen lassen. »Es kann doch nicht sein, dass fast alles, was darin war, weg ist! Das glaube ich nicht!«
Der vermeintliche Systementwickler blickte zum Safe, machte einen kleinen Schritt vor. Als er nicht aufgehalten wurde, stieg er über die Glasscherben des Wohnzimmertisches und umrundete mit Abstand den Anführer des Kampftrupps, als wäre er nach wie vor eingeschüchtert von diesem.
Unter Beobachtung eilte McFurry an den Bewaffneten vorbei zum Safe und inspizierte mit gespielt verzweifelter Miene auch das Loch, das Liv Sander mit ihrem Duststrahler in die Safetür gebrannt hatte. Tatsächlich hatte sich Cavendish reichlich an dem bedient, was sie im Safe gelassen hatte. Wollte er mit den gestohlenen Credits noch mehr Waffen kaufen?
»Bei den Sternen«, flüsterte McFurry. Er drehte sich mit ringenden Händen zu dem Anführer des Kampftrupps um. »Es ist wirklich alles weg … meine ganzen Ersparnisse! Was mache ich denn jetzt? Wie kann es überhaupt passieren, dass in einem Hotel mit Sicherheitsdienst ein gesuchter Amokläufer einfach so hereinspazieren und meine Wohnung stürmen kann?«
»Wir werden der Sache nachgehen. Das sagte ich Ihnen bereits. Deshalb sind wir hier und stellen Ihnen diese Fragen.«
Der vermeintliche Systementwickler presste kurz die Lippen zu einem festen Strich zusammen und sagte dann hörbar vorwurfsvoll: »Es hätte gar nicht erst dazu kommen dürfen!«
»Wir sind hier, um die Sache aufzuklären.«
»Das ist gut, aber mein Besitz ist trotzdem verloren! Das darf nicht möglich sein! Ich werde die hiesigen Umstände keinesfalls auf sich beruhen lassen! Ich bestehe auf Schadensersatz von dem Verantwortlichen!« McFurry stampfte mit einem Fuß auf den Teppich, aber die wütende Geste zeigte durch die weichen Teppichfasern nicht die gewünschte akustische Nachdrücklichkeit. »Diese mangelnden Sicherheitsvorkehrungen sind nicht tolerierbar, vor allem nicht für mich! Schließlich bin ich Madame Friedels Sicherheitsberater! Was müssen Sie noch über den Wahnsinnigen wissen, der mich überfallen hat? Stellen Sie Ihre Fragen, ich muss mich jetzt um Sicherheitsangelegenheiten kümmern!«
»Ich beende unser Gespräch, nicht Sie«, stellte der Einsatzleiter des Kampftrupps mit gefährlich ruhigem Unterton klar.
McFurry schrumpfte bei dem Tonfall ein wenig zusammen, hielt aber das Kinn trotzdem oben, als glaubte er, dass er im Recht wäre. »Ich hatte nicht die Absicht, Sie zu unterbrechen, Sir. Ich wollte nur meiner Aufgabe als Sicherheitsberater von Madame Friedel nachgehen. Eine solche Sicherheitslücke, wie sie hier aufgetreten ist, muss sofort geschlossen werden. Es ist meine Pflicht, diese umgehend zu melden und mir das Sicherheitssystem dieses Gebäudes anzusehen. Welche Fragen haben Sie noch?«
Der Vernehmer ließ einen Augenblick verstreichen, als wollte er den vermeintlichen Systementwickler schmoren lassen. Er machte jedoch keine Anstalten, seinen Leuten zu befehlen, den aufgewühlten Dicken wieder auf das Sofa zu befördern. Schließlich sagte er: »Ich habe vorerst keine weiteren Fragen.«
»Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich darf keine Zeit verlieren! Wo ist mein Aktenkoffer? Ich werde mich jetzt bei Madame Friedel über die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen in diesem Hotel beschweren gehen. Der Verantwortliche dieses Gebäudes hat sträflich seine Aufgaben vernachlässigt und ihm sollte gekündigt werden!«
McFurry fand besagten Aktenkoffer wenige Sekunden später in der Ecke des Wohnzimmers direkt neben der Kommode und schnappte ihn sich. Dann ging er auf die Wohnungstür zu, vor der zwei der bewaffneten Gestalten mit ihren dunklen, für Zivilisten einschüchternden Kampfanzügen den Weg versperrten. Sie wichen nicht zur Seite. Er hielt inne und drehte den Kopf.
Der Anführer des Trupps blickte ihm fest in die Augen. »Wir werden jeden ergreifen, der in Madame Friedels Viertel Unruhe stiften will«, versprach er kryptisch.
Der vermeintliche Systementwickler warf einen letzten aufgewühlten Blick zum geplünderten Safe. »Ja, tun Sie das. Und fassen Sie den Amokläufer, damit wir alle wieder sicher sind!« Damit stürmte er mit seinem Aktenkoffer aus dem Apartment, nachdem die Bewaffneten zur Seite getreten waren. Deren Augenpaare folgten ihm. Sie glaubten wohl, dass das Pummelchen nicht mitbekam, dass er immer noch in dem blutbesudelten Schlafanzug steckte.
2.
Ein Streifen Sonnenlicht fiel auf Liv Sanders’ Augenlider und weckte die Geheimagentin aus ihrem traumlosen Schlaf. Mit ihrem erwachenden Bewusstsein meldeten sich auch pochende Kopfschmerzen. Leise stöhnend kniff sie die Augen zusammen und hob die Hand, um den Sonnenstrahl abzublenden. Als Reaktion auf die Bewegung meldeten sich Muskelschmerzen im Arm, dann im ganzen Körper, als sie sich zu regen begann.
Liv gab erneut einen leisen, gequälten Laut von sich und öffnete blinzelnd die Augen. Das Fenster ihres Hotelzimmers begrüßte sie. Auf der Fensterbank stand ein kleiner Kaktus mit roter Blüte. Eigentlich schien auf dieser Hausseite morgens keine Sonne. Erst zur Mittagszeit begannen die Sonnenstrahlen an der Fensteroberseite hervorzukriechen. Wie konnte es sein, dass sie zu dieser späten Tageszeit noch im Bett lag, ohne sich daran zu erinnern, die Nacht durchgemacht zu haben?
Verwirrt stemmte sie sich hoch und blickte prüfend an sich herab. Sie trug nicht ihr Nachtgewand, sondern nur Unterwäsche. Als sie den Kopf hob, sah sie das rote Abendkleid und die dazu passenden Stöckelschuhe scheinbar achtlos hingeworfen auf dem Teppichboden vor dem Bett liegen.
Mit gerunzelter Stirn rutschte sie zur Bettkante und erhob sich behutsam, als fürchtete sie, ihren Beinen nicht trauen zu können. Diese schmerzten zwar, trugen sie jedoch problemlos. Mit zusammengebissenen Zähnen tat sie einen Schritt nach dem anderen, steuerte das Bad an und begann ihre Gedanken zu ordnen.
Warum fühlt sich mein Körper so an, als hätte ich den schwersten Muskelkater meines Lebens? Sie sah in den Badezimmerspiegel, als könnte sie dort die Antworten finden. Was ist gestern geschehen? Eine hübsche Brünette mit Mandelaugen blickte zurück, die Miene schmerzerfüllt verzogen. Diese verdammten Kopfschmerzen!
Sie bückte sich und holte aus dem Badezimmerschränkchen unter dem Waschbecken, in dem ihr Kulturbeutel lagerte, eine kleine Dose mit Elektrolyt-Kapseln hervor. Die würden den Muskelkater lindern und das unangenehme Pochen im Kopf zurückdrängen, damit sie sich besser konzentrieren konnte. Eine der weißen Kapseln warf sie sich in den Mund, schluckte und spülte sofort mit etwas Wasser aus dem Wasserhahn nach.
Währenddessen dachte die Geheimagentin nach. Ihre Erinnerungen an den gestrigen Abend waren irgendwie verschwommen. Sie erinnerte sich noch daran, wie sie im »Casino Royale« mit Don Zisman, dem dubiosen Besitzer jenes Etablissements, angestoßen hatte.
Der Mann war Teil ihrer Ermittlungen für die Galaktische Sicherheitsorganisation. Bernd Eylers, der Chef der GSO, hatte sie auf Zisman angesetzt, da dieser möglicherweise mit Madame Friedel unter einer Decke steckte, welche unter Verdacht stand, Menschenexperimente mit Sensorium-Technologie auf Acheron drei durchzuführen.
Die Vermutung einer Zusammenarbeit zwischen Zisman und Friedel stand im Raum, da Ersterer als Kleinkrimineller des Slums auf einmal in den Mitarbeiterstab der Dame aufgenommen worden war und ein Kasino als scheinbares Willkommensgeschenk erhalten hatte. So ein steiler Aufstieg geschah nicht ohne Grund. Zisman musste irgendetwas getan haben oder etwas besitzen, das Friedels Aufmerksamkeit erregt und sie dazu gebracht hatte, ihn einzustellen, um ihre wie auch immer gearteten Ziele zu erreichen.
Livs Überlegungen kehrten zum gestrigen Abendablauf zurück, um eine Erklärung für die Muskelschmerzen zu finden.
Zisman hatte mich ins »Casino Royale« eingeladen. Ich machte mich schick, wie man es von einer gut bezahlten Geschäftsfrau erwartet, die angeblich auf etwas Exklusives in der Sensorium-Szene aus ist, und bin der Einladung gefolgt. Im Kasino hat mich Zisman anschließend wieder in den VIP-Bereich geführt, und wir haben mit Cocktails angestoßen. Besonders viel Alkohol habe ich aber nicht getrunken. Ich erinnere mich nur an zwei kleine Kegelgläser.
Eigentlich dürfte sie keinen Muskelkater haben. Aberwarum fühlte sie sich dann so gerädert, als hätte jemand sie mit einem Paraschocker paralysiert? Hatte ihr etwa jemand etwas ins Getränk gemischt? Möglicherweise Zisman selbst?
Hat er vielleicht ein ausreichend großes Zeitfenster schaffen wollen, um mein Hotelzimmer verwanzen zu lassen?
Unauffällig sah sie sich im Bad nach versteckten Kameras um, entdeckte jedoch nichts Auffälliges.Als Geheimagentin musste sie stets auf der Hut sein, vor allem, weil ihr jetziger Auftrag besonders heikel war. Immerhin war der Gegner niemand Geringeres als Madame Friedel, die bereits in der Vergangenheit gezeigt hatte, dass sie keine Skrupel kannte, für ihre Ziele über Leichen zu gehen.
Selbst wenn Liv sich noch nicht im Fokus der stets nett lächelnden, aber gefährlichen Dame befand, konnte Don Zisman oder irgendjemand in seinem Dunstkreis möglicherweise entschieden haben, Spionagetechnologie in Livs Hotelzimmer zu installieren.
Sanders weitete ihre Suche nach etwaigen Kameras und Wanzen auf das gesamte Hotelzimmer aus. Um nicht auffällig zu werden, falls sie beobachtet wurde, trat sie als Allererstes in die Küchennische und genehmigte sich eine heiße Tasse Kaffee aus dem Kaffeevollautomaten.
Dann schlenderte sie scheinbar gelassen mit der Tasse umher und schlürfte. Ihr geübter Blick streifte dabei über die gemütliche, luxuriös angehauchte Einrichtung aus lackiertem Dunkelholz auf Teppich sowie die cremefarbenen Wände mit dem Zierbild. All dieser Luxus täuschte leicht darüber hinweg, dass Madame Friedels Viertel lediglich eine Oase des Überflusses inmitten eines riesigen Slums war.
Beim Umhergehen hob sie mit der freien Hand das rote Abendkleid, das sie gestern getragen hatte, vom Teppichboden im Schlafbereich auf.
Zerknittert?, wunderte sie sich. Der Samtstoff wirkte, als wäre er regelrecht zerwühlt worden. Beunruhigt legte sie das Kleidungsstück auf das Bett und stellte die auf dem Boden liegenden Stöckelschuhe in den Schrank.
Weder im Wohn- noch im Schlafbereich kann ich Kameras entdecken. Zumindest werde ich nicht beobachtet. Das hieß jedoch nicht, dass da keine Spionagetechnologie irgendwo lauerte. Wenn es hier welche gibt, werde ich sie finden.
Liv stellte die Kaffeetasse auf die nächstbeste Ablagefläche und betrat erneut das blitzblanke Badezimmer. Sie bückte sich, langte mit beiden Händen unter den Badezimmerschrank und drückte auf der mittleren Keramikfliese die obere linke Ecke. Ihr Daumenabdruck wurde registriert. Die von ihren GSO-Kollegen ausgetauschte und mit Nanopartikeln versetzte Fliesenplatte begann, sich an der Oberfläche zu kräuseln. Dann sah es so aus, als würde sie auseinanderfließen. Ein Loch im Badezimmerboden entstand, das einen kleinen Hohlraum freigab. Von dort holte sie eine schwarze Tasche hervor, stellte diese vor sich ab und öffnete den Verschluss.
Liv nahm ihren AntiSpy74-Controller aus der Tasche und stellte ihn in der Mitte des Wohn- und Schlafbereichs auf dem Fußboden ab. Dieses Gerät gehörte zur Spionagetechnologie der Galaktischen Sicherheitsorganisation und diente dem Aufspüren von Wanzen sowie der Simulation von Abhörnachrichten. Die Geheimagentin hatte einen speziellen Lehrgang für dieses Gerät absolviert und war sehr geschickt im Umgang damit. Sie schaltete den Controller ein, woraufhin die Holo-Anzeige die umgebenden Räumlichkeiten als dreidimensionale Wireframes abbildete – eine Art Drahtmodel, das alle Wände und Gegenstände durchsichtig erscheinen ließ.
Die Empfangseinrichtung des Controllers war auf das gesamte Spektrum der bekannten Wanzenträgerfrequenzen abgestimmt, welches der Controller nun Frequenzband für Frequenzband abtastete. Einige Sekunden später zeigte er die entdeckten Wanzen positionsgenau als rot blinkende Kügelchen in den Wireframes an.
Einen Moment danach erschien neben jeder angezeigten Wanze auch der Wanzentyp.
Na, was haben wir denn da?
Der Controller konnte den Typ aus der Signatur ermitteln, die kontinuierlich mit der Wanzenträgerfrequenz gesendet wurde. Diese Signatur war Bestandteil der Verschlüsselung, mit der die Nachrichten an die Spionagezentrale übermittelt wurden und die dem Empfänger die Echtheit der Verbindung mit der Wanze garantieren sollte.
Wer auch immer mich abhört, wird nicht wissen, wie ihm geschieht, dachte Liv lächelnd, denn dass sie den Wanzentyp ermitteln konnte, brachte ihr nun einen entscheidenden Vorteil: Sie konnte jetzt mithilfe der Simulatorfunktion eine von ihr gewünschte Geräuschkulisse auf der korrekten Trägerfrequenz mit der korrekten Signatur senden, sodass die Gegenseite diese nicht von einer durch die Wanzen übertragenen Nachricht unterscheiden konnte.
Noch während Liv eine unverdächtige Zimmergeräuschkulisse aus der Audiobibliothek ihres eleganten Armbandviphos, das sich mit dem Controller verband, für die Übertragung auswählte, erschien jedoch unvermittelt neben jeder angezeigten Wanze eine Warnmeldung: »Audiosensoren der Wanzen nicht deaktivierbar.«
Liv starrte einen Augenblick lang auf die Holo-Anzeige des Controllers, bis ihr ein Licht aufging.
Der Wanzentyp! Es liegt am Wanzentyp! Diesen Typ kenne ich nur aus Aufzeichnungen, deshalb ist es mir nicht sofort aufgefallen. Das ist einer, der ein etwas antiquiertes Audiosensorkonzept verwendet, nämlich das Mikrofon.
Sie fluchte innerlich, denn ihr AntiSpy74-Controller war nicht hinreichend für diese primitive Technologie ausgelegt.
Vielleicht spekulierte der Verantwortliche der Wanzen darauf, dass sich heutzutage niemand mehr mit antiquierter Technologie beschäftigt und deshalb Schwierigkeiten hat, diese zu deaktivieren.
Sie lief mit ihrem Controller bei Aktivierung der Simulation Gefahr, dass der Versand von gefälschten Nachrichten unter Umständen bemerkt werden könnte. Dass ihr GSO-Gerät nicht auch auf alte Spionagetechnologien angepasst zu sein schien, empfand sie als einen Konstruktionsfehler. In diesem Fall konnten die Mikrofone nicht verlässlich deaktiviert werden.
Wäre sie mit ihrer fingierten Geräuschkulisse jetzt auf Sendung gegangen, dann hätte die Gegenseite an den Doppelgeräuschen sofort erkannt, dass etwas nicht stimmte. Oder schlimmer noch: Liv hätte womöglich Geheimnisse ausgeplaudert in dem Glauben, abhörsicher zu sein. Das wäre ein gefundenes Fressen für Jos Aachten van Haag gewesen, der sie nach wie vor für inkompetent hielt und solch einen Fehler ihrerseits möglicherweise dazu nutzen könnte, seinen Standpunkt diesbezüglich bei ihrem gemeinsamen Vorgesetzten Bernd Eylers zu untermauern.
Liv betrachtete grimmig die vier roten Punkte, die gleichmäßig im Raum verteilt leuchteten, und überlegte, wie sie diese in einer für die Gegenseite nicht feststellbaren Weise manipulieren könnte.
Also gut, was weiß ich noch über diesen Wanzentyp?Ich muss irgendwie die Membranen der Mikrofonkapseln am Schwingen hindern. Dann können sie keine Schallwellen aus dem Zimmer mehr aufnehmen, dachte sie und tippte sich nachdenklich an den Schmollmund. Sie musste die Membranen gewissermaßen leicht eindrücken und damit unter mechanischer Spannung halten. Ultraschall im Bereich von etwa fünfundzwanzig Kilohertz könnte das leisten. Die Schwingungen wären unhörbar und würden die Membran aufgrund ihrer Masseträgheit aus ihrer Nullposition herausdrücken und dort festhalten.
Ihr Blick fiel gedankenverloren auf den als Lampe getarnten Raumluftbefeuchter, der auf einem kleinen Beistelltischchen neben der Couch stand. In seinem Gehäuse schwebte ein dichter, weißer Nebel, der durch ein sanftes Lichterspiel in Regenbogenfarben von innen heraus zu glühen schien, als würde sich darin ein planetarischer Nebel befinden.
Ein triumphierendes Grinsen huschte über Livs Mundwinkel.
Ultraschallvernebler versetzten eine Wassersäule mithilfe eines Quarzes derart in Schwingung, dass sich kleine Wassertröpfchen millionenfach von der Wasseroberfläche lösten und als Schwebeteilchen diesen typischen Nebel bildeten. Die Dichte des Dunstes konnte bei diesen Geräten mittels eines Drehreglers, der die Schwingfrequenz des Quarzes zwischen vierundzwanzig und fünfundzwanzig Kilohertz variierte, eingestellt werden.
Genau das, was ich brauche!
Liv nahm ihren Werkzeugsatz aus der Agententasche, trat auf den Sofatisch zu, ließ sich dort in die Hocke sinken und baute den Raumluftbefeuchter auseinander. Geschickt legte sie den Schwingquarz mit der Hochfrequenzoszillatorplatine frei.
Jetzt brauche ich noch einen geeigneten Resonanzkörper, der die Ultraschallschwingung des Quarzes aufnehmen und dann um ein Vielfaches verstärkt in den Raum abstrahlen kann, überlegte sie und hatte dabei bereits etwas Konkretes im Sinn. Sie erinnerte sich an einen relativ dünnen, scheibenförmigen Keramikuntersetzer, wie man ihn zum Abstellen heißer Gefäße verwendete. Der könnte in ihrem Sinne funktionieren.