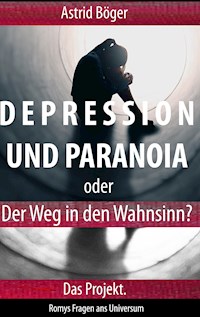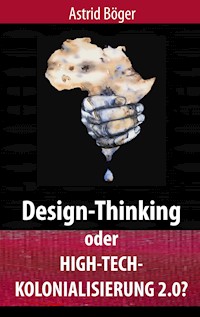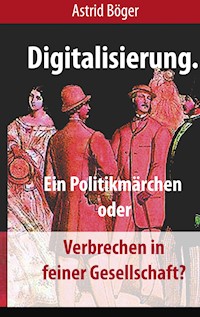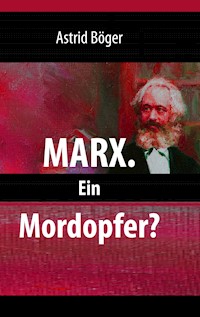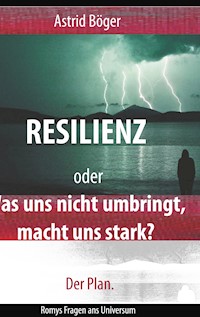
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mesut Özil, ein Millionär, ein taffer Sportler und trotzdem ein Opfer? Und Recep Tayyip Erdogan, ein Präsident, ein Diktator und auch nur ein Opfer? Und die Bürger, die sich über diesen vermeintlichen Fall streiten, auch nur Opfer? Werden Völker zum Narren gehalten? Und warum rettet das Rettungswesen nur noch bedingt? Oder warum werden die Konzerne zu einer Bedrohung? Findet hier Technologiemissbrauch in großem Stil statt? Gehören alle nur zu einem Plan, den militärische, industrielle oder Finanzkreise sich ausgedacht haben? Und führt man dafür im Geheimen Resilienz-Projekte durch? Werden Technologien zur Manipulation von Menschen eingesetzt? Befinden wir uns in einem Prozess, in dem an unserem Verhalten und an den Haltungen der Bürger >gearbeitet< wird? Und ist dies nur ein irrealer Krimi oder ein perfider, aber leider realistischer Thriller? Den Leser erwartet eine spannende und zugleich informative Lektuere der anderen Art.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 834
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu dieser Buchreihe:
„Romys Fragen ans Universum“ beschäftigt sich in Form von Krimis mit aktuellen und historischen gesellschaftspolitischen Herausforderungen im Kontext technologischer Entwicklungen. Im Mittelpunkt stehen Thesen, die gegenwärtige globale, nationale und regionale Problemlagen, Terror, Umweltkatastrophen, Hunger auf die Kenntnisse und das Wissen über, das Verschweigen oder den Einsatz von Technologien, Patenten und wissenschaftlichen Methoden zurückführen.
Dabei fließen persönliches Erleben der Autorin mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und beruflichen Erfahrungen zusammen.
Die Information als Ware, der individuelle Kenntnisstand, emotionale Manipulationen bilden dabei zentrale Grundlagen für Verhalten und Haltungen in der Bevölkerung, für das wirtschaftliche System, kulturelle und soziale Gefüge.
„Information hiding“ dient als Machtinstrument, um einen anstehenden Systemwechsel zu verhindern. Global vorhandenes Wissen über existierende Technologien lässt sich aber nicht mehr unterdrücken. Der weltweite gesellschaftliche Fortschritt wird sich durchsetzen, auch wenn über Technologien, Finanzen, informationelle, industrielle, militärische und geheimdienstliche Strukturen der Druck auf die Bevölkerung mit „unsichtbaren“ Mitteln stetig wächst und demokratische Strukturen auseinanderzubrechen drohen. Es ist Zeit für eine technologische Aufklärung.
Über die Autorin:
Jordana André wurde in Berlin geboren, studierte Informationswissenschaften, promovierte in Ingenieurwissenschaften, arbeitete als Professorin und war international in unterschiedlichen Branchen, auch in europäischen Institutionen und in der Wirtschaft tätig, bevor sie sich selbständig machte. Bei „Resilienz“ handelt es sich um das zweite Buch aus ihrer Real-Fiction-Reihe: „Fragen ans Universum“.
Besuchen Sie auch die Homepage der Autorin:
www.jordana.de
Inhaltsverzeichnis
#01 Einführung
#02 Disease Mongering?
#03 Romys Fragen ans Universum
#04 Trotz Resilienz bedeutungslos?
#05 Nur Terror oder bereits Apokalypse?
#06 Mind war?
#07 G esundheitsnetzwerker - Startups und
#08 Gefahr Netzneutralität?
#09 Bedrohung Großkonzerne?
#10 Abgesang?
#11 Merger und Akquisition mit unbekanntem
#12 Supersichere Telematik?
#13 Rettungswesen unrettbar?
#14 Rettungswesen Version 2.0?
#15 Dornröschenschlaf Smarter Textilien?
#16 Patientenportale für Versicherungen?
#17 Innovationsfond als reiner Showeffekt?
#18 Smarte Autoindustrie oder
#19 Po litstrategische Routine oder emotionale
#20 Rufe Krankenschwester, brauche
#21 Resilienzprojekt oder Social Engineering?
#01 Einführung
„Du Romy, was meinst du eigentlich mit „information hiding“? Sehr oft sprichst du darüber und siehst dies als Hauptgrund für viele gegenwärtige aktuelle politische und gesellschaftliche Missstände. So richtig verstehe ich nicht den Zusammenhang mit deinem Mobbingskandal, auf den wir uns ja in der Vergangenheit konzentriert haben.“
„Tut mir leid, Katharina. Oft merke ich gar nicht mehr, dass ich mit Selbstverständlichkeit in Fachtermini und Anglizismen rutsche, vor allem, wenn ich über technologische Zusammenhänge berichte. Blöde Angewohnheit. Aber das hat sich, seit ich im Konzern arbeite, noch mehr verstärkt.“
„Ist ja auch nicht schlimm. Aber irgendwann fällt es mir schwer, über die möglichen nächsten Schritte nachzudenken, wenn ich nicht mehr erkennen kann, worin nun der beste Ansatz besteht, den Skandal eben auch wirklich als Skandal publik zu machen. Das Problem ist ja, dass heutzutage die wenigsten Leute wirklich noch Interesse an den Details haben. Sie wollen einen charismatischen Führer oder eine Führerin, die ihnen mit einfachen Worten erklärt, was Sache ist, plausible Schlussfolgerungen zieht und voran geht.“
„Ist schon klar. Und da bin ich anscheinend viel zu kompliziert. Willst du mir das sagen?“
„Nicht sauer sein, aber manchmal ist eben weniger mehr. Es reicht ja, wenn du weißt, was du meinst.“
„Du hast eigentlich recht. Aber glaube mir, ich quäle mich bestimmt nicht ohne Grund mit dem Reden oder Aufschreiben bereits schon Jahre. Täglich kannst du verfolgen, wie Äußerungen, auch wenn sie noch so richtig sind, einfach verpuffen. Weil den Personen die Worte im Munde umgedreht werden, weil keiner daran Interesse hat, mehr über die Hintergründe zu erfahren, weil sie nicht die richtigen Fakten parat haben, weil sie einfach unsympatisch rüberkommen, weil es einfach einfacher ist, sie ganz schnell in einen Topf zu werfen, Deckel drauf und erledigt.“ Romy sah Katharina mit einem Blick stiller Verzweiflung an.
„Weißt du, ich will nicht, dass die Erfahrungen, die ich nun in den letzten Jahren gesammelt habe, einfach so verpuffen. Wie oft kam schon einer auch mich zu und wollte mir erklären, dass ich doch ein guter Verschwörungstheoretiker wäre oder es doch mal in der Ecke der esoterischen Literatur probieren sollte. Aber damit habe ich nichts am Hut. Aber wenn wir es erst einmal verkackt haben, haben wir es verkackt. Entschuldigung, aber du weißt, was ich meine. Entweder wir haben uns lächerlich gemacht, oder wir werden vom Konzern verklagt oder wir finden uns mit einer Kugel im Kopf in der Spree wieder. Und dann interessiert niemanden mehr, ob oder was da Wahres dran war, welche komplizierten Zusammenhänge dahinter stehen. Und wir können dann nichts mehr bewirken, was gesellschaftlich oder politisch von Bedeutung wäre. Ich glaube nicht, dass wir viel mehr als einen „Aufschlag“ haben. Und der muss sitzen.“ Romy schaute Katharina fragend an.
„Oder?“ Und nach einer kurzen Pause setzte sie nach: „Aber vielleicht sehe ich das ja wirklich auch alles viel zu kompliziert. Oder meinst du, ich bin zu ängstlich? Aber ständig muss man ja jetzt von Journalisten lesen, die vergiftet oder erschossen wurden, oder die unter Polizeischutz stehen. Das will ich natürlich nicht, schließlich habe ich ja auch noch Mia.“
Katharina und Romy hatten sich, wie bereits die Monate zuvor, in dem kleinen, von Romy gemieteten Häuschen in Bad Worast getroffen, um über die Vorfälle, Entwicklungen oder den „Fall“ Romy zu diskutieren, zu dem die einzelnen Begebenheiten sich bündelten.
Nicht nur Romy, sondern mittlerweile auch Katharina, wollte soviel wie möglich von den Ereignissen aufschreiben.
Was sie dann mit den Notizen allerdings anfangen wollten, hatten sie noch nicht endgültig geklärt. Neben der Veröffentlichung als Buch oder Bücher, standen auch noch die Übergabe der Dokumentationen oder zusammengefassten Protokolle von Romy an die Polizei, den Staatsschutz, das Innenministerium oder vielleicht sogar den Geheimdienst im Raum.
Und dass war wohl die größte Herausforderung, vor der die beiden Frauen standen.
Wie sollten sie am besten und natürlich am wirkungsvollsten mit den Informationen umgehen, diese weitergeben, die anscheinend von so zentraler Wichtigkeit waren, dass beide dadurch permanent auch ihr Leben in Gefahr sahen?
Romy konnte bisher immer noch nicht klar beschreiben, warum gerade bei ihr anscheinend all die wichtigen Informationen zusammenliefen und sie diese wie das Licht die Motten anzog. Immer wieder kreiste die Gedankenschleife in ihrem Kopf: Warum fließen bei mir so viele dunkle Wahrheiten zusammen und musste ich deshalb diese Mobbingerfahrungen machen?
Spielte dabei eine Rolle, dass sie über die letzten Jahre immer etwas resilienter1 geworden war?
Oder war sie resilienter geworden, um diese Erfahrungen sammeln zu können?
Gehörte dies zu einem Plan?
Sagte man ihr nicht öfter, dass sie belastbar wie ein Pferd sei? Oder ein ganzer Kerl?
Romy empfand natürlich nicht, dass diese Sätze zu den nettesten Komplimenten gehörten, über die sich eine Frau freute. Auch wenn diese sicherlich als solche gemeint waren. Irgendwie. Es war wohl die höchste Anerkennung, die Männer einer Frau gegenüber machen konnten.
Vielleicht bedeutete dies auch, dass sie sich deshalb genau heute in der Siuation befand, in der sie sich eben befand?
Und vielleicht war es genau diese gesteigerte Resilienz, die auch eine größere Überlebenschance für Romy bedeutete?
Vielleicht konnte nicht jeder die Stresssituationen, denen sie sich täglich ausgesetzt sah, halbwegs so gesund überstehen, wie es ihr, wenn auch nicht immer, aber immer öfter teilweise gelang? Und vielleicht war sie ja bereits ihr ganzes Leben auf diese Anforderungen hin trainiert worden?
Bad Worast lag einige Kilometer vor den Toren Berlins. Es war ein kleiner, eher verträumter Ort, der vor allem vom Tourismus lebte und sich besonders die Schönheiten der Natur als wichtigsten Standort- und damit auch Wettbewerbsvorteil auf die strategische Agenda geschrieben hatte. Der große See mit seiner guten Wasserqualität lud im Sommer viele Wassersportler und Badegäste ein.
Der Kletterpark bot nicht nur kleinen Abenteurern, sondern seit neuestem auch Managern und Führungskräften zur Selbsterfahrung und zum Team-Building Kurse an, um in einem interessanten und herausfordernden Ambiente die eigene „Personality“ zu schärfen. Reichte es früher vielleicht, im Personalmanagement und beim Betriebswirtschaftsstudium aufgepasst zu haben, sollte man heute mindsestens beim Kanubau oder im Hochseilgarten punkten. Gefragt waren Risikobereitschaft, Sportlichkeit, Fitness, Teamgeist, Unerschrockenheit, wollte man in der Wirtschaft Karriere machen. Gab es überhaupt noch Vorstände von Dax-Konzernen oder im amerikanischen Umfeld, die keine Triathleten waren oder wenigstens beim letzten Marathon erfolgreich teilgenommen hatten?
Auch Romy hatte sich, parallel zu ihrem Traum, im Konzern die Karriereleiter aufzusteigen, große sportliche Ziele gesteckt. Allerdings schwankte hierbei ihre Motivation wie Espenlaub, je nach Stress- und Mobbinglevel, mit dem sie aktuell zu kämpfen hatte. Eigentlich sollte der Sport ja den Körper so stählen, dass sich auch die Nerven zu Drahtseilen stärkten. Aber diesbezüglich schien Romy noch nicht den richtigen Zugang gefunden zu haben. Kam es zur Entscheidung, einerseits eine Präsentation, Vorlage gründlich auszuarbeiten oder sich per Mail gegen eine vermeintlich nicht verständliche Managemententscheidung zu wehren oder andererseits um den See zu joggen, entschied sie sich in der Regel für die erste Option.
Jetzt, da sie mit Katharina jede Minute nutzen wollte, um mit ihr gemeinsam ihre Erfahrungen aufzuarbeiten, stand dieses Ziel natürlich zentral im Fokus. Laufen konnte sie ja danach immer noch.
Während in den Sommermonaten die Besucher zwischen Therme, Kurpark und Seebad flanierten, oder mit Rädern, Skateboards oder Segways die Promenade in eine stark frequentierte „Mobilitätsmeile“ verwandelten, traf man in der Nebensaison nur vereinzelt auf Spaziergänger. Einige Schwangere mit dicken Bäuchen, die aus dem Muttererholungsheim kamen und die Luft am See genossen, zogen bedächtig ihre Runde und einige Einheimische, die mit ihren Hunden die kurörtlichen Grünanlagen wenigstens etwas belebten und ihren Vierbeinern den unangeleinten Auslauf gönnten, schlenderten langsamen Schrittes hinterher, nur unterbrochen von den Momenten, in denen sie zu einer Tüte griffen, um die Haufen ihrer Liebsten aufzusammeln.
Und auch, wenn die beiden Freundinnen eher selten spazieren gingen, nutzten sie die Ruhe, die dieser Ort ausstrahlte, um ungestört von Auto- oder sonstigem Großstadtlärm, sich detaillierter mit den Fakten und den komplexen Verwicklungen aus Romys Berichten auseinanderzusetzen.
Und natürlich auch, um die nächsten Schritte zu planen.
Doch eigentlich sprachen die beiden selten darüber, welche Gefahren latent über ihnen schwebten und mit welchen Konsequenzen sie gegebenenfalls rechnen mussten. Beide schienen dieses Thema weitestgehend zu verdrängen.
Die ersten Fragestellungen hatten sie vorerst in einem Buch mit dem Titel „Mobbing oder High-Tech-Tod auf Raten“ zusammengefasst, auch wenn das sicher nicht die Form war, die sie den Behörden übergeben konnten. Aber so sicher waren sie sich diesbezüglich auch nicht. Wollten sie das überhaupt? Wollten sie sich einmischen und diesen Sumpf an Verwicklungen und Verstrickungen?
Und dabei stellten die bisher zusammengefassten Erlebnisse nur die ersten Auszüge von dem dar, was Romy in den letzten Jahren im und um den Konzern widerfahren war und welcher Erkenntnisgewinn daraus für sie resultierte.
Sowohl Romy als auch Katharina waren sich bewusst, dass die Initiatoren dieses schaurigen Kriminalstücks oder verschwörungsstrategisch belasteten Thrillers kein Interesse daran haben konnten, dass die beiden ihre Beobachtungen und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen öffentlich machten und sogar noch breite Kreise dazu einluden, sich selbst ein Bild von diesen Sonderbarkeiten zu machen, um dann darüber zu urteilen.
Romy wusste, dass, solange sie keine Interviews geben und auch nicht weiter in der Presse auftauchen würde, sie kaum etwas befürchten musste. Die Wahrscheinlichkeit, dass jeamnd an ihrem Buchprojekt Anteil nehmen würde, war eher verschwindend gering. Und ohne großen PR-Rummel bestand auch keine Gefahr, dass die Missstände zu einem öffentlichen Politikum werden würden. Aber was, wenn doch plötzlich eine Welle losgetreten werden würde? Und musste sie daran nicht eigentlich auch Interesse haben?
Romy wollte nicht daran denken. Einerseits war ihr klar, dass sie nur deshalb dieses Projekt begonnen hatte, um ihren Beitrag zu leisten, diese unheimliche Allianz aufzudecken, aber andererseits fürchtete sie mit jedem Tag, an dem sie tiefer in die Zusammenhänge drangen, den öffentlichen und unausweichlichen Konflikt.
Und auch Katharina verdrängte diese eigentlich angestrebte Option der investigativen Veröffentlichung, vielleicht noch in der Bildzeitung, fast vollständig. Aber auch ihr war bewusst, dass es keinen Sinn machte, über die Machenschaften des Konzerns zu schreiben, dann aber nicht in angemessener Form auch darüber zu berichten und dabei auch Romys Schicksal als persönliche Erfahrungen nach vorne zu stellen.
Im Hinterkopf spukte immer wieder die spontane Äußerung von Romys Kollegen, nachdem sie ihm ihre Hypothese mitgeteilt hatte: „Das bedeutet Tod. In Amerika wirst du dafür erschossen.“
Und nicht nur diese Sätze, sondern auch, wie Romy sein Entsetzen beschrieb, die geweiteten Augen, die plötzliche Blässe in seinem Gesicht. Und, dass er von diesem Zeitpunkt an vermied, Romy zu treffen, mit ihr zu sprechen. Im schien sein persönliches Risiko zu groß zu sein. Er wollte in keinem Fall mit Romy in Verbindung gebracht werden, und schon gar nicht, falls sie so verrückt sein würde, mit ihren Erkenntnissen in der Öffentlichkeit eine Diskussion loszutreten.
„Infomation hiding“, nahm Romy die Frage von Katharina nachdenklich auf, indem sie den Begriff wiederholte und fortsetzte:
„Information hiding. Ja, dafür gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Übersetzungen und Interpretationen. Ganz einfach würde ich es aber als das Verstecken von Informationen bezeichnen. Mehr ist es glaube ich auch nicht.“ Romy überlegte.
„In meiner Kindheit hat mir meine Mutter einen Spruch in mein Poesiealbum geschrieben: „Sage nicht alles was du weißt, aber wisse alles, was du sagst.“ Als ich noch jünger war, habe ich nicht wirklich verstanden, warum ich nicht immer alles sagen sollte, was ich wusste. Mittlerweile verstehe ich dies natürlich viel besser. Es sind eben Erwachsenenspiele, die anscheinend zum politischen und wirtschaftlichen Poker dazugehören. Zur Taktik. Zum Täuschen. Der Gegner muss nicht gleich wissen, welche Trümpfe man noch in der Hand hält. Insofern habe ich leider erst jetzt wirklich erkannt, welchen wichtigen Rat mir meine Mutter damit auf meinen Lebensweg gegeben hat.“ Eigentlich wuchs Romy behütet, umsorgt und glücklich auf. Und auch, wenn sie in der Schule über Geheimdienste, Kriege oder furchtbare Lebensverhältnisse erfuhr, spielten solche Fragestellungen für sie im Alltag kaum eine Rolle. Eigentlich würde ja alles besser werden. Überall.
„Aber dies ist natürlich nur die eine Seite, eben, um mögliche Gefahren von sich selbst abzuwenden, indem man seinen Gegnern nicht mitteilt, dass man mehr weiß, als ihnen lieb sein dürfte. Es scheint die Grundlage, für das heutige Leben oder besser fürs Überleben darzustellen, so bitter dies auch ist. Bis vor wenigen Monaten dachte ich noch, diese Verhaltensweisen, immer auf der Hut zu sein, wem gegenüber man etwas äußerte, spielten vor allem in früheren Zeiten, in Kriegen, im Kolonialismus oder eben in Diktaturen eine Rolle. Aber doch nicht mehr heute. In Deutschland. In einer westlichen Demokratie. In der Freiheit. Dort, wo die Meinungsfreiheit zu den Grundrechten zählte. Der Gesundheit zuträglicher ist es aber anscheinend auch heute noch, zu wissen, wann es wichtig, richtig und notwendig ist, über Dinge zu sprechen oder wann man besser die Klappe halten sollte. Anscheinend und erschreckenderweise leben wir gerade in einer solchen Zeit, in der man möglichst über viele Beobachtungen erst einmal schweigt, wenn man erkennen muss, dass man an den Verhältnissen nicht mal einfach so und auf die Schnelle etwas ändern kann.“ Romy war bewusst, dass das „information hiding“ natürlich vor allem die Züge der gesellschaftlichen Gegner des Fortschritts trug und vor allem nur denen diente, die die Informationen besaßen.
„Letztendlich gibt es gegenwärtig viele heterogene Interessensgruppen, die ihr Wissen in geschlossenen Zirkeln für sich behalten. Du kennst das ja aus dem Journalismus. Wie oft heißt es: „Wie wir aus informierten Kreisen erfahren haben...“. Niemand nennt die Informanten und niemand würde sein Hand ins Feuer dafür legen, dass diese Kreise wirklich so gut informiert waren. Aber wenn man eben keine anderen Informationen dazu finden kann? Für eine Story reicht es dann allemal. Und wenn man mal daneben liegt - Schwamm drüber. Erst einmal eine Schlagzeile produzieren, bevor man Gefahr läuft, nicht mit der neusten Sensation punkten zu können oder eben bei einem starken Aufklärungsdruck durch die breite Öffentlichkeit, wie bei einer unerwarteten Katastrophe, z.B. einem Attentat oder einem Terroranschlag keine nachvollziehbaren Antworten schnell liefern zu können. Dann ist es eben, schon rein aus wirtschaftlichen Druck, besser zu mutmaßen, als ehrlicherweise zugeben zu müssen, dass alle Erklärungsversuche auf reinen Spekulationen beruhen und in keinem Fall wissenschaftlich oder sorgfältig recherchiert sind und von verschiedenen Experten abgesichert wurden.“ Romy musste an ihre Interviews denken, die sie manchesmal zu technologischen Innovationen gab und wo dann oft auch „Halbgegartes“ herauskam. Aber es stand eben so in der Presse. Und wer wollte es sich denn schon mit Journalisten verderben.
„Es gibt also Gruppen, die wissen mehr als andere. Informationen bedeuten eben Macht. Und nicht umsonst gehören zu den wichtigen Quellen der Gegenwart und für die aktuelle Informationsbeschaffung auch V-Leute2. Als Verbindungs- und Vertrauenspersonen halten sie Kontakt zu Nachrichtendiensten, dem Zoll, der Polizei, mit dem Ziel, genau diese unbekannten, die versteckten und verborgenen Informationen aufzudecken. Dazu gehören Planungen für Attentate gleichermaßen wie wirtschaftspolitische Strategien. Gegenwärtig liegt der Eindruck nahe, dass es bezüglich der Inhalte aber auch in Bezug auf die Informationsbeschaffung kaum noch Grenzen gibt.
Mit den neuen datentechnischen Entwicklungen hat dieses „Verstecken“ oder „Vorenthalten“ von Informationen natürlich eine ganz andere Dimension erreicht. Bereits bei der Programmierung wird auf „encapsulation“ oder auch Datenkapselung geachtet. Abgesehen davon, dass sowieso kaum ein „Normalbürger“ Programmcodes lesen und verstehen kann, werden wichtige Daten und Informationen noch einmal besonders vor einem Zugriff von außen geschützt.
In der Regel ist es damit nicht mehr möglich, auf die inneren Strukturen von Programmen, Algorithmen, aber auch von Prozessen, Produktentwicklungen, Entscheidungen zu schauen.
Nur wenn die „Schöpfer“ dieser Informationen, die aus der Verbindung zahlreicher Daten und Fakten entstehen, es wollen, können sie bestimmte Schnittstellen öffnen, um entweder in die Strukturen hineinschauen zu lassen, wie bei den Black-Box-Modellen, die wir von Flugzeugabstürzen kennen oder auch zulassen, dass Informationen in die eine oder andere Richtung übertragen und Algorithmen sichtbar werden. Wer kann heute noch verstehen, nach welchen Prozessen, in Wissensbanken Entscheidungen präferiert werden?
Bereits vor fast zwanzig Jahren eröffnete einmal Nicholas Negroponte3 in einem Vortrag im MIT, im Massachusetts Institute of Technology, dass wir gegenwärtig im Zeitalter der Schnittstellen, der Interfaces leben. Nur wer über die Schnittstellen verfügt, verfügt auch über die wirkliche Macht der Informationen.“ Romy musste an ihre Reise und ihre Teilnahme an der Konferenz in Boston denken, die sie damals sehr beeindruckt hatte. Überhaupt gehörte die Besichtigung des MIT Media Lab4 zu den Schlüsselerlebnissen in ihrer wissenschaftlichen Karriere. Bereits vor mehr als zehn Jahren übertrugen Wissenschaftler, allein per Handschlag, persönliche Kontaktdaten5. Romy war damals mehr als verblüfft.
„Und an diesem Punkt gehört mein Konzern zu den Experten.
Besonders im beruflichen Umfeld kennt man das ja auch durch die Zuweisung einer Rolle in der Unternehmenshierarchie und der damit verbundenen Authorisierungen, inwieweit man Zugang zu Informationen erhält. Da werden Mitarbeiter bestimmten Kategorien oder Klassen zugeordnet und dementsprechend haben diese dann Zugriff auf spezielle Daten, Dokumente, Besprechungen etc.. Oder sie stehen auf bestimmten ausgewählten eMail-Verteilern. Und andere Mitarbeiter sind dann wieder ganz anderen Verteilern und anderen Schlüsseln zugeordnet. Dabei geht natürlich der Überblick des einzelnen verloren. Besonders erfolgreich lässt sich das System als Machtinstrument umsetzen, wenn keiner der Mitarbeiter mehr versteht, wer welche Informationen besitzt oder eben auch nicht. Missverständnisse, Fehlannahmen und Fehlplanungen sind dann vorprogrammiert. Je nach hierarchischer Ebene kann ich hier steuernd eingreifen, entweder für Transparenz, Klarheit und Verständnis sorgen oder eben genau das Gegenteil bewirken.
Und der Grad der Informiertheit, aber auch der Wahrheitsgehalt der Informationen, den man erhält, entscheidet dann letztendlich über deinen weiteren Lebensweg, nicht mehr und nicht weniger. So kannst du jeden Mitarbeiter entweder die Karriereleiter hoch schicken, wenn er in dein Konzept passt, oder dich seiner schnell entledigen. Niemand hat da mehr eine Chance.
So, wie es öffentliche Informationen gibt, gibt es eben zunehmend „streng vertrauliche“ oder „geheime Informationen“ für wenige, über die der Normalbürger keine Kenntnisse mehr hat und auch nicht mehr haben soll.
Und selbst, wenn dann irgendetwas herauskommt, zum Beispiel die Funktionsweise von etwas bekannt wird, dann wissen trotzdem nur die wenigsten, was dahinter steckt, können die Algorithmen prüfen oder kontrollieren. Das kannst du gut bei Google sehen. Wenn der Konzern nicht möchte, dass du verifizierte oder für dich wichtige Informationen erhältst, dann erhältst du diese auch nicht.
Oft habe ich über verschiedene Wege versucht, auch über verschiedene Geräte oder verschiedene Suchportale in kurzer Abfolge an Fakten zu gelangen. Spätestens dabei musste ich erkennen, wie sehr bereits die Manipulationen funktionieren.
Damit kann ich natürlich immer weiter die Schere zwischen „informierten“ und „uninformierten Kreisen“ öffnen.
Also nicht nur arm und reich spalten die heutige Gesellschaft, sondern vor allem auch „wissend“ und „unwissend“.
Und je mehr „information hiding“ in einer Gesellschaft zum Status Quo wird, also zum Alltag dazu gehört, um so mehr muss man auch davon ausgehen, dass es immer weniger bis hin zu gar keinen demokratischen Strukturen mehr gibt. Man kann de facto von „Pseudodemokratien“ sprechen. Denn zu einer Demokratie gehört, dass das Volk an Entscheidungen, die die Allgemeinheit betreffen, verbindlich beteiligt ist. Dazu gehört allerdings eine umfassende Informiertheit, die so nicht mehr als gegeben betrachtet werden kann.
Diese reinen „Pseudodemokratien“ dienen demzufolge nur noch zur Ablenkung. Es wird über Dinge debattiert, über politische Fragen diskutiert, die sowieso oder kaum wichtig und im weltpolitischen Kontext eher von untergeordneter Bedeutung sind und Scheingefechte darstellen. Die wirklichen Herausforderungen, die die Gegenwart prägen und die zukunftsentscheidend sind, werden nicht mehr in der Öffentlichkeit thematisiert. Oder wenn sie doch noch von „Querköpfen“ angesprochen werden, als Spinnereien abgetan oder pathologisiert.“
Pathologisierung:Deutung von Verhaltensweisen, Empfindungen, Gedanken, Wahrnehmungen, sozialen Beziehungen als krankhaft. Bewertungen werden im Sinne psychischer oder sozialer Phänomene an einem „Normalzustand“ vorgenommen, der medizinisch definiert wird. In der Regel werden diese „Abweichungen“ von den Betroffenen nicht als nachteilig empfunden (wie z.B. das Altern). Ziel ist die umfassende „Medikalisierung“ der Gesellschaft. Durch die Pharmaindustrie wird durch ein statistisches Aufbauschen der Häufigkeit (Prävalenz) von angeblichen Krankheiten ein Disease Mongering6 betrieben. [Quelle u. a. nach Wikipedia]
Romy schaute Katharina fragend an. „Weißt du, was ich meine?“
„Ja, ich glaube schon.“ Sie nickte. „Was ich aber trotzdem nicht verstehen kann, warum nicht doch irgendwie etwas „rauskommt“?“
„Kommt ja. Aber viel zu selten und eben nur Bruchstücke, mit denen man dann nicht wirklich etwas anfangen kann.“
Romy überlegte. „Ich erzähle dir mal eine kurze Geschichte aus meinem Berufsleben, als ich als Beraterin anfing.“
Sie rückte sich den Tisch, mit dem Wasser darauf, etwas näher und begann.
„Ich hatte in einem kleinen Beratungsunternehmen angefangen zu arbeiten. Wir waren ein kleines Team oder besser gesagt nur zwei Mitarbeiter. Trotzdem mussten wir ein ganz schön großes Arbeitspensum abarbeiten. Oft saßen wir bis tief in die Nacht oder gingen überhaupt nicht nach Hause, um verabredete Abgabetermine, ob für ein Ministerium, eine Staatskanzlei oder welchen Auftraggeber auch immer, einzuhalten. Wie so oft, streikte dabei gerade, wenn die Zeit knapp wurde, häufig die Technik. Sicher hast du damit auch öfter bittere Erfahrungen gemacht. Kurz vor der Abgabe einer Studie, eines Artikels oder eines Berichtes läuft irgend etwas schief - die Druckerpatronen sind alle, der Zugang zum Internet wird elend langsam, der Rechner „hängt sich auf“ oder man muss nur noch wenige Formate im Text ändern, zerschießt sich dann dabei aber plötzlich alles. Dann sind Abbildungen verschoben, die Tabellenspalten springen, wohin sie wollen. Und die Zeit drängt. Häufig ist dies natürlich auch eine Frage der Software, mit der man arbeitet. Früher war das alles natürlich noch unkomfortabler. Aber je professioneller die Software wurde, um so besser konnte man auch seine „Endprodukte“ selbst gestalten, schneller und vorzeigbarer. Und man erwies sich dadurch als Leistungsträger. Schön gestaltete Folien, übersichtliche Medien, ansprechende Graphiken - die äußere Form wurde immer wichtiger. Teilweise blieb der Inhalt hinter dem Design zurück. Professionell war, wer optisch professionell erschien. Oftmals kosteten früher spezielle Programme zur Erstellung von Grafiken, Schautafeln, Prozessdiagrammen noch viel Geld.“ Katharina nickte, aber nicht wirklich begeistert, worauf wollte Romy hinaus?
„Vor allem aber brauchte man Kenntnisse über die richtigen Programme sowie deren Einsatz. Alles eine Frage des Know-Hows. Und je besser man mit der Technik umgehen konnte und kann, umso besser, schneller und überzeugender kann man seine Abschlussdokumentationen, Forschungsergebnisse und Entscheidungsvorlagen zusammenstellen, präsentieren und überzeugen. Aber das weißt du ja auch alles selbst.“ Genau, dachte Katharina und hoffte, dass Romy endlich zum Schluss käme.
„Worauf ich hinaus will ist sicher nur eine Randerscheinung, die mir vorher aber nicht wirklich bewusst war: Wer als Mitarbeiter auf der Karriereleiter schnell nach oben klettern möchte, nutzt anscheinend alle Möglichkeiten, um seine „Wettbewerber“, also die Kollegen, aber auch Führungskräfte auszutricksen oder auszuschalten, und dabei das eigene Know-How möglichst für sich zu behalten, eben „Information-Hiding“.“ Romy nahm einen Schluck Wasser und spürte ihrer Verwunderung nach, die sie damals empfunden hatte, weil ihr solches Verhalten vollkommen fremd war.
„Als eines Tages unser kleines Zweier-Team um eine neue Kollegin erweitert werden sollte, wurde mir das das erste Mal bewusst. Mein Kollege sollte der neuen Mitarbeiterin seine Informationen „spiegeln“, damit sie nahtlos mit uns zusammenarbeiten könnte. Was aber tat er? Nachdem er seinen Computer gespiegelt hatte, begann er, wie ein Kaputter, nicht nur seine persönlichen Dateien zu löschen, was ich ja noch irgendwie verstanden hätte, sondern er entfernte auch alle wichtigen Programme, die zur Erstellung der Berichte für uns eine wertvolle Arbeitsgrundlage datstellten.
„Warum löschst du denn die Software?“, fragte ich ihn.
„Ich gebe doch nicht mein Know-How weg. Wenn es nachher darum geht, wer geht oder wer bleibt, dann schicken sie mich vielleicht eher in die Wüste als sie, wenn sie die gleichen Skills wie ich hat. Soll die mal schön sehen, wie sie ihre Aufgaben allein auf die Reihe bekommt. Zeit ist Geld. Und je effizienter man arbeitet, um so wertvoller ist man fürs Unternehmen. Von mir bekommt sie jedenfalls nichts. Weder Software noch Informationen.“
Romy beendete den Satz mit einem hörbaren Seufzer.
„Ich fand das damals ganz schön fies und es hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Aber ehrlich gesagt, habe ich auch nicht protestiert oder es verhindert. Sondern ich habe einfach nur zugesehen. Ich hatte es auch nie so leicht in der Zeit davor, besonders nach dem Studium im Osten, einen Job zu finden und die Angst, bei schlechterer Auftragslage in dem kleinen Institut auch wieder auf der Straße zu landen, hat mich schweigen lassen. Es ist zwar blöd und vielleicht mache ich es mir damit auch zu einfach, jetzt zu sagen, das „System“ war schuld, aber irgendwie empfinde ich das schon so. Denn ohne diese Existenzangst, aber auch den Zeitdruck und die Priorität des Geldes, hätte ich bestimmt etwas gesagt. Und insofern kann ich auch viele meiner Kollegen verstehen, die jetzt im Konzern nicht den Mund aufmachen oder mich bei meiner Arbeit behindern. Außerdem kennt man ja die Schicksale von denen, die sich vermeintlich gegen die Ungerechtigkeiten in der Welt einsetzten, z.B. als Whistleblower. Sie sitzen heute auf der Straße, kämpfen ums Überleben und nach einigen Wochen kräht kein Hahn mehr nach ihnen oder danach, dass sie sich mutig ein Herz gefasst haben, um auszusagen.“
„Und so habt ihr der Neuen auch die wichtigsten Informationen vorenthalten, richtig?“
„Na, lange ging das nicht. Wie willst du in einem so kleinen Team denn dann zusammenarbeiten? Innerhalb kurzer Zeit mussten wir sie ja einbeziehen, sonst hätten wir unsere Arbeit nicht geschafft und sicherlich war das auch eine gute Lektion, um zu verstehen, dass wir gemeinsam eben viel bessere Ergebnisse erzielen konnten und dafür auch alle die gleichen Arbeitsmittel und den gleichen Wissensstand benötigten.“
„Und wie ist es ausgegangen?“
„Letztendlich musste doch einer aus unserem Team gehen, als die Auftragslage sich verschlechterte. Und dann traf es meinen Kollegen. Irgendwie war es wie seine selbsterfüllende Prophezeiung. An die Argumente kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern. Wahrscheinlich behielt man mich, weil ich als Frau auch noch Kaffeekochen und Brötchen servieren konnte. Die andere Mitarbeiterin hatte zwischenzeitlich bereits den Absprung geschafft und war von selbst gegangen. Aber so richtig kann ich mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern. Ich habe es einfach verdrängt. Aber es war das erste Mal, dass ich mich so konkret an eine Form des „information hiding“ erinnern konnte.
„Und dann nicht mehr?“
„Doch, dann fühlte ich mich natürlich irgendwie immer öfter damit konfrontiert. Wahrscheinlich, weil ich dadurch danach auch viel bewusster darauf geachtet habe. Am erschreckensten finde ich es allerdings, wenn es nicht von Mitarbeiter zu Mitarbeiter erfolgt, sondern als Prinzip in einem Konzern erfolgt.“
„Du meinst deinen Konzern?“
„Ja. Ein riesiger und augenscheinlich reicher Unternehmensverbund emöglicht es den Mitarbeitern nicht, aktuelle Software zu nutzen, die man für ein effizientes Arbeiten benötigt. Was natürlich per sé einen Widerspruch darstellt und mich auch mehr als gewundert hat.“
„Das verstehe ich aber auch nicht“, erwiderte Katharina. „Ich denke, in Konzernen ist alles optimiert? Zeit ist money und man muss in kurzer Zeit viel schaffen? Und außerdem bin ich auch immer davon ausgegangen, dass in solcher Industrie wirklich nur die besten technischen Lösungen genutzt werden?“
„Das dachte ich natürlich zu Beginn auch. Wir mussten z.B. oft Word-Dokumente in PDFs umwandeln oder sollten auch mal schnell NDAs oder andere Dinge unterschreiben lassen oder zertifizieren. Aber meinst du, ich durfte zum Beispiel Adobe nutzen? Oder irgendein anderes gleichwertiges Softwareprodukt? Das war in unserem Bereich total verboten. So brauchst du dann natürlich ewig mit allen Prozessen. Ausdrucken, eintüten, mit dem Brief wegschicken, nach zwei Wochen nachfragen usw. Ich glaube nicht, dass google mit solchen Prozessen den Weltmarkt erobert. Und als ich mal ein großes Projekt planen wollte, was sich natürlich mit Visio sehr gut darstellen lässt, wurde mir auch das verweigert. Um meine Arbeit dann halbwegs ordentlich zu erledigen, habe ich teilweise mit meiner privaten Hard- und Software zu Hause gearbeitet, die ich noch aus der Unizeit habe. Aber das ist doch pervers, oder? Und eigentlich unglaublich. Vor allem kommen dir da Fragen. Einerseits wird in der Presse „verkauft“, welche neuen Innovationslabs, HUB-Räume und Zukunftsprojekte dieser Konzern national und international ausrollt, und andererseits, wenn ein Manager darum bittet, mit Adobe oder einer anderen Software zu arbeiten, um Prozesse effizienter zu gestalten, dann heißt es: „Dafür haben wir kein Geld. Bei so vielen Mitarbeitern würde das ja vollkommen ausufern, und das könne sich der Konzern nicht leisten.“
„Dann wurde Adobe gar nicht eingesetzt?“
„Nein, natürlich nicht. Du konntest in der Beschaffungssoftware im Konzern natürlich eine solche Option wählen, aber wenn du diesen Bestellvorgang angeschoben hattest, inklusive der Begründung, warum du eine Lizenz für deine Arbeit als sinnvoll erachtest, und was man ja einem Manager zubilligen sollte, dass er weiß, wozu er welche Arbeitsmittel benötigt, wurde dieser Beschaffungsvorgang einfach von der Führungsebene, angeblich aus Kostengründen, nicht genehmigt. Was für ein Quatsch. Natürlich wäre es nicht logisch, wenn jeder Mitarbeiter jede Software nutzen könnte. Ein Kollege aus dem Controlling benötigt vielleicht nicht unbedingt Visio oder MindMap, aber ein Manager aus der strategischen Abteilung sollte doch solch elementare Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt bekommen, oder? Vor allem, wenn man das Gehalt mal ins Verhältnis mit der Unproduktivität des Arbeitens setzt.“
„Und, hast du was gesagt?“
„Ehrlich gesagt, habe ich mich zwar intern beschwert, aber extern habe ich darüber nicht berichtet. Ich war zu dieser Zeit noch sehr auf dem Loyalitäts- und Verständnistripp. Und wer erzählt schon gern von seinem „reichen“ Arbeitgeber, der einem die simpelste Software nicht zur Verfügung stellt. Zumal das ja überhaupt nicht logisch nachvollziehbar ist.“
„Meinst du, dass hat auch etwas mit deinem Mobbing zu tun?“
„Sicherlich auch. Wenn mich der Konzern wieder los werden will, dann wird er mich natürlich nicht dabei unterstützen, dass ich effizient, profitabel und professionell arbeite. Ich glaube, es gab wenige Unternehmen in meinem Leben, wo ich permanent solchen digitalen Ausfällen und „Pleiten, Pech und Pannen“ ausgesetzt war. Ich empfand das alles aber irgendwie nur als Zirkus und habe anscheinend den bitteren Ernst dahinter vollkommen unterschätzt. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht der einzige Mitarbeiter bin, der an der Produktivität gehindert wird.
Für mich ergeben sich da vor allem zwei Hypothesen, die ich aus diesen Vorfällen ableiten kann:
1. Entweder die technische Basis und das Know-How im Konzern sind wirklich so schlecht und das ganze Unternehmen steht auf tönernen Füßen, was einem potemkinschen Dorf entspricht oder
2. die permanenten Störungen und Ausfälle sind nur Show, um den Konzern technisch schlechter darzustellen, als er in Wirklichkeit ist, um damit vom wahren Know-How, den wirklichen Einsatzfeldern und dem geplanten „Mauern“ abzulenken. Letztendlich ist es eine Bauchentscheidung, aber natürlich auch der bisherigen Erfahrungen, zu welcher Hypothese man mehr neigt.“
„Und was meinst du?“
„Da ich stärker von strategischen Planungen ausgehe und es auch besser zu dem Gesamtbild des Information warfare passt, präferiere ich die zweite Hypothese. Zumal ja die Kosten für Lizenzen von Software in einem so großen Konzern und bei solchen Mengen eher Peanuts darstellen sollten. Dabei kann es natürlich sein, dass auf das Konzernportfolio, dass nur als eine Art Alibi aufrecht erhalten wird, wirklich kaum Wert gelegt wird und somit auch diesbezüglich das Bild des potemkinschen Dorfes aus der ersten Hypothese gleichfalls zutrifft. Die eigentlichen Aufgaben, die vom Konzern erwartet werden, erfüllt dieser nur schlecht als recht und vor allem entsprechend seinen strategischen Zielen, während er sein Hauptaugenmerk auf ganz andere „Geheimprojekte“ und Schwerpunkte konzentiert.“
„Und in welchen Bereichen finden diese Projekte statt?“
„Das habe ich ja schon erwähnt. Ich denke, dass vor allem, dass ein Schwerpunkt im Bereich der „unsichtbaren Kriegsführung“ liegt, also beim Einsatz physischer und psychischer Waffensysteme. Ist ja auch logisch, dass der Konzern vor allem in Geschäftsfeldern agiert, die durch seine Infrastrukturen begünstigt werden und die ihm natürlich den notwendigen Wettbewerbsvorsprung, aber auch die überragenden Profite verschaffen. Insofern fokussiert sich der Konzern auf das gesamte Portfolio, dass du mit Frequenzen, Informationsbeschaffung, Big Data, Datenmanipulationen aber auch Strahlen generell abdecken kannst. Geheimdienste, Nachrichtendienste, aber auch Neurologen oder Pharmakonzerne könnten überhaupt nicht ihre Strategien umsetzen, wenn sie nicht auf die Collaboration mit dem zentralen Telekommunikationskonzern vertrauen könnten.“
„Meinst du das ernst?“
„Ja klar. Die Algorithmierung der Welt und die Datensammlung läuft doch schon Jahrzehnte. Da redet nur niemand drüber. Dass kannst du ja vor allem an den finanziellen Transaktionsgeschäften und auch am Agieren der Banken erkennen. Da schweigt man allerdings nicht so über den technologischen Stand. Und natürlich läuft vieles doch über die Kabel des Konzerns. Die vielen Leitungen, die auf dem Boden des Atlantiks Datenströme hin- und hersenden, von wem wurden die denn verlegt und mit welchen Mitteln?“
„Waren das nicht vor allem die Briten und die USA?“
„Ursprünglich schon. Die Glasfaserkabel die die Daten zwischen den Kontinenten austauschen sind als TGN Atlantik bekannt, die blitzschnell ankommende Datenpakete in Richtung London weiterleiten. Aber mittlerweile ist die Telekom natürlich auch eingebunden und liefert ihre Daten zu.7 Und jetzt werden finanzielle Gewinne in Millisekunden eingefahren. Und auch die Strategie, mehr „bürgernah“ mit Kryptowährungen an den Banken vorbei agieren zu können, ist doch Nonsens. In dem Moment, wo du die Hard- und Software des Konzerns nutzt und alle demokratischen Regeln, die zu Beginn des Jahrhunderts noch beim Aufbau der Banken gegeben waren, ausgehebelt werden, bist du schneller dein Geld los, als du „Oh“ sagen kannst. Wenn eben der Zeitpunkt reif ist und die „strategische Ernte“ eingefahren werden soll. Deshalb ist dieser Konzern wirklich nicht zu unterschätzen. Er ist die Spinne im Netz des Systems.“
„Wow. Nur ein Konzern? Dein Konzern?“
„Nein, natürlich nicht allein. Strategisch ist das schon transatlantisch vorgedacht. Aber ich halte ihn schon für einen ganz zentralen Player in diesem Digitalisierungsroulette, der mit darüber entscheidet, in welche Richtung der gesellschaftliche Umbruch, vor allem in Deutschlan, natürlich ausgelöst durch den digitalen Wandel kippt.“
„Und die anderen Anbieter auch?“
„Sicher werden auch andere Telekommunikationskonzerne mitmischen und natürlich finden diese Projekte auch verteilt statt, aber Big Data ist auf dem besten Wege, den technologischen Totalitarismus aufzubauen und sich die Welt so zu gestalten, wie sich dadurch am besten die Interessen des Kapitals umsetzen lassen. Offiziell arbeitet das Unternehmen, vor allem aber die TSI bewusst und geplant höchst defizitär, was sie auch eindrucksvoll immer wieder durch geplante Umstrukturierungen unterstreicht. Jetzt soll schon wieder eine neue Gesellschaft gebildet werden. Ein nächster Schritt auf dem Weg hin zum Verkauf der TSI und dann wahrscheinlich der gesamten Telekom. Die TSI hat allein 37.000 Mitarbeiter, die nun wieder auf der Kippe stehen. Und immer wird mit schrumpfenden Umsätzen und einer permanenten Verlustzone argumentiert. Dass die Mitarbeiter aber aufgefordert werden, keine Umsätze zu machen, davon kann man natürlich nichts in der Zeitung lesen.“
„Und was passiert mit den eigentlichen Aufgaben der Digitalisierung?“
„Na, da will der Konzern das Vektoring umsetzen. Natürlich weil Glasfasern sich nicht so gut zur Manipulation und zum Spionieren eignen. Das lässt sich mit den ungeschirmten Kabelbündeln und den Kupferkabeln generell viel besser umsetzen. Zum einen ist es notwendig, dass nur ein Provider am Verteiler eingesetzt werden kann, der den Zugriff und die Kontrolle des angeschlossenen Kupferkabels und damit auch die elektromagnetischen Störungen herausfiltert. Damit sichert sich die Telekom den direkten Zugriff bis in die Haushalte. Sozusagen die letzten Meter zu den Zielpersonen. Und obwohl Hauptprobleme wie das Übersprechen zwischen den Leitungen, Signalverluste durch die Leitungslänge und auch die unterschiedlichen Leitungscharakteristika bekannt sind, hält der Konzern weiter an der veralteten Technologie fest. Da fragt man sich doch glatt, ob sie diese negativen Effekte vielleicht sogar als positive Effekte schätzen, wie z.B. das Fremdübersprechen, auch bekannt als Alien Crosstalk - AXTLK8. Letztendlich handelt es sich hierbei um einen Effekt, durch den man am Telefon ein anderes Gespräch leise mithören kann. Natürlich kann man auch den Sendeprozess der Nachricht entsprechend stören. Dabei befinden sich Störer und Opfer an unterschiedlichen Enden des Kabels. Störsignale können zum Beispiel als Kopierecho auftreten. Ich will jetzt gar nicht weiter über die verschiedenen Störimpulse oder Manipulationsmöglichkeiten philosophieren, aber für mich ist das schon mehr als auffällig. Und ganz umsonst spricht man vielleicht auch nicht vom Alien-Übersprechen.“
„Aber wird nicht auch argumentiert, dass wir nicht ausreichend Glasfasern für den Ausbau zur Verfügung haben?“
„Auch ein interessanter Aspekt. Fragt vielleicht jemand einmal, wie in Deutschland in den letzten Jahren die Glasfaserindustrie suggessive „abgebaut“ wurde? Aber auch weltweit stockte die Geschäftsentwicklung der Glasfaserindustrie, auf Grund der schwachen Ausgaben der Telekom-Konzerne9. Das ist doch nicht normal. Obwohl es in Deutschland bereits Glasfaserhaushalte gab, und weltweit über die amerikanischen Technologiespekulanten mit endlosen Bandbreiten berichtet wurde, tat die Telekom, als ginge sie diese Entwicklungen nichts an.10 Und die Glasindustriezentren in Ostdeutschland wurden dicht gemacht. Und jetzt, wenn wir Glasfaserkabel benötigen, kaufen wir diese in großem Stil aus den Niederlanden11 ein. Also wenn ich das alles im Zusammenhang sehe, kommt mir das schon sehr planvoll vor. Immerhin gehörten diese technologischen Errungenschaften im überwiegenden Maße dem Volk. Ich denke deshalb, dass wir uns auch von der Argumentation des „Ossimobbings“ oder der Benachteiligung des „Ostens“ als Region befreien sollten. Im Vordergrund standen und stehen die Eigentumsverhältnisse. Natürlich auch das stärker am technischen Fortschritt orientierte Denken, das weniger die materiellen Fragen so in den Mittelpunkt gerückt hat. Wenn z.B. in der Glasindustrie Glasfaserkabel produziert worden wären, und diese Produktion hätte dem Land, der Kommune gehört, also einem Volkseigenen Betrieb, aber auch die Computer- oder Roboterproduktion, dann wiegt das Argument sehr stark, dass der gesellschaftliche Wandel nicht mehr aufzuhalten gewesen wäre. Die Allgemeinheit hätte größere ökonomische Stärke entwickelt, größeren Wohlstand erworben, den Menschen wäre es besser ergangen und sie hätten in Ruhe eine neue und gerechtere Gesellschaft für alle aufbauen können. Und da musste die Industrie und das Kapital langfristig strategisch vorsorgen. Du kannst dich ja sicher noch daran erinnern, wie viele Länder weltweit bereits den Kurs des Sozialismus eingeschlagen hatten, den Mehrwert von Frieden, Freundschaft, Solidarität aber auch die soziale Sicherheit zu schätzen wussten.“
„Glaubst du wirklich, dass es so schlaue Köpfe gibt, die solche komplexen und komplizierten Konzepte entwickelt haben und nun durchziehen, um einen weltweiten gesellschaftlichen Wandel, hin zum Sozialismus oder sogar zum Kommunismus zu verhindern? Wenn man bedenkt, dass...“ Katharina kam nicht mehr zum Ende ihren Ausführungen.
„Katharina,“ unterbrach Romy ihre Freundin nämlich heftig, „wenn ich solche Zusammenhänge,“ wobei Romy sich symbolisch und aggressiv auf die Brust schlug und das „ich“ besonders betonte, „als gestresste Hausfrau und Mutter schon als logische Zusammenhänge erkenne, willst du doch wohl nicht allen Ernstes anzweifeln, dass Apparate mit zig tausenden von Mitarbeitern und Millionenbudgets nicht in der Lage sind, solch ein Projekt „aufzusetzen“ und dann vor allem auch umzusetzen“? Immerhin geht es um richtig viel. Hier brechen ganze Strukturen und Machtverhältnisse zusammen. Es geht um einen totalen Paradigmenwechsel, sowohl in politischer aber auch wirtschaftlicher Hinsicht.“
Katharina schaute Romy erschrocken an. Lange hatte sie sie nicht so aufgebracht gesehen.
„Ich kann einfach diese Einwände nicht mehr verstehen,“ ergänzte sie mit Nachdruck. „Es wissen doch so viele, dass die Technologien längst entwickelt wurden. Und auch woher vielfach Erfindungen kommen. Der Konzern ist teilweise sogar so dreist, dass er, obwohl er die Gemeinden im Hinblick auf den Breitbandausbau regelrecht erst am langen Arm verhungern ließ, nun Eigeninitiativen wieder zunichte macht. Aber das muss er ja auch. Entwicklungen am Konzern vorbei, dezentral, sind vollkommen kontraproduktiv, sofern es nicht einen „doppelten Boden“ gibt, denn das Netz ist natürlich bereits weitaus breiter, wie man an den Verflechtungen auch mit Portalen, Service Providern und Plattformen unschwer erkennen kann. Das ist wie mit Schimmelpilz im Brot. Da kannst du oftmals auch nicht mit dem bloßen Auge die feinen Fäden erkennen, aber de facto kannst du letztendlich nur noch das gesamte Brot wegschmeißen.“
„Endlich mal ein Vergleich, den ich verstehe.“
„Hat sich z.B. eine Gemeinde entschlossen, selbst die Digitalisierung in die Hand zu nehmen, taucht nun plötzlich doch noch die Telekom auf, pocht auf ihr Recht als Grundversorger und verlegt parall dazu ihre Kabel. Und natürlich besteht sie als „Halbstaatskonzern“ mit staatlichem Auftrag darauf, dass ihre Leitungen genutzt werden. So buddeln die Kollegen teilweise die Straßen wieder auf und legen ihre Kabel parallel zu den anderen in die Schächte. Da fragt man sich doch, warum? Und den Gemeinden setzen sie die Pistole auf die Brust. Das kann doch nicht sein.“
„Gibt es denn nichts, was man dagegen tun kann?“
„Ehrlich gesagt, verstehe ich das auch nicht. Zumal, wenn die Strategie doch auch anderen bekannt sein dürfte. Die Telekom hatte offiziell zugestimmt, dass eine Gigabit-Zukunft nur mit Glasfasern als Grundgerüst möglich ist. Auch Hans Tittig. Paralle kam jetzt aber raus, dass sie weiter die guten alten Kupferkabel verbauen. Beispiel ist hierfür die Gemeinde Bergfeld im Landkreis Gifhorn, aber da gibt es natürlich noch mehr. Angeblich geht es um die Grundversorgung mit Telefon. Immer wieder betont die Telekom, dass sich der Ausbau mit eigenen Glasfaserkabeln wirtschaftlich nicht rechnet, weshalb man Kupferkabel einsetzt, was eine absolute Frechheit darstellt, wenn man bedenkt, mit wievielen Millionen der Konzern bereits gefördert wurde. Der Konzern zieht sich vor allem darauf zurück, dass es keine gesetzlichen Vorgaben gibt, die einen Ausbau mit Glasfaserleitungen vorsehen, sondern eben nur vom Breitbandausbau und der Digitalisierung sprechen. Aber niemand kann wirklich erklären, worin der Vorteil liegen soll, die optischen Signale, die über die Glasfasern kommen, in elektromagnetische umzuwandeln. Elektromagnetische Wellen bestehen aus gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern und werden auch als Strahlung bezeichnet. Bei den Kupferleitungen wandern also Elektronen von einem Ende zum anderen, bei Lichtwellenleitern, Photonen. Niemals kann ein Kupferkabel oder Funksystem an die Bandbreite eines Lichtwellenleiters heranreichen.“
„Und ich denke, du arbeitest vor allem im Gesundheitsbereich. Was hat das denn jetzt mit den Gesundheitsprojekten zu tun?“
„Na das kommt noch hinzu. Zum einen sind die Kupferkabel mit ihren elektromagnetischen Strahlen in keinem Fall gesundheitsverträglicher und zum anderen gibt es mehr Erfahrungen beim Absammeln der Daten für BigData-Analysen aus elektromagnetischen Übertragungsmedien. Diese werden vor allem dann für das weitere Clustern der Bevölkerung genutzt. Und gut geclusterte Zielgruppen sind gut steuerbare Zielgruppen.
Außerdem ging es auch hier darum, dass nicht direkte regionale Verbindungen geschaffen werden, z.B. wie es logisch wäre zwischen der Universität Greifswald und Mecklenburg-Vorpommern, sondern dass plötzlich telemedizinische Projekte aus dem Land mit Hamburger Kliniken umgesetzt werden.
Da gehen dann auch die Gesundheitsdaten in die privaten Datenpools zur weiteren ökonomischen Verwertung, und perspektivisch auch zur Manipulation oder eben für die wirtschaftliche Abhängigkeit der Bevölkerung.“
Katharina konnte erkennen, wie sehr Romy dieses Thema mitnahm, immer mit dem bedrückenden Gefühl, nichts daran ändern zu können, einer Übermacht an „krimineller Energie und strategischer Zukunftsplanung gegen die Menschheit“ gegenüber zu stehen, die man kaum stoppen können würde.
Neulich hatte Romy im Radio von einem Talkgast gehört, wie er meinte, dass die Digitalisierung viele „Stolpersteine“ mit sich bringen würde. Und Stolpersteine geisterten Romy noch in einem ganz anderen Zusammenhang durch den Kopf. Vielleicht lagen beide Rahmenkomplexe gedanklich gar nicht so weit auseinander.
„Es gibt bereits ein breites Portfolio an Instrumenten, um einen technologischen Totalitarismus durchsetzen zu können. Einfache Voraussetzung ist, jeden Menschen einem konkreten Cluster oder einem Feld in einer Matrix zuzuordnen, beschrieben durch konkrete Faktoren und Indikatoren. Außerdem werden durch dieses Vorgehen humane Störgrößen erkannt. Wenn diese nicht eindeutig einem klassischen Cluster12 zugeführt werden können, besteht optional dann die Möglichkeit, diese mit Disease Mongering kontrollierbar und steuerbar zu machen und dann einfach auszusortieren. Und ob dann noch jemand mit Stolpersteinen an diese erinnern würde?“
„Disease Mongering? Was ist denn das?“ Katharina schaute Romy erstaunt an. „Das habe ich noch nie gehört.“
„Da bist du sicher nicht die Einzige“, erwiderte Romy.
3 Nicholas Negroponte (geb. 1946 in New York), Informatiker, Prof. am MIT, Mitbegründer des Media Lab, 1968 - MIT Architecture Machine Group, Schnittstellenproblem im Rahmen der Mensch-Computer-Interaktionen, Publikation „Being Digital“, Prognose zur Verschmelzung der interaktiven Welt, der Welt des Entertainments, der Welt der Information. Wichtige Forschungsbereiche Affective Computing, Biomechatronics, „enhancing human physical capabilities“ - die Erweiterung der physischen Fähigkeiten des Menschen durch Technik, das Unsichtbare sichtbar machen, Blicke in den Körper mit Kameras, „artificial intelligence“, smart cities u.a..
4 MIT Media Laboratory, ggr. 1985 von Nicholas Negroponte und Jerome Wiesner. - Forschungsgebiet Medienkonvergenz, Mensch-Maschine-Schnittstellen, HAN - Human Area Networks, Manipulation des elektrischen Feldes des menschlichen Körpers, Auslesen mit Transceiver.
5 Datenübertragung per Handschlag. - vgl. auch https://www.teltarif.de/arch/2005/kw08/s16315.html.
7 Finke, Björn: Tiefseekabel. Wer diese Kabel durchtrennt, legt die Welt lahm. www.sueddeutsche.de/digital/internet-wo-die-daten-fliessen-1.3271953.
9https://www.handelsblatt.com/archiv/nortel-erwartet-19-2-mrd-verlustglasfaserindustrie-treibt-boersen_ins-minus/2074952.html?ticket=ST-454926-D7sLYObc4JHjsl1LmdCP-ap2.
10https://www.heise.de/tp/features/Die-Glasfaser-in-ihrem-Lauf-haelt-DSL-im-Osten-auf-3443663.html.
11 Deutsche Glasfaser Holding GmbH - 2011 ggr. Telekomunikationsunternejmen, von niederländischer privater Investmentgesellschaft Reggeborgh, Glasfaserausbau in NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern, seit 2015 amerikanischer Investor Kohlberg mit Anlagen von 131 Mrd. € Mehrheitsgesellschafter.
#02 Disease Mongering?
Katharina und Romy saßen mittlerweile nun schon viele Tage und Wochen zusammen, um die Fragen aufzuarbeiten, die sich bei Romy durch ihre Tätigkeit im Telekommunikationskonzern sowie aus ihren Mobbingskandal ergeben hatten.
Manchmal trafen sich beide in Romys kleinem Miethaus in Bad Worast, manchmal in Berlin, in einem belebten Café oder in einem stillen Restaurant. Meistens hatte Katharina ihr Aufnahmegerät dabei, weil es ihr als Journalistin auch darum ging, herauszufinden, welche Geschichten sich daraus schreiben ließen und vor allem für wen, wann und wo. Der Medienwald für Veröffentlichungen stand voller „Bäume“. Aber welcher Baum zu dieser Romy-Story am besten passen würde, war ihr bisher nicht klar. Dabei stellten sicherlich die emotionalen Verwirrungen und die sonderbaren Erlebnisse von Romy den spannendsten Teil der Geschichte dar. Und wenn es nach Katharina gegangen wäre, hätte sie am liebsten nur den Sonderbarkeiten im Alltag von Romy gelauscht. Aber Romy liebte es, daraus gleich irgendwelche Schlüsse abzuleiten, Hypothesen aufzustellen, so dass sich die Aufarbeitung dieser Erfahrungen hinzog, da sie oft bei ihren Erzählungen vom Hölzchen aufs Stöckchen kam.
Gut nachvollziehen konnte Katharina allerdings die auslösenden Elemente für Romys Reflexionen und die sehr komplexen Fragen, die vor allem im mehr als komischen Verhalten ihrer Kollegen, aber auch der Führungsebene ihr gegenüber, lagen. Dabei tappte Romy anscheinend vielfach immer noch im Dunkeln und hangelte sich von Hypothese zu Hypothese, warum ihr all das passierte, was ihr passierte. Aber sie war sich sicher, dass es dabei um weit mehr ging, als nur um ihre Person.
„Wie soll ich mich der Klärung eines so globalen „Rätsels“ nähern, wenn ich überhaupt nicht meine Rolle in diesem Spiel verstanden habe?“, fragte sie zeitweise Katharina.
Mehr rhetorisch. Und mehr, als Entschuldigung dafür, dass sie noch eine weitere Hypothese betrachten musste oder dringend noch eine weitere Recherche für notwendig erachtete. Mittlerweile betrachtete Romy alles Erlebte als erklärbar und logisch nachvollziehbar, wenn sie erst einmal in ihrem direkten Umfeld und im direkten Bezug zu ihrer Person verstehen konnte, was da um sie herum geschah. Vor allem aber immer wieder, warum?
Und mit welchem Ziel?
„Eigentlich ist das ein sehr weites Feld, was ich zu einem anderen Zeitpunkt und nicht wirklich im Kontext des Resilienz-Themas betrachten wollte. Aber sicher steht es damit in ganz engem Zusammenhang.“
„Disease Mongering? Na los. Ich fände es gut, wenn du mir das jetzt kurz erklären könntest. Und vor allem, warum du meinst, dass das mit deinem Mobbing- und dem Konzernskandal zu tun hat.“ Katharina drückte die Taste des Aufnahmegerätes und lehnte sich entspannt im Sofa zurück. Sie wusste, dass sie jetzt erst einmal eine Weile Pause haben würde, wenn Romy mit
Disease Mongering:
Krankheitserfindung. Dabei werden normale gesundheitliche Entwicklungen, aber auch Wahrnehmungen, Gedanken oder soziales Verhalten pathologisiert und zu Krankheiten stigmatisiert. Eine normale Traurigkeit wird als Depression diagnostiziert, familiäre Konflikte oder mangelnde Bewegung finden Ausdruck in Hyperaktivitätsstörungen. Ziel ist die zunehmende Medikalisierung der Gesellschaft. Menschliche Lebensbereiche aber auch die Möglichkeiten des Eingriffs in Lebensläufe geraten immer mehr in den Mittelpunkt meidzinischer und klinischer Forschungen wobei vor allem dabei der Einfluss auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen genutzt wird. [Quelle u.a. nach Wikipedia] dem Erzählen beginnen würde.
„Eyyyhheyy“, schallte es plötzlich dumpf und laut durch die Wände des kleinen Häuschens, in dem Katharina und Romy zusammensaßen. Der Schrei erschreckte Katharina genauso wie Romy. Sie waren sonst absolute Stille um sich herum gewohnt. Bis auf die Ausnahme, dass sich von Zeit zu Zeit der Rettungshubschrauber des benachbarten Klinikums zu einem Notfall in der Region auf den Weg machte oder manchmal vormittags die Kinder aus der benachbarten Schule von ihren Eltern abgeholt wurden, um sich dann mit lautem Gejohle in die wartenden und brummenden Fahrzeuge zu fädeln.
Nachdem Romy realisiert hatte, woher dieses furchteinflößende Geschrei kam, musste sie grinsen. „Heute spielen die alten Herren“, erläuterte sie. „Der Sportplatz grenzt ja fast direkt ans Grundstück. Aber es finden eigentlich selten Spiele statt. Ein Wunder, dass wir nicht schon vorher etwas gehört haben. Die Herrenmannschaft schreit viel. Vor allem immer nach dem Ball - „Schieß her, du Blödmann! Man, kannst du nicht gucken? Mensch, renn doch mal!“ Und eben dieses Eyyyhhh oder andere Laute. Wenn man nur diese Wortfetzen aus der Ferne mitbekommt, hat man den Eindruck, die Spieler stehen nur rum und pflaumen sich an. Viel Bewegung scheint dann auf dem Platz nicht stattzufinden. Aber wahrscheinlich ist das ungerecht. Komischerweise hört man die Jugendmannschaft allerdings kaum. Vielleicht haben die Jungs aber einfach noch nicht so kräftige Stimmen.“
„Oder vom Rennen keine Puste mehr“, mutmaßte Katharina. Gehst du manchmal zu einem Spiel?“
„Ich wollte schon mal. Vor allem Mia möchte gern. Aber bisher habe ich es irgendwie noch nicht geschafft. Leider war ich bisher auch nur einmal im Vereinshaus. Es wäre bestimmt lustig, ab und zu abends nur über den Platz zu stolpern und dann ein Bierchen mit den Spielern zu zischen. Aber ich bin ja leider keine Fußballfrau und habe auch sonst keine Verwandschaft in der Mannschaft.“
Romy lachte über den eigentlich nicht beabsichtigten Spruch.
„Dann lach dir doch einen Spieler an! Wäre doch sehr praktisch, oder? Hast du es nicht mal wieder nötig?“ Katharina fand es lustig, Romy mit ihrem momentanen Singledasein aufzuziehen.
„Hey, du musst gerade lästern. Das sieht ja bei dir auch nicht besser aus. Ich habe wenigstens noch Mia als Argument. Aber ich fühle mich im Moment auch so alt. Der Konzern hat mich gefühlt Jahre gekostet. Dadurch scheint dieses Thema bei mir irgendwie „durch“ zu sein.“
„Ich weiß, lieber beschäftigst du dich mit deinem Skandal.“
„Das ist ungerecht. Im Moment bin ich mir noch nicht bewusst, dass ich mir dieses Schicksal selbst ausgesucht hätte. Ist eben alles irgendwie blöd gelaufen. Ob geplant oder nicht. Aber ändern kann ich daran nun auch nichts mehr. Und ich kenne es ja nicht anders.“
„O.k., dann lass uns mal mit dieser Medikalisierung weitermachen.“
Katharina schob ihren Schreibblock zurecht, spulte das Aufnahmegerät auf den Anfang zurück, mit der Bemerkung: „Den privaten Fußballkram müssen wir ja nicht festhalten“, und drückte erneut die Aufnahmetaste. Und Romy begann, weiter aus ihrem Konzernalltag und von ihren Beobachtungen zu berichten:
„Weißt du, auch bei dem Disease Mongering ist es wie bei der Medikalisierung. Es wird zum Beispiel von der richtigen Annahme ausgegangen, dass diese Begriffe vor allem im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Interessen entstanden sind und dementsprechend natürlich auch eine nicht unerhebliche finanzielle Komponente aufweisen. Dabei wird auch erläutert, dass ganze Berufszweige wie Pharma- und Medizintechnikunternehmen, Kliniken, Wellness- und Kurbetriebe, Universitätsinstitute, Wissenschaftler, Testlabore, Forscher, Buchverlage und deren Autoren von diesen Phänomenen profitieren. Allerdings werden dann solch unsinnige Erkrankungen wie Kreditkartenischias oder Rummelplatzschlaganfall angeführt.
Dass es bei der Medikalisierung aber nicht um solch absurde Krankheitsbilder geht, sondern bereits die einfachen Volkskrankheiten wie Diabetes, Asthma, Allergien, Herzinfarkte und vor allem die psychischen Erkrankungen wie Burnout, Borderline Syndrom, Depression, Schizophrenie, Paranoia aus dem „Erfindungslab für Erkrankungen“ stammen, wird nicht in einem solchen Zusammenhang diskutiert.“
„Du meinst, dass alle diese Erkrankungen nur ausgedacht sind?“
„Natürlich nicht nur ausgedacht, aber eben auf eine gewisse Art durch das System „entwickelt“, „konzipiert“ und genutzt, auch als Selbstschutz und mit der Möglichkeit, die eigene Existenz zu sichern. So werden solche politisch und gesellschaftlich korrekt beobachteten Phänomene als absurd dargestellt.“
„Aber, dass Krankheiten im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Verhältnissen stehen, ist ja nichts neues. Umsonst gibt es doch nicht so volkstümliche Sprüche, wie „Doof frisst viel, oder Intelligenz säuft“ und verbindet in diesem Zusammenhang auch bestimmte Erkrankungen.“
„Ja, aber es ist ein Unterschied, ob sich die Gesellschaft entwickelt und ich schaue mir dann zum Beispiel die im Zusammenhang stehenden gesundheitlichen Phänomene an, oder ich überlege, wie ich am Zustand von Körper und Geist herummanipulieren kann, um den Menschen dann, in ein von mir gewünschtes Gesellschaftssystem optimal einzupassen.“
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ärzte und Wissenschaftler soweit gehen würden.“ Katharina zeigte sich skeptisch.
„Jetzt auf die Menschenversuche im Dritten Reich zu verweisen, führt an dieser Stelle zu weit, aber es wurde bereits schon vor Jahrzehnten dazu geforscht, wie Krankheiten und Gesellschaft sich wechselseitig bedingen. Zum Beispiel wird im Zusammenhang mit der Medikalisierung darauf verwiesen, dass durch die Erforschung menschlicher Lebenserfahrungen und Lebensbereiche auch ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess einsetzt, was vorher natürlich außerhalb der Medizin stattfand. Diesen Medikalisierungsprozess, als der Analyse des menschlichen Lebens, begann bereits im 18. Jahrhunderts13. Beim Wiki-Eintrag wird dann dieses Konzept aber auf einen Ivan Illich zurückgeführt, der erst 1926 in Wien geboren wurde und der gemeinsam mit Ernst Ulrich von Weizsäcker zum Beraterkreis des damaligen Magazins „Technologie und Politik“ gehörte. Illich vertrat extreme Ansichten, wie die Abschaffung der Schulen, erhielt einen Kultur- und Friedenspreis, der 1998 von der Villa Ichon vergeben wurde. An dieser Stelle schließt sich für mich schon logischer der Kreis.“
„Das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Was meinst du?“
„Na, die Villa Ichon wurde 1849 von Heinrich Depken erbaut, dann1871 für einen R. Feuerstein durch Johann Georg Poppe umgebaut14, der auch zahlreiche Aufträge für wohlhabende Bürger, renommierte Unternehmen, aber z.B. die Ausstattung des schnellsten Atlantikdampfers der Welt übernahm. Und wie es immer so ist, gibt das Internet nun keinerlei Auskunft mehr darüber, wer dieser R. Feuerstein im Jahre 1871 war. Sonst findest du ja in Wiki fast immer Links zu den Personen, die in Artikeln erwähnt werden. Zumal es sich ja bei der Villa noch um ein zeitgenössisches „Gebäude“ handelt. Allerdings findet man etwas über einen Reuven Feuerstein geb. 1921 in Rumänien. Und auch Illich wird in seiner Vita als römisch-katholischer Kroate mit jüdischen Vorfahren beschrieben. Er verkehrte als Kind im Hause Sigmund Freuds, zu dessen Freunden die Familie zählte. Und Reuven Feuerstein15 war ein israelischer Psychologe, der sich mit der Verbesserung des Lernpotentials auseinandersetzte und dazu auch ein Internationales Zentrum (ICELP) dafür in Jerusalem gründete. Besonders beschäftigte er sich mit der Entwicklungspsychologie. Er gründete die Feuerstein Institute, wo besonders die klinischen und kognitiven Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen erforscht wurden. Feuerstein vertrat die Ansicht, dass jeder, unabhängig von Alter, Ethnologie oder auch Handicaps in der Lage wäre, seine Intelligtenzkurve zu steigern. Mit der Feuerstein-Methode16 wird hunderten und tausenden Menschen geholfen, ihr Lernen, Denken und ihre analytischen Fähigkeiten zu verbessern. Der Großvater von Illich war der Bauherr Fritz Regenstreif, der als Holzindustrieller in Bosnien und Herzegowina zu Wohlstand gekommen war. Alles natürlich laut Wikipedia. Illich beschrieb im Alter von elf Jahren sein Empfinden und Denken am 10. März 1938, zwei Tage vor dem Anschluss Österreichs. Großvater Regenstreif verhinderte, dass die Familie ermordet wurde und konnte sie und ihr Leben „freikaufen“.“
„Romy, ich verstehe diesen Bogen jetzt überhaupt nicht“, unterbrach Katharina die Ausführungen ihrer Freundin. „Was hat das mit Disease Mongering oder Medikalisierung zu tun?“
„Du hast recht, der Bogen ist vielleicht etwas weit gespannt. Wichtiger ist eigentlich, den Fokus auf das „Information hiding“ zu richten, also nicht die Fakten, die man nachlesen kann, sondern die Fakten, die „zwischendurch“ fehlen. Wenn du dir zum Beispiel Wikipedia anschaust, dann findest du zu vielen fast alles. Wenn also in einem Artikel erwähnt wird, dass eine so bedeutende Villa mit dem Namen Villa Ichon, die heute noch Kultur- und Friedenspreise vergibt im Auftrag für jemanden umgebaut wurde und es keinen Link zum Anlass gibt, keinen Link zu dem, was diesen Menschen ausgezeichnet hat oder reich gemacht hat, es aber parallel einige Jahre später eine direkte Beziehung zu zionistischen Aktivitäten im psychologischen Kontext, zu Wien, zu Sigmund Freud, zu den Feuerstein Instituten, zur Medikalisierung gibt, dann unterstützt diese Erkenntnis meine Hypothesen, dass vor allem die gesellschaftlichen Strömungen, beispielhaft gegenwärtige Aggressionen, Angst etc. zentral gesteuert werden, Teil einer psychologischen Kriegsführung oder besser eines gesteuerten „Gestaltungsprozesses“ sind, und die Ergebnisse dieser Forschungen als Machtinstrumentarium genutzt oder besser missbraucht werden, um diese auch weiterhin zu beeinflussen. Bereits 1980 wurden dynamische Systeme entwickelt, auch im Rahmen dieser Insitute, um die Kognition zu modifizieren oder operativ Menschen mit Down Syndrom zu modifizieren, ihnen mit plastischer Chirurgie zu einem besseren Leben zu verhelfen. Mit Aussagen wie: „Don‘t accept me as I am.“ liegen Ziele der Optimierung menschlichen Verhaltens sehr nahe. Zentrale Instrumente sind dabei MLE - Mediated Learning Experience, LPAD - Learning Propensity Assessment Device und IE - Instrumental Enrichment. Wenn man jetzt ganz weit den Bogen schlägt, kommt man zu Scientology, der neuen religiösen Bewegung, die ja auch durch ihre Begrifflichkeiten zu Verwirrungen beträgt. Ehrlich gesagt, war ich in meiner Jugend auch mehr als naiv. Scientologie hörte sich für mich so an, als wenn das etwas mit Wissenschaft zu tun hätte. Aber so verkauft es sich ja auch. Der Begriff leitet sich aus den Begriffen Wissenschaft und Wissen sowie Logos, abstammend von Wort, Rede oder Logik ab und die Scientology Kirche wird mit dem Wissen über das Wissen übersetzt.“
„Das ist aber nun wieder eine ganz andere Baustelle, oder?“
„Natürlich ist das ein weites Feld. Das geniale besteht überall darin, dass weltweit soziale, politische, selbst wissenschaftliche Begrifflichkeiten unscharf und missverständlich „gestaltet“ werden, die Abhängigkeiten so unklar, die Zusammenhänge so unpräzise, dass es einen riesigen Berg an Methoden, philosophischen Model