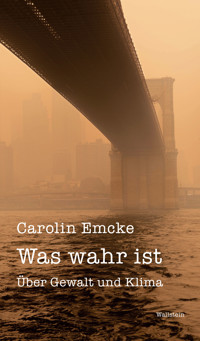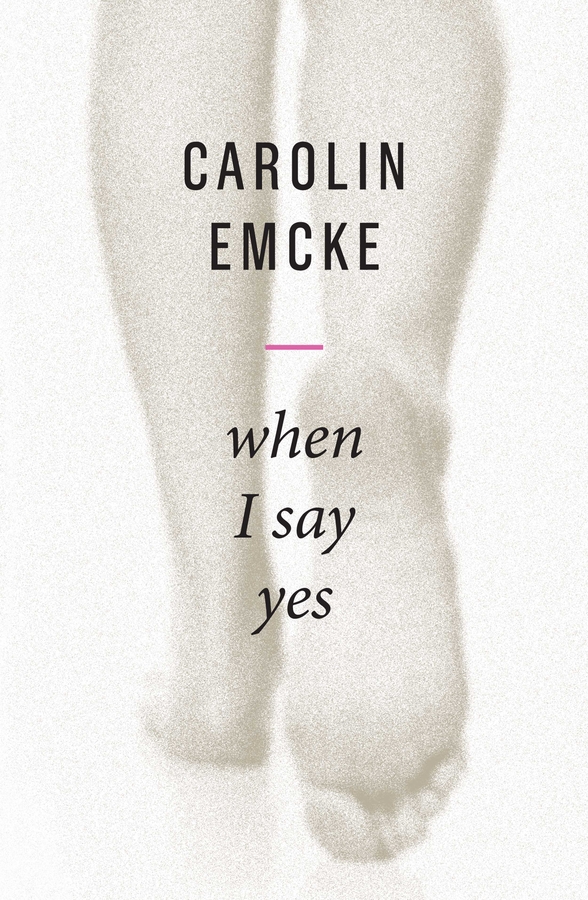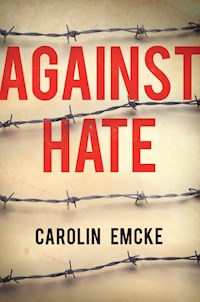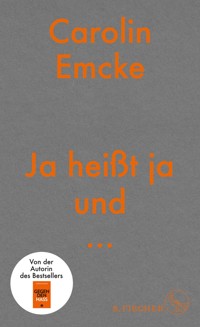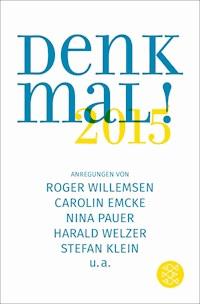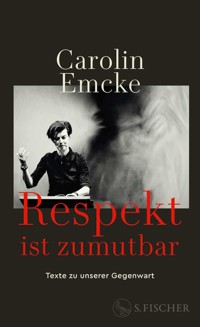
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie umgehen mit Gewalt und Menschenfeindlichkeit? Was lässt sich autoritären Regimen und Angriffen auf Freiheit und Gleichheit entgegensetzen? Und was bedeutet Humanismus heute? Carolin Emcke ist eine Zeitzeugin, die kosmopolitisch und lokal denkt. Mit unbestechlichem Blick seziert sie soziale und politische Konflikte und fordert zum Widerspruch gegen Ausgrenzung und mangelnde Empathie. Sie fragt: wer wollen wir sein in Zeiten der Zerstörung von Demokratie und Wahrheit? Dieser Band versammelt die besten Kolumnen und Reden Carolin Emckes aus den letzten zehn Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Carolin Emcke
Respekt ist zumutbar
Texte zu unserer Gegenwart
Über dieses Buch
Wie umgehen mit Gewalt und Menschenfeindlichkeit? Was lässt sich autoritären Regimen und Angriffen auf Freiheit und Gleichheit entgegensetzen? Und was bedeutet Humanismus heute? Carolin Emcke ist eine Zeitzeugin, die kosmopolitisch und lokal denkt. Mit unbestechlichem Blick seziert sie soziale und politische Konflikte und fordert zum Widerspruch gegen Ausgrenzung und mangelnde Empathie. Sie fragt: Wer wollen wir sein in Zeiten der Zerstörung von Demokratie und Wahrheit?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Carolin Emcke studierte Philosophie in London, Frankfurt a. M. und Harvard. Sie bereiste weltweit Krisenregionen und setzt sich in ihren Essays mit Gewalt, Demokratie und Menschenrechten auseinander. Ihre Bücher wurden in über 15 Sprachen übersetzt. Vielfach ausgezeichnet u.a. mit dem Friedenspreis des Dt. Buchhandels, dem Carl-von-Ossietzky und dem Soul of Stonewall Preis. In der Berliner Schaubühne kuratiert sie seit über 20 Jahren den »Streitraum«. Carolin Emcke lebt in Berlin.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Texte von Carolin Emcke sind zwischen 2014 und 2024 im Rahmen ihrer monatlichen Kolumne in der Süddeutschen Zeitung erschienen. Ihren SZ-Podcast »In aller Ruhe« finden Sie unter sz.de/thema/In_aller_Ruhe.
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Coverabbildung: Gianmarco Bresadola
ISBN 978-3-10-492320-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Vorwort
2014
Hinschauen
Toleranz
Leise Töne
Das Richtige
Zu viel
Von draußen betrachtet
2015
Gewölk
Trost der Dinge
Diktat des Tabus
Rechte haben
Gleichstellung
Schibboleth
Macht
Übersetzen
Heimat
Kopf über Wasser
Irren
Singular
Geben
2016
Namen
Fehlleistungen
Geräusche
Orlando
Unwirklich
Zuhören
Aleppo
Zäsur
Normalität
2017
Seifig
Gewissensfragen
Wir
Lernen
Autonomie
2018
Gemeinnutz
Ablenkung
Antastbar
Entgrenzt
Außen
Manipulation
2019
Entpolitisiert
Medium
Dissens
Raus bist du
Travestie
Ideologisch
Giftig
Heilige Unordnung
2020
Was rettet
Finsteres Erbe
Nötige Zumutung
Weil man ihn lässt
Was bleibt
2021
Falsche Propheten
Die Katastrophe
Übersehen
Abschied
Nicht vorbei
Fanatiker sind’s
2022
Trauer
Braunes Wasser
Beschämung
Wahre Freiheit
Zu banal, zu bös
Schutzlos
2023
Kipp-Punkte
Rotwesten
Eine Schande
Nutzloses Glück
Die Maulhelden
Die toten Winkel
Der Fingernagel
2024
Fürs gute Leben
Schluss damit
An der Zeit
Nicht ducken
Wohin?
Echt jetzt?
Es ist peinlich
Es geschieht
Es ist möglich
2025
Wir sind die normalen Leute
Respekt ist zumutbar
für Imran Ayata
Vorwort
Es begann mit einer Portion Fritten.
Es war Sommer 2014, als der damalige Chefredakteur Kurt Kister mich einlud, im wöchentlichen Rhythmus für die Süddeutsche Zeitung zu schreiben. Die Proteste auf dem Majdan in Kiew waren mit Gewalt zerschlagen worden, Russland hatte die Krim besetzt, der Islamische Staat terrorisierte den Irak und begann den Völkermord an den Jesiden. In Ferguson, Missouri, war Michael Brown von einem weißen Polizisten erschossen worden, und aus den Protesten sollte »Black Lives Matter« als Bürgerrechts-Bewegung wachsen. In den USA regierte noch Präsident Barack Obama und hier noch Angela Merkel. Die AfD war gerade mal ein Jahr alt. Den Einzug in den Bundestag bei der Bundestagswahl 2013 hatte die Partei verpasst. Im Vorstand saßen noch Bernd Lucke und Frauke Petry. Ach so: Und in Brasilien war die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer Weltmeister geworden. Beim Halbfinal-Spiel gegen den Gastgeber hatte ich den Spielstand auf meinem Fernseher abphotographiert, weil ich es nicht glauben konnte.
Es konnten philosophische Miniaturen sein, politische Betrachtungen, distanzierte oder undistanzierte Reflektionen auf die Gegenwart. Es war (und blieb) ein ungeheuer großzügiges Angebot. Ich würde über entlegene Gegenden schreiben dürfen oder über meine Nachbarschaft, ich könnte so selbstverständlich meiner Verbundenheit zum Nahen Osten nachgehen wie meiner Passion für klassische Musik. Es gab keine Vorgaben, keine Tabus. Ich ahnte nicht, wie sehr diese Aufgabe meine Zeit, mein Denken, meinen Alltag strukturieren würde. Wer die Gegenwart schreibend beobachten will, kann nicht aussteigen. Feiertage, Urlaube, Reisen, es spielt keine Rolle, Kolumnen-Woche ist Kolumnen-Woche.
Eigentlich hatte ich ein Buch schreiben wollen.
Dafür würde die ersten zwei Jahre keine Zeit sein. Aber das ahnte ich nicht.
Ich futterte die Fritten auf und sagte zu.
Es war eine unglaublich intensive Zeit, die Jahre von Oktober 2014 bis Ende 2024 als Chronistin zu begleiten: vom Krieg in Syrien, dem Herbst der Migration 2015, dem Brexit, den Pegida-Demonstrationen und dem Aufstieg der AfD, der Wahl von Donald Trump 2016, über die Klimaschutz-Bewegungen und das tiefgreifende Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Freiheitsrechte der nachfolgenden Generationen bestärkte, die Anschläge von Halle und Hanau, der Fall Afghanistans, der russische Angriffskrieg in der Ukraine und zuletzt das Grauen des 7. Oktober und der Horror des Krieges in Gaza.
Die Texte waren historische Moment-Aufnahmen. Zunächst im wöchentlichen, später im monatlichen Rhythmus geschrieben, halfen sie mir, die politischen, sozialen, kulturellen Ereignisse zu verstehen. Mal waren es literarische, mal philosophische Bezüge, mit denen ich der Gegenwart beizukommen versuchte, mal musste ich mir etwas vom Leib halten, mal konnte ich nur mit unverborgener Subjektivität schreiben. Manches ging unter die Haut und nistete sich ein. Im Rückblick auf diese zehn Jahre weiß ich noch heute genau, was mich am meisten erschüttert und betroffen hat, wo mir jedes Wort schwerfiel: der Fall von Afghanistan, die russische Invasion in der Ukraine, der Anschlag auf einen schwulen Club in Orlando oder auch der NSU-Prozess und die Urteilsbegründung. Die Liste ist lang. Es gab auch Momente des Glücks und die Freude über das, was gelungen ist: die große Hilfsbereitschaft im Herbst der Migration 2015, die sozialen Bewegungen, die Demonstrationen für Menschenrechte und Demokratie, das Engagement für Klimaschutz, die Fähigkeit zum Anfangen, die Bereitschaft, sich nicht wegzuducken, sondern miteinander und füreinander zu sprechen.
Was beim Schreiben punktuelle Ereignisse waren, lässt sich nun als Kontinuitäten globaler Umbrüche erkennen: der autoritäre Pol der Gewalt in Putins Russland, die außer-staatliche Macht der Tech-Giganten und die systematische Absage an Wahrheit und Information als unverzichtbare Güter, die Radikalisierung und Brutalisierung rechtsradikaler Bewegungen und ihrer parlamentarischen Ableger – das alles verweist auf die eigentliche Zeitenwende: die Aushöhlung demokratischer Prinzipien, die Aufkündigung rechtsstaatlicher und völkerrechtlicher Verpflichtungen. Das geschieht mal im Modus des Stammtisch-haften Spotts, mal in offener Verachtung regelbasierter internationaler Ordnung und Institutionen.
Nicht alle Texte finden sich in dieser Sammlung. Aus Platzgründen musste manches aussortiert werden. Dadurch gibt es Lücken, die vielleicht verwundern. Manches würde ich heute anders schreiben. Manches ärgert mich nachträglich. Aber Schwächen oder Fehleinschätzungen wurden nicht bereinigt. Die Texte blieben unangetastet. Der Zweifel schreibt und liest immer mit. Wer die Gegenwart reflektiert, wer in eine demokratische Öffentlichkeit hinein sprechen und intervenieren will, muss sich selbstkritisch fragen: Was habe ich übersehen, was muss anders klingen, anders adressiert werden, was bedingt und was entstellt mein eigenes Schreiben? Das ist einer der Gründe, warum ich nach zehn Jahren aufgehört habe. Es brauchte mehr Ruhe. Es brauchte eine Unterbrechung, um danach vielleicht anders zu intervenieren.
Zuletzt sind auch zwei Reden auf Demonstrationen Anfang 2025 mit aufgenommen. Die Normalisierung der Rechtsradikalen und ihrer schäbigen Agenda im Parlament verlangte nach zivilgesellschaftlichem Widerspruch. Das ist ein anderes Genre. Eine andere Aufgabe. Ich fürchte, der Bedarf wird eher steigen in den kommenden Jahren.
Ich bleibe ungeheuer dankbar zurück. Dankbar für die Süddeutsche Zeitung und die wunderbaren Menschen dort, die mich ausgehalten und verbessert haben. Dankbar für den Zuspruch aller, die mir geschrieben oder mich angesprochen haben. Die Demokratie wird von allen gemacht. Sie ist nichts, das gesichert ist, die Demokratie ist nichts, das man besitzt, sondern etwas, das man tut. Die Versprechen des Grundgesetzes sind eben das: Versprechen. Sie müssen anerkannt, beansprucht, bestätigt, verteidigt werden. Von allen. Jeden Tag. Dazu braucht es Mut und Langmut so wie es Ungeduld und Leidenschaft braucht.
Es bleibt die Überzeugung: Respekt ist zumutbar. Immer.
Berlin, Juli 2025
2014
18. Oktober 2014
Hinschauen
»Hüter, ist die Nacht bald hin?«, in der Zeile aus dem »Lobgesang« von Mendelssohn Bartholdy, den alten Worten aus dem Buch Jesaja, klingt das furchtsame Unbehagen an, das mancher in diesen Tagen spürt: »Hüter, ist die Nacht bald hin?« möchten wir flüstern angesichts der Nöte und Krisen, deren Zeugen wir werden. Die simultane Dringlichkeit der Konflikte zwischen der Ukraine und Russland, in Syrien und im Irak, bis vor Kurzem zwischen Gaza und Israel, die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der Heimaten vernichtet oder verschoben werden, und die unheimliche Entgrenzung der Gewalt, das verfolgen wir, von morgens bis nachts – und möchten nurmehr, dass es heller werde.
Wir schauen zu, wie türkische Soldaten dabei zuschauen, wie Kurden in Kobanê im Kampf gegen die IS-Miliz sterben, eben jene Kurden, die fast allein die staatliche Einheit des Irak verteidigen sollen, denen aber ein eigener Staat nicht zugestanden wird. Wir schauen zu, wie Zivilisten in der Ostukraine an der Bruchlinie Europas zerrieben werden. Wir schauen zu, wie junge Studenten in Hongkong bewusstlos geknüppelt werden, während sie für Bürgerechte demonstrieren, wir schauen zu, wie junge Journalisten, muslimische oder jüdische oder katholische, gefoltert und getötet werden. Wir schauen zu, wie Flüchtlinge, die an ein Europa der Menschenrechte noch glauben, sich an unseren Grenzzäunen den Leib aufreißen oder vor unseren Stränden ertrinken. Und unsere eigene passive Zeugenschaft wird fraglich.
Wie lange wollen wir so zusehen? Wie lange können wir zusehen? Wer sind wir, die wir da jeden Tag, jeden Moment, gewissermaßen im Liveticker, Menschen im Wendekreis des Elends betrachten?
Wer sind wir, die wir, unbewusst oder bewusst das Leid auch noch hierarchisieren, die wir unterscheiden und werten, je nach eigener religiöser Zugehörigkeit, kultureller oder ethnischer Prägung, je nach Hautfarbe oder Geschlecht, dann noch manche Gewalt erschütternder als andere empfinden. Weil uns die einen näher sind als die anderen.
Die amerikanische Autorin Susan Sontag glaubte einst noch, dass das Betrachten des Leids der anderen die Zuschauer mitunter mit einer gewissen Erleichterung erfüllen könnte. Wie immer groß die »Tele-Intimität aus Tod und Zerstörung« (Sontag) auch sein mochte, Zuschauen bedeutete eben auch, nicht dort zu sein, nicht bedroht zu sein, nicht schutzlos zu sein, bedeutete die Gnade, verschont zu sein von jenem Leid. In dieser Hinsicht konnte sich im Leid der anderen auch das eigene Glück spiegeln.
Das ist vorbei. Auch uns, den »Ungeprügelten«, wie der österreichische Schriftsteller und Widerstandskämpfer Jean Améry es nannte, drängt sich der Eindruck der unbehaglichen, möglicherweise endlichen Privilegiertheit auf.
Ich bin nicht sicher, woran das liegt. Vielleicht, weil wir an dem Leid der anderen weniger unbeteiligt sind, als es die Entfernung suggeriert. Wer kann die Erzählungen der versklavten, vergewaltigten jungen Mädchen aus Syrien und dem Irak hören, ohne sich zu befragen, was der Aufstieg des IS mit der westlichen Intervention und all den verlogenen Versprechungen von nation building und Demokratie zu tun hat? Wer kann die Bilder von gefolterten Zivilisten in orangefarbener Kleidung anschauen, ohne sich zu befragen, was das mit Abu Ghraib und Guantanamo zu tun hat? Wer kann den Bericht von Amnesty International über die Verbrechen der irakischen Regierung oder ihrer Vertrauten an der sunnitischen Bevölkerung lesen (etwas, das bei dem Fokus auf den IS gern überlesen wird) und sich nicht fragen, wer diese sektiererische Gewalt zu lange geduldet hat?
Schließlich: Es gibt keine Unschuld des Nicht-Wissens mehr. Wir können selten behaupten, von einer noch so entlegenen Krise nichts gewusst zu haben. Wir erfahren von Kriegsverbrechen oder Völkermord nicht nachträglich, sondern zeitgleich.
Gewiss, es gibt nach wie vor Kontroversen um gültige Beweise, nach wie vor wird gelogen, um ein eindeutiges Urteil über Täter und Tat hinauszuzögern. Gewiss, auch abzüglich aller propagandistischen Manöver bleiben manche Situationen unübersichtlich und unentwirrbar. Gewiss, manche Konflikte beschädigen alle Seiten, lassen die Gegner mit der Zeit grausam ununterscheidbar wirken. Aber Krieg und Gewalt lassen sich nicht mehr auf Abstand halten. Sie rücken uns auf den Leib. Wir sind dauernd unbeteiligt beteiligt. Das ist der ethische Preis des politisch-medialen Versprechens der einen Welt.
Manchmal fürchte ich, er ist zu hoch. Manchmal, wenn die Nacht noch lang ist, empfinde ich dieses unbeteiligt Beteiligtsein als eine moralische Zumutung. Weil es mich überfordert. Weil ich mich verantwortlich fühle, aber keine aktionistischen Antworten weiß. Auf keinen dieser Konflikte. Und dabei kenne ich einige dieser Regionen recht gut. Und dabei wünschte ich nichts lieber, als dass ich den Freundinnen dort, die mir lustige E-Mails schicken, um mich aufzuheitern, helfen könnte.
Aber ich habe keine Handlungsanweisungen. Schon gar keine militärischen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es fahrlässig wäre, aus reiner Verzagtheit jetzt die Fragen so abstrus zu formulieren, dass die Antworten falsche Alternativen aufmachen – nur, damit wir uns kurzfristig besser fühlen.
Aus einem politischen und moralischen Dilemma hilft keine Abkürzung des Denkens. Ein gutes Gewissen ist manchmal allein der voreilige Vorzug einer bequemen Position. Was tun?
In Mendelssohns »Lobgesang« heißt es an anderer Stelle: »Er zählet unsere Tränen in der Zeit der Not«, nicht wegzuschauen, nicht aufzugeben, den Schmerz und Kummer jeder einzelnen zu zählen. Nichts zu nichtig, zu häufig, zu gering zu nehmen. Das klingt so tröstlich wie unmöglich, aber: Nur so kann es heller werden.
15. November 2014
Toleranz
Neulich, beim Einsteigen ins Flugzeug, entstand jene Sorte Nähe zu wildfremden Menschen, die einem ungefragt deren Unterhaltung aufnötigt. Es war früher Nachmittag. Der Abflug hatte sich verspätet. Alle schoben dicht gedrängt dem Ausgang zu, als einer der Geschäftsleute in der Schlange hinter mir zu seinen Kollegen sagte: »Also, ich mach jetzt mal vier Tage Homo…«
Wie bitte? Schlagartig interessierte mich nun ihr Gespräch. Was war das für ein Konzept? Vier Tage hetero-, vier Tage homosexuell? Eine Art Rotationsprinzip für sexuelle Orientierung? Grandiose Vorstellung. Umgehend malte ich mir aus, wem ich einmal eine solch viertägige Exkursion wünschen würde. Ich fragte mich, ob das ginge, ob sich so einfach mal eine andere Sexualität leben ließe. Ob ich »mal vier Tage heterosexuell« leben könnte? Und wenn nicht, warum nicht?
Wie wäre das für andere individuelle Neigungen oder Merkmale einer Person? Vier Tage Bayern Fan – da wüsste ich immerhin, welche Tage ich mir aussuchen würde – und vier Tage Anhänger der Münchner Löwen; vier Tage Hedgefonds-Manager, vier Tage LKW-Fahrer. Welche Präferenzen der eigenen Person, der Identität, ließen sich ablegen, welche ließen sich wandeln? Ich stellte es mir leichter vor, vier Tage als gläubige Katholikin zu leben, als auch nur zwei Tage als Helene-Fischer-Fan. Definitiv leichter. Ist also Glaube leichter austauschbar als musikalischer Geschmack? Oder geht das nur deshalb so einfach, weil ich wüsste, dass ich nach vier Tagen wieder heraustreten könnte aus dieser Erfahrung?
Schwieriger wäre das bei unfreiwilligen Besonderheiten einer Person, die mit Einschränkung oder Ablehnung einhergehen: vier Tage gehörlos, vier Tage hörend; vier Tage Hämophilie-krank, vier Tage gesund. Wie würde einen das verändern? Was ließe sich lernen über die Gesellschaft, in der wir leben?
Wer in den vier gehörlosen Tagen erstmals in einem Hotelzimmer mit einem Fernseher ohne Untertitel-Funktion landet, wer in seinen vier Tagen als dunkelhäutig erstmals erlebt, wie einem nichtschwarze Deutsche ungebeten in die Haare fassen als sei man ein kuscheliges Tier im Streichelzoo, wer in seinen vier Tagen als Jude mit Kippa auf der Straße angepöbelt wird, wer in den vier Tagen als Mutter eines Kinds mit Downsyndrom gefragt wird, warum man es denn nicht habe »wegmachen« lassen als sei es ein Fleck und kein Mensch, der oder die entdeckt womöglich Normen, die vorher gar nicht als Normen erkennbar waren. Wer mit seinem Körper, seiner Art zu lieben oder zu glauben, den Normen entspricht, kann es sich leisten zu bezweifeln, dass es sie gibt.
Was ließe sich durch das Eintauchen ins Leben der Anderen nicht nur von deren Ängsten und Verletzungen verstehen, sondern auch von deren Glück und Heiterkeit! Das Spiel mit dem Perspektivenwechsel und der Frage, welche Identität aus Wunsch und welche aus Zuschreibung entsteht, erklärt vielleicht, was an der gegenwärtigen Debatte über Toleranz so unerfreulich bleibt.
Toleranz ist immer Toleranz gegenüber etwas, das man ablehnt. Sie artikuliert sich als gütige Herablassung, als Geste einer Mehrheit, die eine Minderheit duldet, aushält, wider Willen. »Toleranz«, schreibt die amerikanische Politikwissenschaftlerin Wendy Brown, »reguliert Aversion«. Das ist, wenn man das Objekt der Toleranz sein soll, nicht nur zu wenig, das ist oft auch übergriffig. Warum soll ich toleriert werden, wenn ich schwarz bin oder jüdisch oder intersexuell? Warum sollte es überhaupt für andere eine Rolle spielen?
Wir sind alle, jeden Tag, konfrontiert mit einer Vielfalt von individuellen Identitäten und Überzeugungen. Jeden Tag begegnen wir Menschen, die sich von uns in vielfältigen Hinsichten unterscheiden. Manche dieser Weisen, anders auszusehen, anders zu leben oder anders zu denken sind uns vertraut, manche nicht.
Gerade bei dem, was mir noch nie oder selten begegnet ist, unterlaufen mir Fehler, Ungeschicklichkeiten, nicht willentlich, sondern aus mangelnder Übung. Als ich aus Europa in die Vereinigten Staaten zog und erstmals in einem Seminar an der Universität verschiedenen asiatischen Studentinnen gegenüberstand, konnte ich sie anfangs nicht unterscheiden. Wenn sie direkt vor mir saßen, war es eindeutig. Aber wenn sie hinterher einzeln zu mir in die Sprechstunde kamen, wusste ich sie nicht auseinanderzuhalten. Natürlich ließ sich das lernen. Aber es war beschämend.
Über viele Andersartigkeiten weiß ich schlicht zu wenig: Ich weiß nicht, wie ich manche Menschen ansprechen soll. Ich weiß noch nicht einmal, ob sie überhaupt als »anders« wahrgenommen werden möchten oder eben gerade nicht, ob sie stolz sind auf die Differenz oder ob sie ihnen bedeutungslos erscheint. Ich weiß immerhin dadurch, dass auch ich zulassen muss, befragt zu werden über das, was anderen vielleicht an mir als selten oder ungewohnt erscheint. Aber ganz gleich wie selten, ganz gleich wie anders als andere: Jedes Miteinander setzt Akzeptanz und Gleichberechtigung voraus.
Mir sind Wagnerianer so fremd wie Karnevalisten, mich erstaunen schlagende Verbindungen so sehr wie Strick-Zirkel, aber ich würde ihnen nie ihre Rechte absprechen. Ich bin Borussia-Dortmund-Fan, durch und durch, mir ist rätselhaft wie man Schalke-Fan sein kann. Aber ich würde doch niemals auf die Idee kommen, Schalke-Fans das Adoptionsrecht für Kinder zu untersagen oder Karnevalisten aufzufordern, ihre Passion doch bitte im Privaten auszuleben. Menschen müssen mir nicht ähnlich sein, damit ich ihre Würde für unantastbar und ihre Rechte für unveräußerlich halte.
Ich war so versunken in mein Gedankenexperiment, dass ich einen Teil des Gesprächs in der Warteschlange verpasste. Als ich wieder zuhörte, sagte der Mann hinter mir, dass er nun vier Tage von zu Hause aus arbeiten würde. »Homo« hieß »Home Office«. Schade eigentlich.
29. November 2014
Leise Töne
Von dem kanadischen Pianisten Glenn Gould gibt es die Anekdote, wie er einmal beim Üben einer technisch besonders anspruchsvollen Sonate von seiner Putzfrau unterbrochen wurde. Die gute Dame hatte den Künstler nicht bemerkt oder dessen Konzentration für wenig störanfällig gehalten, jedenfalls schaltete sie ihren Staubsauger an und begann, unbedarft und laut zu saugen.
Zunächst irritierte der Lärm den Pianisten. Das Geräusch des Gebläses legte sich über den Klang des Klavierspiels. Doch zu seiner eigenen Überraschung bemerkte Gould nach einer Weile, dass er ausgerechnet nun, da er die Musik schlecht hören konnte, weil er gegen ein parallel erzeugtes, diffuses Geräusch anhören musste, besonders leichthändig über die schwierigen Passagen hinwegkam.
Ganz begeistert von dem unerwarteten Effekt, so die Geschichte, erzeugte der eigenwillige Musiker von nun an selbst den Krach, der ihn ablenken und ihm zugleich beim Fokussieren helfen sollte: Er stellte Staubsauber an, schaltete ein Radiogerät ein, mitunter auch zwei auf verschiedenen Sendern, oder was sonst noch zur Hand war, um einen Klangteppich zu erzeugen, gegen den anzuhören ihm eine ganz besondere musikalische Konzentration ermöglichte.
Daran musste ich denken, in diesen Tagen, in denen die Auseinandersetzungen um die Ukraine-Krise und den angemessenen Umgang mit der Regierung Putin immer bitterer und lauter werden. Es gelingt kaum ein privates Gespräch, kaum eine öffentliche Diskussion zu diesem Konflikt, ohne dass diese rhetorisch eskalieren, moralische Vorwürfe und persönliche Diffamierungen inbegriffen.
Vielleicht kann das nicht anders sein, wenn an der Bruchstelle Europas Menschen sterben, jeden Tag, und es niemand zu stoppen vermag. Vielleicht kann das nicht anders sein, wenn nicht nur die territorialen, sondern auch die normativen Gewissheiten Europas diskursiv und real infrage gestellt werden.
Aber es ist gerade vor diesem Hintergrundrauschen, dass sich die leisen, literarischen Annäherungen an Osteuropa und Russland umso deutlicher und berührender abheben. Drei Autorinnen, Katja Petrowskaja (»Vielleicht Esther«), Nino Haratischwili (»Das achte Leben«) und Olga Grjasnowa (»Die juristische Unschärfe einer Ehe«), haben in diesem Jahr Bücher vorgelegt, die einen Erinnerungsraum ausloten, der sich von Berlin über Warschau und Kiew bis nach Tiflis, Baku und Moskau erstreckt. So verschieden die Schriftstellerinnen in ihren ästhetischen Formen und den Figuren sind, anhand derer sie Schrecken der Vergangenheit oder die Wirrnisse der Gegenwart erzählen: Gemeinsam ist ihnen Deutsch als eine spät erworbene Sprache. Wo die öffentlichen Debatten meist den analytischen Raum verengen, öffnen diese Bücher ihn wieder.
In »Vielleicht Esther« beschreibt die 1970 in Kiew geborene Katja Petrowskaja die Geschichte einer Suche nach ihren jüdischen Vorfahren, die dem Holocaust zum Opfer fielen. Sie erzählt behutsam, immer am Grat des Nicht-Wissens entlang. Mal erinnert sie, mal entdeckt sie Bruchstücke einer Familiengeschichte, die durch die deutschen Verbrechen in Polen, der Ukraine und der Sowjetunion zersplittert wurde. Sie bewegt sich dabei mit ungeheurer poetischer Genauigkeit zwischen den Sprachen und kartografiert die Zonen des Schweigens. »Ich komme aus Byzanz«, hat Katja Petrowskaja einmal gesagt, und wer verstehen will, was das bedeutet, wer verstehen will, was verloren gegangen ist, nicht zuletzt durch deutsche Schuld, wer aber auch verstehen will, was für ein Europa zu wünschen wäre, der sollte Petrowskaja lesen.
In »Das achte Leben« erzählt die 1983 in Tiflis geborene Nino Haratischwili ein atemberaubendes Epos einer georgischen Familie über sechs Generationen und ein ganzes Jahrhundert. Haratischwili lässt ihre Hauptfigur Niza nicht aus Unwissen, sondern aus Not erzählen, und sie hat einen Adressaten: deren zwölfjährige Nichte Brilka, die das politische wie narrative Erbe ihrer Familie kennen soll, um sich daraus befreien zu können.
Wer verstehen will, wie diktatorische Regime nicht allein repressiv, sondern auch produktiv wirken, wie brutale Macht den politischen Gegner nicht bloß unterdrücken, sondern nachgerade zurichten kann, wie Angst und Anpassung auch die privaten, intimen Beziehungen aushöhlen können, und wer verstehen will, wie sich trotz allem immer wieder, nicht zuletzt im Erzählen, dem Zugriff der Gewalt widerstehen lässt, der sollte Haratischwili lesen.
Und schließlich weitet und verdichtet sich der Raum zwischen Berlin und Moskau noch einmal in dem Roman »Die juristische Unschärfe einer Ehe« der 1984 in Baku geborenen Olga Grjasnowa. In rasendem Tempo erzählt Grjasnowa nicht nur ein witziges Roadmovie quer über den ganzen Kontinent und darüber hinaus, sondern en passant auch die melancholische Geschichte von zwei Frauen und einem Mann, Leyla, Jonoun und Altay, und den Lügen, die jede und jeder von ihnen braucht, um wahrhaft lieben und begehren zu können.
Wer verstehen will, welche Freiheiten gegenwärtig nicht nur bedroht, sondern noch nicht einmal errungen sind, wer verstehen will, welche Vielfalt es jenseits der nationalistisch oder kulturell definierten zu beschützen gilt, der sollte Olga Grjasnowa lesen.
Gewiss, keiner dieser Texte bietet handliche, fertige Lösungen für die drängende Not dieser Krise. Wer hätte die schon. Aber aller lärmenden Debatten zum Trotz lassen sich in den wunderbaren Büchern dieser Autorinnen jene Stimmen hören, die sonst von den rhetorischen Konfrontationen übertönt werden: Sie erzählen von Menschen und Landschaften, über die manche Beteiligte und Beobachter einfach geostrategisch hinwegverhandeln, als zählten sie nicht. Sie erzählen von denen, die nicht reinpassen, weil sie jüdisch sind oder dissident oder auch nur liebend, und sie erzählen davon, wie nicht nur ein polyphones Europa, sondern auch ein plurales Russland klingen könnte.
6. Dezember 2014
Das Richtige
Jemand tut etwas Gutes, und wir sind erstaunt. Jemand handelt selbstlos, und wir können es kaum fassen. Was sind das für Menschen, die zu solchen Taten fähig sind, fragen wir uns oft und fragen uns selten, was das auch über uns und eine Gesellschaft sagt, in der das Gute anscheinend zunehmend überrascht. Ist Altruismus, das dem Anderen (lateinisch: alter) zugewandte Denken und Handeln, gegenwärtig so unwahrscheinlich geworden? Ist Eigennutz nurmehr die einzig erwartbare Währung sozialer Interaktion?
Von der kroatischen Schriftstellerin Slavenka Drakulić gibt es die Erzählung, wie sie einmal der jungen Frau begegnete, die ihr das Leben gerettet hatte. Vorgesehen war das nicht. Die berühmte Autorin hatte sich im Rhode Island Hospital in Providence einer Nierentransplantation unterziehen müssen. Anders als in Deutschland, gibt es in den USA die Möglichkeit einer freiwilligen Spende durch eine lebende Person. Drakulić verdankte ihre neue Niere einer Frau, die nicht mit ihr verwandt war, die ihr also nicht etwa aus Zuneigung oder familiärer Verbundenheit ein Organ überließ, sondern die einer gänzlich Unbekannten zu Hilfe gekommen war.
Üblicherweise bleibt bei einer solchen Nierentransplantation die Spenderin anonym. Empfängerin und Spenderin begegnen sich nie. Drakulić jedoch drängte es, die Frau kennenzulernen, der sie ihr Überleben verdankte. Nicht allein, weil sie sich in einer Schuld wusste, die nicht zu begleichen war. »Ich hatte das Bedürfnis zu verstehen, warum sie es tat«, schreibt Drakulić in ihrem Buch »Leben spenden« – »weil für mich zur Annahme ihres Geschenks notwendigerweise auch gehörte, dass ich ihre Handlungsweise begriff.«
Es brauchte also Gründe für das Gute, als ob es für sich genommen nicht gut genug sei. Als ob sich das Gute nicht von allein erläuterte; als ob das Gleichgültige oder Eigensüchtige näherliege. Warum, so ließe sich fragen, erscheint Altruismus nicht allein unwahrscheinlich, sondern geradezu unheimlich? Warum bezweifeln wir die Motive derer, die Gutes tun? Warum können wir uns nicht mehr vorstellen, dass jemand etwas gibt ohne Zwang oder Erwartung?
In Zeiten, in denen der Begriff »Gutmensch« zu einem diffamierenden Etikett geworden ist, nimmt es womöglich nicht wunder, dass Altruismus in ideologischen Misskredit geraten ist. Es ist, als müssten diejenigen sich schämen, die Rücksichtnahme auf die ethischen Nöte und Ansprüche anderer für eine selbstverständliche Form der Höflichkeit halten, und nicht diejenigen, die nicht einmal bemerken, dass es andere gibt. Als seien diejenigen deformiert, die sich fragen, was moralisch geboten wäre, und nicht diejenigen, die moralischen Analphabetismus für Kult halten.
Aber das ist es nicht allein. Vielleicht muss in einer Gesellschaft, die vom ökonomischen Primat durchdrungen ist, selbstloses Handeln auch rätselhaft erscheinen. Vielleicht konnte es nicht folgenlos bleiben, wenn immer weniger Güter dem Zugriff der instrumentellen Logik entzogen bleiben. Vielleicht kann auch der Begriff des zweckfreien Guten nicht unbeschädigt bleiben, wenn selbst akademische Bildung und Forschung vornehmlich in Kategorien der Effizienz gemessen werden. Wenn auch die intimsten Lebensbereiche, auch Gesundheit und Pflege nach Profitorientierung strukturiert werden, hat es die Selbstlosigkeit schwer. Deshalb erstaunt es uns so sehr, wenn jemand nicht fragt, ob eine Handlung sich lohnt oder auszahlt, ob es ein Risiko gibt oder einen Gegenwert.
Es ist keineswegs immer leicht, das Richtige zu tun, es ist vor allem keineswegs leicht zu wissen, was richtig und was falsch ist. Manchmal zehrt die Hilfsbereitschaft auch an den eigenen Kräften. Aber altruistisches Handeln scheint inzwischen gleichermaßen überhöht wie tabuisiert zu sein. Das Gute ist so weit in den ambivalenten Bereich des Unwahrscheinlichen bis Unmöglichen gerückt, dass übermenschlich heldenhaft sein muss, wer es auch nur versuchen will. Vielleicht ist das eine nützliche Entlastungsstrategie: Wenn altruistisches Handeln als unerreichbar anspruchsvoll gilt, kann es auch nicht von uns erwartet werden.
Slavenka Drakulić erzählt, wie sich schließlich die frisch operierten Frauen einander gegenübersaßen, und die, die ihre Niere einer Fremden geschenkt hatte, sich befragen lassen musste, warum. Zu Drakulićs Verblüffung antwortete ihre Spenderin Christine, sie habe sich zu der altruistischen Tat entschlossen, sobald sie wusste, dass sie möglich war. Die junge Frau hatte in einer Zeitschrift von einer Lebendspende gelesen und gedacht, sie könne das Leben eines Menschen retten. Mehr nicht. Auch auf Nachfrage von Drakulić »Einfach so?« antwortete Christine: »Ja, einfach so.«
Das Gute geschieht manchmal reflexhaft. Es bedarf nicht immer eines moralischen Imperativs oder einer pflichtbewussten Ethik. Es gibt auch die Banalität des Guten; manchmal reicht es zu wissen, was getan werden könnte. Oder was zu unterlassen wäre. Manchmal geht es natürlich auch darum, etwas nicht zu tun: nicht mitzumachen, auch wenn daraus ein Nachteil entstehen könnte. Nein zu sagen, wenn andere einen einladen, sich einen Vorteil zu verschaffen, weil es als cool gilt oder ehrenwert, sich lustig zu machen über Schwächere oder sie zu demütigen.
Als vor nunmehr zehn Jahren im irakischen Foltergefängnis Abu Ghraib die amerikanischen Wärter in Zelltrakt 1A auszogen, die Gefangenen zu quälen, gab es einen jungen Soldaten, der sich widersetzte. Seine Geschichte wird selten erzählt. Er hatte die Häftlinge aus ihren Zellen holen und der Gruppe um den Anführer Charles Graner zuführen müssen. Als er sodann aufgefordert wurde, die verängstigten, nackten Menschen zu misshandeln, lehnte der Soldat ab und ging.
Er ging einfach so? Ja, einfach so. Er brauchte keine Begründung für sein Verhalten. Sein Name ist so schön, dass er erwähnt werden muss. Der anständige Soldat hieß Matthew Wisdom.
13. Dezember 2014
Zu viel
Der Dokumentarfilm »Videogramme einer Revolution« von Harun Farocki und Andrei Ujica beginnt mit einer unvergesslichen Sequenz. Die Kamera filmt eine offensichtlich verletzte junge Frau, die in ein schäbig-schlichtes Krankenhausbett gehievt wird. Sie stöhnt auf vor Schmerzen, wirkt noch benommen, doch kaum dass sie liegt, wendet sie sich an die Umstehenden: »Ich möchte etwas sagen.« Eine Stimme aus dem Off versichert ihr, dass die Kamera aufzeichnet, sie fragt noch einmal nach: »Ton und Bild?« – »Ja«. Sie nennt ihren Namen, Rodica Marcau, und wo sie arbeitet, in Temesvar, und dann legt sie los: »Die Securitate hat uns beschossen (…).« Ihre ganze aufgestaute Verzweiflung entlädt sich. »Wir wollen keinen Diktator (…) Wir wollen keine Securitate.« Sie redet ohne Scheu, ohne Rücksicht, ohne Unterlass, mehr als zwei Minuten zeichnet die Kamera eine Klage auf, die keine Angst mehr kennt.
Erst danach präsentieren die Filmemacher die spiegelbildliche Szene vom Tag zuvor, in der sich die historische Zäsur der rumänischen Revolution zeigt. Es ist das Material der Live-Übertragung des rumänischen Staatsfernsehens vom 21. Dezember 1989. Der rumänische Diktator Nicolae Ceauşescu steht auf dem Balkon des ZK-Gebäudes in Bukarest. Neben ihm seine Frau Elena und einige Funktionäre. Er trägt einen dunkelgrauen Mantel mit schwarz abgesetztem Revers, einen karierten Schal und eine schwarze Mütze. Ceauşescu spricht zu den 100000 Menschen auf dem Platz vor ihm, wie er immer spricht auf organisierten Großkundgebungen: stockend, hölzern, als ob ihm Rumänisch fremd wäre, liest er die realsozialistischen Formeln ab. Auf einmal hört man Rufe, Ceauşescu schaut auf, in Richtung des Tumults, hält inne und verstummt.
Für einige Augenblicke ist ein Diktator zu sehen, der nichts mehr diktieren kann, der sprachlos wird, weil er Stimmen hört, die nicht von ihm bestellt sind. Ceauşescu hebt die Hand, in völliger Verkennung der Situation, als ließe sich eine Revolution verhindern, wenn man sie begrüßt. Im Hintergrund auf dem Balkon entsteht Hektik, ein Sicherheitsbeamter tritt heran und flüstert Ceauşescu etwas ins Ohr. »Sie kommen ins Gebäude« ist zu hören, dann bricht das Staatsfernsehen die Übertragung ab. Ein Störbild wird eingeblendet, als eine Stimme fragt: »Ein Erdbeben?«.
Es gibt kaum Aufnahmen, die mich, ganz gleich, wie oft ich sie schon gesehen habe, so beeindrucken wie die von Ceauşescu in dem Moment, in dem er nicht begreifen will und doch begreifen muss, dass die Macht der Repression vor seinen Augen zerfällt. Und die von Rodica Marcau in dem Moment, in dem sie ihre Kritik nicht mehr nur heimlich äußern, sondern laut in die Welt hinausrufen will.
Was mich daran nachhaltig fasziniert, ist die generellere Frage, wann sich eigentlich jene Sollbruchstelle abzeichnet, an der – nicht nur in Diktaturen – eine historische Zeitenwende beginnt. Wann ist eine Gesellschaft nicht mehr bereit zu ertragen, was sie über Jahrzehnte ertragen musste? Wann ist es genug der Demütigungen? Wann verlieren illegitime Regimes oder Praktiken ihre abschreckende Wirkungsmacht? Wenn Menschen so zugerichtet wurden, dass sie nichts mehr zu verlieren oder wenn sie zu hoffen begonnen haben? »Das Geheimnis der Macht«, schrieb Ludwig Börne einmal, »besteht darin zu wissen, dass andere noch feiger sind als wir.«
Es ist, als ob es eine Art Pendel des Unrechts gäbe, das Regimes (oder Ideologien) so lange stabil hält, wie sich Leid und Furcht die Balance halten. Und dann, irgendwann, gibt es scheinbar etwas, das das Pendel kippen lässt: In Rumänien 1989 entzündeten sich die Proteste in Temesvar an der Versetzung des regimekritischen Pfarrers László Tökes. In Tunesien 2010 löste die Nachricht von der Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi in Sidi Bouzid erst die »Jasmin Revolution« und schließlich den Arabischen Frühling aus.
Sicherlich erleichtern oft materielle Bedingungen die historische Dynamik. Der Kollaps des Ostblocks wurde nicht allein durch ideologische, sondern auch durch ökonomische Faktoren bestimmt. Die technische Revolution der Digitalisierung, die Verbreitung von Handys mit SMS-Funktion, über die sich Kritik und Widerstand kommunizieren und organisieren lassen, beschleunigte die Prozesse des Arabischen Frühlings.
Gleichwohl scheint es doch einzelne Ereignisse zu geben, die sich symbolisch so aufladen, dass sie anderen als Signal erscheinen. Manchmal sind es mutige Gesten, die auf etwas verweisen, was noch nicht ist. Manchmal sind es Akte der Verzweiflung, die an etwas erinnern, was nicht länger sein soll. Es sind gewiss nicht jene individuellen Ereignisse allein, sondern stets reihen sie sich ein in eine kollektive Erfahrung aus Scham und Demütigung, für die diese eine, letzte Erfahrung eine zu viel ist.
In den USA im Jahr 2014 könnten es Michael Brown und Eric Garner sein, die beiden unbewaffneten Schwarzen, die durch Polizeigewalt starben, die ein solches »Zuviel« markieren. Ein Zuviel an Rassismus, ein Zuviel an willkürlichen Kontrollen und exzessiver Gewalt weißer Polizisten, die allzu selten juristisch zur Rechenschaft gezogen werden – solange die Opfer schwarz sind. Und es könnten Michael Browns erhobene Hände und Eric Garners letzte Worte »I can’t breathe« sein, die den Protesten ihre Signatur geben.
Vielleicht ist es gerade die enttäuschte Hoffnung, dass Barack Obama, der erste afroamerikanische Präsident, die moralische Dysfunktionalität einer rassistischen Gesellschaft korrigieren könnte, weshalb sich die Demonstrationen von Ferguson über New York immer weiter ausbreiten. Es ist nicht sicher, ob diese Bewegung nicht wieder versandet. Es ist auch nicht ausgemacht, ob die Veröffentlichung des »Folterberichts« die amerikanische Öffentlichkeit zusätzlich drängt, sich kritisch mit struktureller und physischer Gewalt auseinanderzusetzen. Aber beides nährt die Hoffnung, dass das Pendel bald kippen könnte.
27. Dezember 2014
Von draußen betrachtet
Meine Großmutter war mir die beste Großmutter der Welt. Sie fuhr Auto wie ein Berserker, spielte leidenschaftlich Karten und rauchte filterlose Zigaretten. Wir durften jedes Tier mit nach Hause bringen, das im Wald oder auf den Feldern zu finden war. Sie ließ uns vorschlafen, um uns dann, unter dem Versprechen, dass wir den Eltern nichts verraten würden, Muhammad Ali boxen sehen zu lassen. Sie tröstete liebevoll bei Kummer und pflegte geduldig bei aufgeschlagenen Knien, Windpocken oder Erkältungen. Sie war so geländegängig wie großzügig. Nur eines duldete meine geliebte Großmutter nicht: Übellaunigkeit. Da war sie streng.
Maulte oder quengelte man stundenlang herum, griff einen meine Großmutter am Nacken, sanft, aber doch bestimmt, und sagte: »Ich glaube, du musst mal ein bisschen nach draußen und dort spielen. Wenn’s dir besser geht, kannst du wieder reinkommen.« Und schwupp war man vor der Tür. Schlechte Laune galt meiner Großmutter schlicht als unhöflich. Es gehörte sich nicht, andere mit der eigenen Unzufriedenheit zu belasten oder gar dafür verantwortlich zu machen.
Ich erinnere mich gut daran, wie ich mich dann nach draußen trollte, kurz etwas unschlüssig herumlungerte, aber schon bald so vergnügt die Gegend erkundete, dass ich Stunden später meist nicht mehr daran dachte, ursprünglich nicht gar so freiwillig draußen gelandet zu sein. Bis heute empfinde ich schlechte Laune als unerzogene Zumutung und bis heute denke ich gelegentlich, manchem täte es gut, einfach mal vor die Tür zu gehen und ein wenig zu spielen.
Vielleicht erklärt das auch mein Unbehagen, mich mit den »Pegida«-Demonstrationen zu befassen. Was sich dort Woche für Woche artikuliert, wäre meiner Großmutter vor allem unhöflich erschienen. Und sie hätte es aberwitzig gefunden, darauf einzugehen: Nur weil jemand wütend ist, nur weil jemand sich trotzig benimmt, gibt es doch keinen Grund, so zu tun, als gäbe es eine Entschuldigung oder gar einen gewichtigen Anlass dafür.
In dem Roman »Anils Geist« beschreibt der kanadische Schriftsteller Michael Ondaatje eine Pflanze, die in Wüsten wächst. Wenn nur etwas Wasser ihre Blätter benetzt, lässt sich der Geruch von Kreosot einatmen. Der Strauch sondert das Gift ab, sobald es regnet – als ob sich so andere Büsche fernhalten ließen. Der öffentliche Diskurs ist seit einer Weile ähnlich vergiftet. Um auch nur etwas politische oder mediale Aufmerksamkeit zu ergattern, werden Misstrauen und Ressentiments gegen andere abgesondert. Dabei hat sich eine Art Exhibitionismus der Kaltherzigkeit ausgebreitet, der stolz und schamlos offenbart, was an geistigem Geiz und emotionaler Impotenz lieber verborgen bliebe.
Dürfen sie das? Dürfen sich Menschen Woche für Woche kleiner machen, als sie sein könnten? Ja, natürlich. Dürfen sie Woche für Woche Wahrnehmung und Einbildung, Angst und Paranoia, Islam und Islamismus verwechseln? Ja, natürlich. Dürfen sie um Wohlstand, Privilegien, Status fürchten und sich deswegen verschließen vor der Not und Bedürftigkeit anderer? Ja, natürlich. Dürfen sie eine Verschärfung des Asylrechts fordern, als sei nicht der IS eine Bedrohung, sondern die, die vor ihm fliehen? Ja, natürlich. Doch deswegen wird dieses Verhalten nicht richtiger. Deswegen wird es kritisiert.
Ein Sündenbock ist ein Sündenbock ist ein Sündenbock. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wird nicht richtig, nur weil viele sie ausdrücken.
Mir fallen einige Gründe ein, auf die Straße zu gehen: die Armut in den Kommunen, die die soziale und kulturelle Infrastruktur zunehmend aushöhlt; die intellektuelle Selbstverstümmelung eines Bildungssystems, das Schülerinnen und Studierende in immer kürzerer Zeit mit standardisierten Modulen stopft wie Mastgänse, sodass selbst dem neugierigsten Menschen die Freude am Lernen vergehen muss; die Einsamkeit der Altenpfleger oder Krankenschwestern, die – strukturell überfordert – jeden Tag helfen ohne einen angemessenen Lohn oder Anerkennung.
Mir fallen auch Ängste und Sorgen ein, die mir berechtigt scheinen: die Angst vor dem Alter ohne ausreichende Rente; vor Krankheiten, die uns womöglich entstellen und unsere Angehörigen überfordern; vor unkontrollierter Überwachung durch Geheimdienste und Konzerne, die Daten und Informationen über uns nicht nur sammeln, sondern bei Bedarf auch manipulieren; die Liste wäre erweiterbar. Die größte Sorge aber macht mir die ungezügelte Verrohung und negative Leidenschaft als dominanter Vektor der Gesellschaft. »Wer von Angst getrieben ist«, schreibt der Soziologe Heinz Bude in seinem aktuellen Buch über die »Gesellschaft der Angst«, »vermeidet das Unangenehme, verleugnet das Wirkliche und verpasst das Mögliche.«
Wer nur das Trennende sucht, erkennt das Gemeinsame nicht mehr. Wer nur in kulturellen oder religiösen Differenzen denkt, entdeckt die politischen oder humanistischen Ähnlichkeiten nicht mehr. Wenn ich mir für das neue Jahr etwas wünschen darf, dann dass es gelänge, sich nicht anstecken zu lassen; weder von der Angst noch von der Aversion. Ich wünschte, dass es gelänge, eine Balance zu finden, von vernünftigen Argumenten und kreativen, passionierten Entwürfen für eine offene Gesellschaft. Ob gegen Kaltherzigkeit und Ressentiment gesungen, getrommelt oder gespielt wird, ist mir gleich. Es darf albern oder ernst zugehen, wortlos oder sprachmächtig. Alles, was den sozialen Horizont weitet, jedes Genre der Kritik, jede Geste der Liberalität ist willkommen.
Meine Großmutter übrigens war ausgewandert und wieder eingewandert. Uns Enkeln hat sie nicht einen Ort als Zuhause vermacht, sondern eine Haltung. Ob ich ihr immer gerecht werde, steht zu bezweifeln. Aber manchmal schicke ich mich gleichsam selbst vor die Tür – und ich denke, das würde ihr gefallen.
2015
21. Februar 2015
Gewölk
Lange bevor Leonardo da Vinci an der berühmten »Schlacht um Anghiari« für den großen Saal des Palazzo Vecchio in Florenz zu malen begann, schrieb er um 1490 einen erstaunlichen kleinen Text. »Wie eine Schlacht darzustellen ist«, so der Titel der Schrift, und er beginnt mit den Zeilen: »Zuerst wirst du den Rauch der Artillerie machen, der sich in der Luft mit dem von der Bewegung der Pferde und der Kämpfenden aufgewirbelten Staub vermischt«, und nach einer langen Anleitung, wie Staub, Rauch und Luft farblich zu kombinieren seien, fährt da Vinci fort: »Je tiefer die Kämpfenden in diesem Gewölk stecken, desto weniger wird man sie sehen.« Da Vinci erläutert, wie sich das Licht auf den Gesichtern der Musketiere spiegeln müsse, wie die Augenbrauen der Besiegten blass und hochgezogen gehörten, wie die Spur des »durch Staub und Schlamm geschleiften« Leichnams, den ein Pferd hinter sich her zieht, auszusehen habe, und er fordert schließlich: »Mache keinen ebenen Ort außer den mit Blut gefüllten Fußstapfen.«
Als ich den Text das erste Mal las, erstaunte mich vor allem, dass da Vinci sich selbst eine Art konzeptionelle Gebrauchsanweisung schrieb, die von der eigenen Malerei zuallererst analytische Disziplin verlangte: die Werkzeuge des Tötens, die Tiefe des Bodens, die verstümmelten Leiber, das Wehgeschrei, das Leiden und Sterben im Krieg sollten durchdacht sein, bevor etwas davon dargestellt werden könne. Später beeindruckte mich zudem die Präzision, mit der der Universalgelehrte sich den unscheinbarsten Details widmete: Wie groß der Abstand der Staubwölkchen hinter einem Pferd zu sein habe (»Zwei Pferdsprünge«), wie Arme und Beine der Sieger im Laufschritt zu erfassen seien (rechter Fuß vor, linker Arm auch vor) und wie die gedemütigten Verlierer auf dem imaginären Schlachtfeld des Gemäldes die Augen verdecken sollten (»die Handfläche den Feinden zugewandt«).