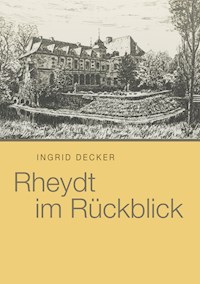
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ingrid Decker, die viele Jahre in fernen, fremden Ländern verbracht hat, war in Südafrika, viele Jahre in Lateinamerika und Spanien zu Hause. Seit langem hatte sie Freunde in Israel und den USA, mit denen sie - bis zu deren Tod - in regem Kontakt und enger Verbindung stand. Überall begegneten ihr Menschen, die während der Herrschaft der Nationalsozialisten Deutschland verlassen mussten, weil sie Juden waren, deren Schicksal der Vernichtungswahn der Nationalsozialisten geprägt hat. Sie hat ihnen aufmerksam zugehört und hat im vorliegenden Band versucht, diese Einzelschicksale so zusammenzufassen, dass für sie persönlich einige weiße Flecken in der Vergangenheit ihres Heimatortes Rheydt mit Leben gefüllt werden konnten. Der vorliegende Band ist eine sehr private Auseinandersetzung mit dem Thema 'Heimat' und 'Holocaust'.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch widme ich allen jüdischen Mitbürgern aus Rheydt und Mönchengladbach, insbesondere unserem einstigen Hausarzt Dr. Walter Simons sowie dem Rechtsanwalt Josef Joseph, der noch aus dem Exil versuchte, Goebbels zu Einsicht zu bewegen.
»Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.« Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung [JH]
Inhalt
Statt einer Einleitung: Warum habe ich mir die Mühe dieser Niederschrift gemacht?
Eine deutsche Nachkriegsjugend
Wir haben den Krieg nicht gewollt…
Feldpostbriefe
Persönlicher Einschub
Über das Geflüster in Rheydt
Hans Jonas
Familie Koppel
Familie Baer
Ruth Hermges, geb. Vergosen
Hugo Junkers
Hilde Sherman, geb. Zander
Treffen in Israel – Erzählungen aus Hildes Leben
Tag der Deportation
Ankunft im Niemandsland
Rigaer Ghetto
Historischer Einschub: Das Rigaer Ghetto…
… und so litten die Familien Winter und Sherman
Alltag im Ghetto
Auflösung des Rigaer Ghettos
Von Hamburg nach Kiel
Rettung aus Dänemark und Schweden
Kolumbien – die neue Heimat
Israel – Hildes letzte Heimat [SH_DI]
Rechtsanwalt Josef Joseph
Eine unfreiwillige Reise
Protokoll: Aufzeichnungen einer Irrfahrt
Der Held der St. Louis
Rettung nach England
Internierung
Ankunft im Land der »Freiheit« und der unbegrenzten Möglichkeiten?
Josef Josephs »Offener Brief« an Josef Goebbels
Liesl Loeb geb. Liesel Joseph
Dr. Walter Simons
Hilferuf eines Unbekannten
Aenne Decker und ihre Theater- und Konzertprogramme
Zu den Theater- und Konzertprogrammen
Zeitzeuge Wilhelm D. – Das Leben eines Rheydter Bürgers
Meine Jugendzeit – Ein Alptraum
Widerstand in Mönchengladbach und Rheydt
Gladbach und Rheydt – Geschichtlicher Abriss
Wachsende Brutalität der Nationalsozialisten
Joseph Goebbels
Kriegstrauma
Literatur- und Quellenverzeichnis
Danksagung
Statt einer Einleitung: Warum habe ich mir die Mühe dieser Niederschrift gemacht?
Die Verbrechen, die »im Namen des Deutschen Volkes« an den Juden begangen wurden, hätten mich nicht unmittelbar betreffen müssen; einmal wegen der »Gnade der späten Geburt«, und zweitens, weil niemand in meiner engeren Familie dem Nazi-Regime freiwillig gedient hatte. Dennoch begleiten mich der Holocaust und das Schicksal der Juden wie ein Schatten – bis heute.
Schon als Kind hörte ich die Erwachsenen hinter vorgehaltener Hand über Menschen reden, die ich nicht kannte, aber deren Namen immer wieder genannt wurden. Es handelte sich um Rheydter und Gladbacher Familien, die aus nicht näher erwähntem Grunde »plötzlich« verschwunden waren. Seltsam fand ich, dass an ihren Häusern, Geschäften und Fabriken nach dem Krieg noch die eingravierten Namenszüge an den Gebäuden sichtbar waren. Diese Geheimnistuerei der Erwachsenen weckte erst recht mein Interesse, und ich horchte immer öfter genau hin, wenn es um diese mysteriösen »Verschollenen« ging. Ich wuchs mit dem Gefühl eines undefinierbaren, unbestimmten und schattenhaften Geheimnisses auf, dem ich unbedingt auf den Grund gehen wollte.
So erzählte mir meine Mutter von Dr. Simons, dem einstigen jüdischen Hausarzt ihrer Familie, der regelmäßig zu Hausbesuchen erschien. Walter Simons war nicht nur Arzt, sondern auch Seelsorger, vor allem aber war er ein Mensch!
Bis mir meine Mutter – als ich 12 Jahre alt war – das Tagebuch der Anne Frank zu lesen gab, konnte ich mir nicht vorstellen, dass Menschen in der Lage sind, sich einander so viel Leid zuzufügen.
Nun las ich in Berichten und Büchern Holocaustüberlebender von millionenfachen Deportationen, von systematischen Morden durch Erschießungen und Gas. Diese Eindrücke haben sich in mir verankert, und waren der Beginn meines Interesses an jüdischen Schicksalen; jede Gelegenheit, mehr zu erfahren, nahm ich wahr.
Anfang der 70er Jahre lernte ich in Süd-Afrika die ersten Juden kennen. Sie waren es, die mir ihre Überlebensgeschichten erzählten. Sie hatten Nazi-Deutschland rechtzeitig verlassen können, und fanden eine neue Heimat am Kap der Guten Hoffnung.
Im Puerto Rico der 80er Jahre besuchten unsere Töchter die Amerikanische Schule und trafen viele jüdische Klassenkameraden, deren Eltern uns zu jüdischen Festen wie Barmitzva oder dem Schiwa-Sitzen (gemeinsame Traueraufarbeitung) einluden. Wie Elend war mir jedes Mal zumute, wie schrecklich fühlte ich mich als Deutsche in ihrer Gegenwart! Doch wir wurden stets herzlich empfangen.
In besonderem Maße gilt dies für Lore und Leo Koppel, die wir ebenfalls auf der Karibik-Insel Puerto Rico kennen lernten. Das Ehepaar Koppel hat uns bis zu ihrem Tod (2011 bzw. 2017) durch das Leben begleitet. Für Lore und Leo Koppel gehörten wir fast zur Familie.
Auch mit Hilde Sherman in Israel verband mich viele Jahre lang eine innige und von gegenseitigem Verständnis geprägte Freundschaft, die erst mit ihrem Tod (2011) endete.
Gerne erinnere ich mich an die vielen liebenswerten Juden, die mir in Mexiko spontan von ihrem Schicksal erzählten. Manche konnten sich nur mit Mühe und Glück retten – wie ihre Leidensgenossen in der Dominikanischen Republik, die zunächst kein Land aufnehmen wollte, bis sie in letzter Minute auf die Karibik-Insel entkommen konnten.
Ein glücklicher Zufall wollte es, dass ich im August 2010 Liesl Loeb und Sohn Joel vor ihrem Elternhaus in der Rheydter Freiheitsstraße 31, traf: Die aus den USA angereiste Familie befand sich auf den Spuren der Vergangenheit – wie ich. Bis kurz vor Liesl’ Tod (2013) hatte ich telefonischen Kontakt mit ihr. Ihrem Sohn Joel verdanke ich die Genehmigung zur Veröffentlichung des Original-Protokolls der »St. Louis«.
Die Juden, die ich auf den verschiedenen Kontinenten kennen lernte, die wegen der Nazi-Rassegesetzgebung aus ihrer Heimat vertrieben wurden, sind mir überall auf der Welt mit großer Liebenswürdigkeit begegnet und haben mir ihr Vertrauen entgegen gebracht. Sie waren mir gegenüber ohne Vorurteile, Feindschaft oder Hass: Wesenszüge, die ich nach all den Grausamkeiten, die ihnen von Deutschen zugefügt wurden, nicht erwartet hatte. Daher möchte ich die Erinnerung an sie wach halten und mich besonders bei denjenigen bedanken, die in meinem Bericht Erwähnung finden.
Achern, Herbst 2019
Eine deutsche Nachkriegsjugend
Im Vakuum der Stunde Null, als sich Staub- und Russpartikel verbrannter Menschen und Häuser auf die übrig gebliebene Natur gelegt hatten, wurde ich am 16. Oktober 1945 geboren. Alles, was davor in dem 12 Jahre andauerndem Naziregime Bedeutung gehabt hatte, war aufgelöst und seit dem 8. Mai 1945 null und nichtig. Das gesamte Land schien sich in einer Schockstarre zu befinden. Die Menschen, inmitten zerstörter Innenstädte und Trümmerfeldern waren zunächst wie gelähmt. Oftmals waren sie an Leib, immer aber an ihrer Seele verwundet. In den ersten Nachkriegsmonaten ging es nur darum, sich irgendwie über Wasser zu halten und zu überleben. Für Aufbau und Erneuerungen war die Zeit noch nicht reif, Millionen Männer waren im Krieg geblieben. Nun lag es an den Frauen, die mutig, tatkräftig und sehr mühsam die Trümmerberge abtrugen und Zuversicht im Alltag verbreiteten. Außerdem war die Bevölkerung Deutschlands von den Entscheidungen der vier Siegermächte abhängig.
Die Hauptstrasse im Jahre 1946. (Foto: Stadtarchiv Mönchengladbach [GI])
Ein Beispiel dafür, dass in dieser Zeit alles erstarrt war, ist die »Kriegsausgabe« meiner Geburtsurkunde, die aus minderwertigem Papier gefertigt und nur provisorisch zusammengeheftet war, und in der es im Oktober 1945 hieß: »Das Deutsche Einheits-Familienstammbuch, herausgegeben vom Reichsverband der Standesbeamten Deutschlands e.V., wird nach Beendigung der Kriegszeit wieder in erweitertem Umfange erscheinen. Den Inhabern dieser Ausgabe wird empfohlen, sich nach Beendigung des Krieges ein vollständiges Einheits-Familienstammbuch nachträglich ausstellen zu lassen«. [DI_Pv]
Nach den Erzählungen meiner Mutter ist die Verwandtschaft zu meiner Taufe Ende 1945 zahlreich erschienen. Es grenzte an ein Wunder, dass sich für die Zeremonie eine Kerze auftreiben ließ, aber niemand, auch nicht der Pfarrer, verfügte über ein Streichholz, um sie anzuzünden. Wann immer Mutter diese Begebenheit schilderte, nie verkniff sie sich den Hinweis, dass es mir möglicherweise deswegen stets an »Erleuchtung« gefehlt habe, fügte aber gleich hinzu, dass mein weiterer Lebensweg dadurch offensichtlich nicht sonderlich beeinträchtigt worden sei.
Es sollte noch eine ganze Weile dauern, bis sich in Deutschland wieder eine Art von Normalität einstellte.
Selbst wenn sich der menschliche Farbsinn sofort nach der Geburt entwickeln würde, wären meine frühesten Erinnerungen an Rheydt geprägt von hellen Wassertönen bis zu dunkel-blassen Nebelschleiern – jedenfalls von Grau. Noch heute habe ich das Schwarz der von Asche bedeckten Brandruinen vor Augen, und diese Intensität ist kaum »natürlich.«
So hat sich der erste farbige Eindruck bis heute in meinem Gedächtnis als ein ganz besonderes Erlebnis erhalten: Zwei leuchtendrot lackierte Holzgriffe eines Springseils, das Nachbarskindern gehörte; damals eine Kostbarkeit, denn derartige »Luxusgüter« konnte man nicht erwerben, nur erben. Manchmal überließ man mir für kurze Zeit das heiß begehrte Gut, aber ein eigenes Exemplar zu besitzen, lag jenseits meiner Vorstellung.
Das seinerzeit größte Kaufhaus der Stadt Rheydt wurde 1916 von der jüdischen Familie Abraham erbaut. Es lag im Zentrum der Stadt und beeindruckte durch seine herrschaftliche Gründerzeitarchitektur. Das Hauptgeschäft befand sich allerdings in Mönchengladbach als »Warenhaus für Mode- und Bedarfsartikel«. Es hatte laut Eigenwerbung »das größte Angebot von Verkaufsartikeln unter einem Dach« [EG]. Im Jahre 1927 wurden beide Geschäfte an die (ebenfalls jüdische) Warenhauskette Leonard Tietz AG in Köln verkauft, die nach der »Machtergreifung« im Jahre 1933 »arisiert« und von der Kaufhof AG mit Sitz in Köln übernommen wurde.
Gelegentlich durfte ich meine Eltern bei dem Besuch des Kaufhauses im Zentrum der Stadt am Marienplatz (während der NS-Zeit »Adolf Hitler Platz«) begleiten. Der Kaufhof, dessen Haupteingang am Marienplatz lag, befand sich an der Ecke Friedrich Ebert- und Stresemann-Strasse. An einem Tag – ich muss fünf oder sechs Jahre gewesen sein – gingen wir durch die Verkaufsabteilungen zu einer großen Freitreppe, die zu einer Plattform führte, an deren Ende zwei Treppen den Zugang zum oberen Stockwerk erlaubten; nach links ging es zur Spielwarenabteilung. Bei diesem aufregenden Abenteuer erblickte ich dort das erträumte Springseil mit den roten Holzgriffen. Doch erst, als wir das Kaufhaus schon verlassen hatten, wurde mir bewusst, dass ich versäumt hatte, meinen Herzenswunsch zu äußern, und ich brach in Tränen aus. Meine Eltern waren zunächst ratlos, bis ich mit erstickter Stimme meine Verzweiflung gestand. Meine Eltern versuchten mir zu erklären, dass man sich Geschenke außer der Reihe nicht leisten könne, was mich aber keineswegs beeindruckte; vielmehr wurde mein Geheul immer intensiver: Ich wollte endlich ein eigenes Springseil. Schließlich kehrte mein verzweifelter Vater um und kaufte mir das ersehnte Seil mit den rot lackierten Handgriffen.
Voller Stolz präsentierte ich den Nachbarkindern meinen neuen Besitz, aber bald lag der zwei Mark fünfzig teure Gegenstand unbeachtet in der Ecke. Später habe ich nie wieder einen derartigen Aufstand gemacht, ein durchaus »modernes« Verhaltensmuster, wofür es ein weiteres Beispiel gibt: Als mir eines Tages eine Nachbarin einen Roller schenken wollte, überschlug ich mich fast auf dem Weg zu ihr vor lauter Aufregung und Ungeduld. Vor meinem geistigen Auge sah ich einen nagelneuen, rot lakkierten Nachkriegs-Holzroller mit einer geraden Lenkstange und kleinen schwarzen Gummirädern. Ich rannte auf den Eingang des Hauses zu, wo die Nachbarin – die ich Tante Martha nannte – in der Haustür auf mich wartete. Noch bevor ich sie erreichte, sah ich ein an der Hauswand lehnendes Gefährt, das mich geradezu entsetzte. Mich erwartete ein mit Ballonreifen ausgestattetes Vorkriegsmodell mit gebogener Lenkstange und voller Rostspuren und Flecken. Auf dem Absatz drehte ich mich um und lief heulend davon. Die Realität war meiner ausschweifenden Phantasie wieder einmal zuvorgekommen. Als ich zu Hause den ersten Schock überwunden hatte, begriff ich, dass ich einen eigenen Roller besitzen würde – wenn ich ihn denn mitgenommen hätte. Mein erster Gang am nächsten Morgen führte mich zur Nachbarin, um das Geschenk näher in Augenschein zu nehmen. Die Angst, dass der Roller anderweitig vergeben worden sein könnte, saß mir im Nacken. Zum Glück lehnte das gute Stück immer noch an der Hauswand. Tante Martha war freundlich wie immer und stellte keine peinlichen Fragen. Als ich den unmodernen Vorkriegsroller näher in Augenschein nahm, entdeckte ich etliche Vorzüge. Es handelte sich um einen »Wipproller«, mit dem man – ohne zu treten – mit Schwung fahren konnte. Die unmodern anmutenden Ballonräder hatten den Vorteil, dass man wesentlich besser über die damals sehr unebenen Schotterstraßen sausen konnte, und der krumme Lenker und die »Altersflecken« störten mich bald auch nicht mehr.
Ein Fahrrad, wie es mein Bruder besaß, hatte ich nie. Allerdings konnte ich mit meinen Freunden Rollschuhlaufen, was mir jedoch gelegentlich Ärger einbrachten: Da die Rollschuhe an den Schuhsohlen festgeschraubt waren, passierte es, dass sich nach intensivem Rollschuhlauf die Sohlen von den Schuhen lösten und reparaturbedürftig wurden. Dieser Umstand führt zu unliebsamen Diskussionen – und unnötigen finanziellen Ausgaben. Um in Zukunft Kosten zu sparen – und um den Rollschuhen mehr Halt zu geben – umspannte man Schuhe und Rollschuhe mit Einkochringen aus Gummi, die aus Mutters Küche stammten und gute Dienste leisteten.
Nicht zu vernachlässigen waren die Verletzungen, die man sich bei den fast unvermeidbaren Stürzen zuzog, denn die Straßen, die vor dem Krieg gebaut, also geteert oder betoniert worden waren, hatten entweder breite Risse oder riesige Schlaglöcher, die es unmöglich machten, eine rasante Fahrt einfach nur zu genießen: Wenn man nicht rechtzeitig vor den Unebenheiten abbremste, schürfte man sich beim Sturz vor allem Knie und Arme auf. Pflaster, Salben und Verbände waren in jener Zeit Utensilien des täglichen Bedarfs. Erst als das Rheydter Finanzamt auf der Wilhelm Strauß Straße gebaut und die Straße vor dem Gebäude mit Steinplatten belegt worden war, konnte man sich dem Rollschuhlaufen voll und ganz hingeben, nur: Da fand ich mich schon zu erwachsen für diese Sportart.
Armut und Entbehrung prägten zwar die Nachkriegsjugend, doch es war eine kollektive Armut; niemand hatte Grund, den Anderen zu beneiden, denn alle besaßen kaum mehr als das Lebensnotwendigste. Die Garderobe bestand meist aus abgetragenen, vielfach gewendeten und geflickten Sachen, die von Geschwistern, Verwandten oder aus dem Freundeskreis stammten. Die selbst gestrickten Wollsachen, nach dem Krieg aus minderwertigem Material angefertigt, waren ein Gräuel, denn sie juckten und kratzten so fürchterlich, dass jeder, der diese Zeit als Kind erlebt hat, sich für den Rest des Lebens daran erinnern dürfte.
Ein besonderes Problem insbesondere für uns Heranwachsende war, passende Schuhe zu bekommen. Die einzige Chance bestand darin, einigermaßen geeignete Exemplare zu »erben.« Falls sie zu groß waren, wurden sie mit Einlagen aus Zeitungspapier »passend« gemacht.
Das Essen der Nachkriegszeit war karg und kalorienarm. Meist gab es Suppe, die aus »Milch« mit Mehlklumpen, Gerste oder Kartoffeln bestand, oder es waren Eintöpfe mit Gemüsesorten – was gerade zu bekommen war. Fleisch war bis in die 50er Jahre eine Seltenheit, selbst an Sonn- und Feiertagen. Die Wohnungen waren – nicht nur nach heutigen Maßstäben – fast immer zu klein und im Winter kalt. Heizmaterial gab es kaum; bis zur Währungsreform auch nicht für viel Geld, denn dies war nichts wert, und danach war Kohle oder Holz zu teuer. Die Kinder, die man als »reich« hätte bezeichnen können, waren diejenigen, deren Väter den Krieg überlebt hatten, da es dann einen Ernährer in der Familie gab – was in meiner Schulklasse die Ausnahme war.
In der Nachkriegszeit spielten wir in den Straßen, denn Spielplätze gab es für uns Kinder nicht. Die angrenzenden Gärten, die damals verkehrsfreien Straßen und Gassen waren für uns die schönsten Abenteuerspielplätze: Wir kletterten über Trümmerberge, untersuchten das Innere der Ruinen, und fanden dabei gelegentlich den einen oder anderen nützlichen Gegenstand. Wir erforschten unterirdische Bunkeranlagen, in denen die Menschen Schutz vor Bomben gesucht hatten und krochen durch enge, teilweise zugeschüttete Schächte in ein geheimnisvolles Reich. Kaum zu verstehen, dass es nicht regelmäßig zu folgenschweren Unfällen kam.
Nachdem Anfang der 50er Jahre die Schutt- und Trümmerberge in der Innenstadt von Rheydt abgetragen worden waren, konnten neue Wohn- und Geschäftshäuser errichtet werden. In meiner näheren Umgebung waren es Bauten an der Limitenstrasse, die mich beeindruckten. Einer der Höhepunkte des Wiederaufbaus war das Atlantis-Kino, das alsbald ein Treffpunkt für jung und alt wurde. Sonntags fand um elf Uhr die Kindervorstellung mit Märchenfilmen statt. Trotz des allgemeinen Geldmangels nach der Währungsreform (1948) war der Saal stets bis auf den letzten Platz gefüllt. Für mich gehörten diese Vorstellungen, die ich leider nur gelegentlich besuchen konnte, zum größten Vergnügen jener Jahre: Sobald mir meine Mutter (nur widerwillig und schweren Herzens) die fünfzig Pfennig Eintrittsgeld spendierte, rannte ich voller Vorfreude und mit großer Begeisterung ins Kino.
Ein besonderes Erlebnis: Eines Sonntags stand ich schon früh vor der Kasse, doch die Kassiererin ließ auf sich warten, und so sprang ich in der Gegend herum, schaute mir immer wieder die Film-Vorschau-Fotos in den Schaukästen an, redete hier und da mit Schulkameraden, bis mir das 50 Pfennig-Stück aus der Hand fiel. Ich sah gerade noch, wie die blanke Münze durch die Öffnung eines Metallgitters in den Tiefen eines Kellers verschwand – und nirgends ein Hausmeister in Sicht. Indessen hatte inzwischen die Kasse geöffnet, und die ersten Besucher strömten in den Saal. Wieder einmal war ich den Tränen nah, denn bald würde die Vorstellung beginnen, und wie es aussah: Ohne mich. Was würde mich wohl zu Hause erwarten? Gerade als ich mich meinem Schicksal ergeben hatte, voller Traurigkeit den Heimweg antreten wollte, sprach mich – zu meiner großen Überraschung – ein mir unbekanntes Mädchen meines Alters an, zeigte mir ein Markstück und sagte: »Das reicht für uns beide.« Überglücklich betrat ich mit meiner Gönnerin das Halbdunkel des Kinosaals. Dieses Mal war mir beim Durchschreiten des roten Samtvorhangs am Eingang und der Berührung des schweren Stoffes als träte ich aus der rauen Wirklichkeit in eine verwunschene Zauberwelt ein. Für zwei Stunden vergaß ich alles, was mich in letzter Zeit unglücklich gemacht hatte. Das unbekannte Mädchen habe ich nie mehr gesehen, aber ich denke an sie bis heute voller Dankbarkeit.
Noch mehrere Jahre nach dem Krieg gab es kaum Autos auf den Straßen von Rheydt. Das sollte sich Anfang der 50er Jahre ändern, denn (so berichtet die Fama) kurz zuvor hatte der geniale Konstrukteur Carl F. C. Borgward ein Schlüsselerlebnis: Ihm fielen die zahlreichen Motorradfahrer auf, die unter den Autobahnbrücken Schutz suchten, wenn es regnete. Wie wäre es, den Unglücklichen ein Minimal-Gefährt mit einem Dach über dem Kopf anzubieten? So entstand der erschwingliche Lloyd LP 300, begeistert aufgenommen und in Deutschland (West) das »Wunder« der Motorisierung einleitend.
Das von den Lloyd Motoren Werke GmbH. gefertigte Vehikel bestand aus einer Sperrholz-Karosserie, die mit einer Kunstlederhaut überzogen war. Der Zweitakt-Motor mit 300 ccm und 10 PS(!) verlieh dem Wagen eine Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h – auf ebener Strecke; Steigungen dagegen mochte er nicht: »…steht am Berg und heult«, so der Volksmund. Dafür kostete das Produkt weniger als 3.000 Mark, und war extrem wartungsfreundlich: Da Schäden an der Karosserie leicht mit einem bestimmten, weitverbreiteten Produkt behoben werden konnten, entstand der passend-liebevolle Name »Leukoplastbomber.«
Mein Onkel (von Beruf Elektrotechniker), der nach dem Krieg ein Radio- und Fernsehgeschäft gegründet hatte, benötigte für die Auslieferung seiner Waren ein Fahrzeug und leistete sich als erster in der Familie diesen neuartigen fahrbaren Untersatz, ein beigefarbenes Modell.
Eines Tages machten wir zu Viert einen Ausflug nach Düsseldorf – spannend zwar, aber keineswegs ein reines Vergnügen, denn im Fond gab es nur einen schmalen Notsitz. Da ich ein neues Kleid für eine Festlichkeit bekommen sollte, besuchten wir das Kaufhaus C&A, das kurz zuvor eröffnet hatte. Als mich meine Mutter unbedingt in ein Matrosenkleid zwängen wollte, ich jedoch Uniformiertes überhaupt nicht ausstehen konnte, fuhren wir am späten Nachmittag unverrichteter Dinge zurück nach Rheydt. Zuvor speisten wir in dem berühmten Wirtshaus Fischl an der Königsallee, das wegen seiner üppigen Portionen bei fairen Preisen großen Zulauf hatte. Gewohnt an das beschauliche Rheydt, war ich entsetzt: Der riesige Speisesaal hatte nicht nur den Charme einer Bahnhofshalle, sondern auch deren Geräuschpegel; überall standen Tische dicht an dicht, und Stimmengewirr nebst Porzellangeklapper von allen Seiten ließen keine Gemütlichkeit aufkommen. Ankommende Gäste warteten wie Erpresser hinter den Stühlen derer, die noch nicht einmal bei der Nachspeise angekommen waren.
Imponierend die Portionen: Schlachtplatten, gebratene Haxen und Eisbeine, die über den Tellerrand ragten und von stiernackigen Geschäftsleuten unter reichlichem Bierkonsum mit Inbrunst und Entschlossenheit vertilgt wurden. Sehr appetitlich sah das nicht aus. Auch so stellte sich die Wirtschaftswunderzeit dar.
Bei der Heimfahrt wunderte ich mich über die vielen Menschen, die uns vom Straßenrand aus freundlich zuzuwinken schienen. Es dauerte eine Weile, bis wir merkten, dass die wilden Handbewegungen uns zum Anhalten auffordern sollten, denn aus dem Auspuff unseres »Bombers« drangen nicht nur (wie üblich) schwarze Rauchschwaden, sondern bereits Flammen. Wir haben es erlebt und überstanden: »Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd.«
Die Erfolgsgeschichte Borgward hatte ein trauriges Ende: Im Jahre 1961 musste der Konzern Konkurs anmelden, denn das Minimalkonzept des Leukoplastbombers hatte sich überlebt, und für die Entwicklung eines »richtigen« Autos war die Kapitalbasis der Firma zu schmal. So wurde der Weg frei für den »Käfer« des Volkswagenwerks, womit die von Not und Elend geprägte erste Phase der Nachkriegszeit auch automobilistisch ihr Ende fand – und ebenso meine Kindheit.
Wir haben den Krieg nicht gewollt …
Etwa 3.200.000 deutsche Soldaten sind für »Führer, Volk und Vaterland« gefallen und hinterließen trauernde Ehefrauen und Kinder, die zu Halbwaisen wurden. Eines der Opfer war meine Mutter, die mit nur 26 Jahren »Kriegerwitwe« wurde: Nach über zwei Jahren des Bangens und Hoffens erhielt sie wenige Tage vor Weihnachten 1942 die Nachricht vom Tod ihres Ehemannes Peter Küsters, der kurz vor seinem 29. Geburtstag in Russland gefallen war; hier die Todesanzeigen [DI_Pv].
(Man beachte, dass im Verlaufe des Krieges immer schärfere Vorgaben im Hinblick auf Gestaltung und Text der Anzeigen erlassen wurden.)
Feldpostbriefe
Während der unfreiwilligen Trennung hatte zwischen dem jungen Ehepaar ein reger Briefwechsel stattgefunden. Wie Millionen (nicht nur Deutscher) hoffte es sehnsüchtig auf ein baldiges Ende des Krieges. Allerdings lassen die Briefe einen heute befremdlichen Hurra-Ton erkennen, der für die ersten (siegreichen) Jahre typisch war, und nur aus der Zeit heraus zu verstehen ist.
An seinen Schwager schrieb Peter Küsters am 21. Juni 1940 aus Frankreich: [DI_Pv]
»Wir waren 30 km vor Paris als die Stadt übergeben wurde. Da sind wir südlich weitermarschiert. Bei der Infanterie haben die Füße allerhand zu leisten. In den ersten acht Tagen 350 km abgekloppt. Im Ganzen 700-800 km zu Fuß. Die Übersetzung über den Kanal musste von uns schwer erkämpft werden und hatten leider auch Verluste zu beklagen, u.a. ein guter Kamerad von mir, Hans Wefers, aus Giesenkirchen [Stadtteil von Rheydt, I. D.] und noch einer aus Rheydt …«
»Den ganzen Tag ziehen Flüchtlinge an uns vorbei in ihre Dörfer und Städte zurück. Da kannst Du die erbärmlichsten Bilder sehen mit alten Leuten und kleinen Kindern. Aber man darf hier kein Mitleid bekommen …«
»Gestern fanden wir 150 Eier und teilten sie unter 10 Mann, die wurden direkt verputzt. Der Keller ist jedes Mal voll Wein und Eingemachtem. Hühner und Kaninchen werden gebraten. Auch reine Wäsche finden wir genug. Die Leute, die uns begegnen sind zum Teil sehr freundlich, einige grüßen sogar mit dem deutschen Gruß! Sie sind alle im Groll über die Engländer und wissen, dass er der allein Schuldige ist. Jetzt sind wir wahrscheinlich als Besatzungstruppe hier, bis der Krieg zu Ende ist. Im eigentlichen Kampf sind wir vier Tage gewesen, wo uns die Kugeln so richtig um die Ohren pfiffen und die Granaten ein paar Meter neben uns einschlugen. Einmal hatten wir uns in einem Hohlweg verschanzt. Das hat der Beobachter der feindlichen Artillerie gesehen und hat uns acht Stunden befeuert. Die Einschläge kamen direkt auf unsere Löcher. Neben uns schlug ein Volltreffer ein, zwölf Verwundete und drei Tote. Unser Unteroffizier lag mit zwei Mann im Loch. Zwei wurden verwundet und er hatte Glück, er bekam Granatsplitter durch Gasmaske, Feldflasche und Stiefel. Er hat das Verwundeten-Abzeichen bekommen. Fünf haben das E.K. und der Hauptmann die Spange zum E.K.1 erhalten. Wefers fiel bei einem Angriff auf einen Wald, von wo uns 350 Franzosen vom Panzerwagen aus beschossen. Es kann sich nur um Tage handeln und der Franzose ist erledigt. Dann geht es mit Trommeln und Flöten an den Engländer ran, der jetzt schon die Hosen voll hat.«
»Brennend stürzten die französischen Bomber zu Boden. Nachts kamen sie ab 12 Uhr. Dicht neben uns schlugen die Bomben ein und die M.G.-Salven. Einmal lagen wir in einem Haus, und im Garten schlug eine Bombe ein, so dass der Dreck vor die Scheiben flog. In einigen Monaten werden wir uns wohl alle gesund und munter wieder zu Hause treffen, was dann gründlich gefeiert wird …«





























