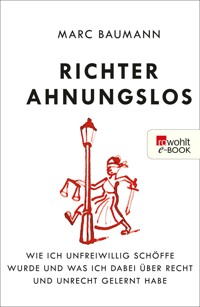
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wer urteilt besser? Bauch oder Bundesgesetzbuch? 2008 wurde Marc Baumann gefragt, ob er Schöffe werden wolle. «Vielleicht», antwortete er. Kurz darauf wurde er zum Laienrichter gewählt. Baumanns Aufgabe in diesen fünf Jahren: Volkes Stimme repräsentieren. Als Schöffe hat er Urteile mitgetragen, die er vor Gericht für vernünftig hielt, die er vor seiner Freundin aber kaum rechtfertigen konnte. Zwischen seiner Vorstellung von Gerechtigkeit und der des Richters lagen oft Jahre. In seinem Buch erzählt er von dieser Zeit – und unserem Rechtsstaat. Eine Innensicht der deutschen Justiz – menschlich, informativ und exzellent erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Marc Baumann
Richter Ahnungslos
Wie ich unfreiwillig Schöffe wurde und was ich dabei über Recht und Unrecht gelernt habe
Über dieses Buch
Wer urteilt besser? Bauch oder Bundesgesetzbuch?
2008 wurde Marc Baumann gefragt, ob er Schöffe werden wolle. «Vielleicht», antwortete er. Kurz darauf wurde er zum Laienrichter gewählt. Baumanns Aufgabe in diesen fünf Jahren: Volkes Stimme repräsentieren. Als Schöffe hat er Urteile mitgetragen, die er vor Gericht für vernünftig hielt, die er vor seiner Freundin aber kaum rechtfertigen konnte. Zwischen seiner Vorstellung von Gerechtigkeit und der des Richters lagen oft Jahre. In seinem Buch erzählt er von dieser Zeit – und unserem Rechtsstaat.
Eine Innensicht der deutschen Justiz – menschlich, informativ und exzellent erzählt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat Florian Glässing
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
Umschlagabbildung Christoph Niemann
ISBN 978-3-644-53511-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Der Autor im Verhandlungssaal
Mein letzter Verhandlungstag
II. Vor Gericht
Wie man Schöffe wird, ohne es zu wollen
Gerichtsreportage: Ende einer Liebe
Schlechte Schöffen, gute Schöffen und ein Gefängnisbesuch
Gerichtsreportage: Der Flaschendieb
Wie im Film: Der erste Prozess
Gerichtsreportage: Der Altenpfleger
Der Gerichtssaal: Die Architektur der Verurteilung
Gerichtsreportage: Der gute Böse
Not und Elend: Die Angeklagten
Gerichtsreportage: Endspiel
Böser Mann, gute Frau: Vorverurteilungen
Gerichtsreportage: Der Kiffer
Ben Matlock. Oder: Gute und schlechte Verteidiger
Gerichtsreportage: Der Vater
Streng vertraulich: Das Richterzimmer
Gerichtsreportage: Der Akademiker
Paragraph 1314, Absatz 2, Punkt 1: Juristendeutsch
Gerichtsreportage: Die kluge Ehefrau
Schuld und Bühne: Das Urteil
III. Am Ende nur Statist?
Warum Sie Schöffe werden sollten: Ein Fazit
Danksagung
Für meinen Vater, der Jurist war, aber leider nicht lange genug lebte, um mir davon erzählen zu können.
I. Einleitung
«Jeans ist in Ordnung, aber kommen Sie bitte nicht im T-Shirt», sagte ein Richter. Der Autor vor Gericht.
Foto: Copyright © Robert Brembeck
Kapitel 1
Mein letzter Verhandlungstag
Im Oktober 2008 wurde ich zu fünf Jahren verurteilt. Zu fünf Jahren Schöffendienst. Die Stadt München hatte mich ungefragt zum Schöffen ernannt, weil es nicht genug Freiwillige gab. Es kam mir damals vor wie eine Strafe: Meine Freundin war schwanger, mein Beruf anstrengend genug, in meinem Leben war gerade kein Platz für einen «Nebenjob» als ehrenamtlicher Richter. Aber die Ernennung ließ sich nicht rückgängig machen, Pech gehabt. Oder besser gesagt: Man hat mich zu meinem Glück gezwungen. Denn so widerwillig ich im Frühjahr 2009 zu meinem ersten Gerichtsprozess als Laienrichter gegangen bin, so unerwartet wehmütig fühlte sich Anfang 2014 der Abschied an.
Dem Amtsgericht München fiel das Schlussmachen offensichtlich nicht so schwer – es gab an meinem letzten Verhandlungstag keine Blumen, keine Urkunde, nicht mal ein Händeschütteln. Niemand kam, um mich zu verabschieden. Ich musste mir nur ein letztes Mal die Aufwandsentschädigung holen und an dem Metalldetektor mit den ratschenden Sicherheitsbeamten vorbei ins Freie gehen. Das wäre es dann gewesen. Und weil mir das alles viel zu unfeierlich war, zu lieblos für so eine lange Zeit und eine so bedeutende Lebenserfahrung, habe ich den Richter zur Verabschiedung angesprochen: «Heute war übrigens mein letzter Tag als Schöffe.» – «Ach, echt?», fragte er, dann liefen wir schweigend den rot gefliesten Steinboden vom Verhandlungszimmer Richtung Treppenhaus entlang. Wir kannten uns von zwei, drei Verhandlungen, gerade genug, sich freundlich zuzunicken. «Hat es Ihnen gefallen?», fragte er, als ich schon dachte, er würde nichts mehr sagen. Ich überlegte einige Sekunden und antwortete dann schnell: «Ja», weil wir an der Treppe angekommen waren, der Richter es eilig hatte, er einen Stock hoch und ich einen Stock runter musste.
Die ehrlichere Antwort hätte länger gedauert: Ja, es war spannend, so viele Kriminelle kennenzulernen, ihre Biographien, ihre Ausreden, ihre Taten. Einblick in die düsteren Ecken der Gesellschaft zu bekommen. Und so kitschig es klingt: Es fühlt sich gut an, den Guten zu ihrem Recht zu verhelfen und die Bösen zu bestrafen. Aber es ist bitter, wenn man eigentlich harmlose Familienväter wegen unbezahlter Rechnungen einsperren muss oder meiner Meinung nach offensichtliche Sexualstraftäter mangels Beweisen nach Hause gehen lässt. Man könnte es sich als Schöffe leicht machen, das Amt als ein stummes Beisitzertum mit gelegentlichem Abnicken von Richterentscheidungen ausüben – was problemlos geht und niemanden stört. So verliefen meine ersten zwei, drei Verhandlungen: Ich sagte nichts und fühlte mich überflüssig. Der Richter wusste ohnehin besser, wer, warum, wie zu welcher Strafe verurteilt werden musste. Doch dann gab es diesen Moment, der mich ärgerte: Eine Richterin verhängte eine mehrjährige Haftstrafe, die ich als maßlos übertrieben empfand, aber nahezu protestlos mitgetragen hatte. Sie sprach das Urteil auch in meinem Namen. Ich saß nachts in der Küche, wachgehalten von meinem schlechten Gewissen, und merkte, was es eigentlich bedeutet, ein Schöffe zu sein. Am anderen Ende der Stadt gab es jetzt einen Mann, der vermutlich auch nicht schlafen konnte, vor Angst und Sorge. Drei Jahre Knast lagen vor ihm. Vielleicht bricht ihn das Gefängnis, vielleicht hält seine Ehe die Trennung nicht aus, seine Kinder werden lernen müssen, ohne ihn auszukommen. Er hat Fehler gemacht, ja, aber ich habe nicht genug Einspruch erhoben und meine Bedenken kleinreden lassen. Als Schöffe zählt meine Stimme genauso viel wie die des Richters, und am Amtsgericht sitzen immer zwei Schöffen mit einem Richter beisammen. Wir könnten ihn jederzeit überstimmen. Was in der Realität nahezu nie passiert.
Bei einer Umfrage des Justizministeriums unter bayerischen Richtern gab es den Vorschlag, die Schöffen weitgehend abzuschaffen. Ehrlich gesagt, machen wir Schöffen nicht immer einen guten Eindruck bei Gericht. Ich habe dumme Fragen gestellt, ich saß mit einem Curryfleck auf dem Sakko (Mittagspause) in der Verhandlung, ich habe unterm Richtertisch heimlich SMS geschrieben. Wir sind Laien und benehmen uns mitunter auch so. Trotzdem sind Schöffen eine große Errungenschaft, es gibt sie seit dem Mittelalter, sie sorgten für eine erste, kleine Demokratisierung der Rechtsprechung, die zuvor nur dem Adel vorbehalten war. Wenn der Richter heute bei der Urteilsverkündung sagt: «Im Namen des Volkes», dann repräsentiere ich als Schöffe das Volk. Ich bin Volkes Stimme. So kann man das Schöffenamt nämlich auch sehen: so groß, so wichtig.
Das Landgericht mag die spektakuläreren Fälle mit skrupelloseren Taten verhandeln – Mord und Totschlag –, aber vor einem Amtsgericht merkt man, wie es um ein Land steht. Weil man so viel erfährt über die Alltagsstreitigkeiten, die kleinen Gaunereien und den Umgang miteinander. Mehr als die zum Glück wenigen Morde entscheidet die Zahl der U-Bahn-Schlägereien, Taschendiebstähle oder Oktoberfest-Grapscher darüber, wie sicher und wohl sich die Menschen in ihrer Stadt fühlen. Die Aussage eines kleinen Kokainhändlers, der Diskogänger, Privatpartys oder Geschäftsleute beliefert, erzählt mir mehr über unsere Sucht als der Großprozess gegen ein Drogenkartell. Wie gut oder schlecht man von Hartz IV als Familie wirklich leben kann, verrät mir mehr als jede Schlagzeile der Prozess gegen den ungeschickten Sozialhilfebetrüger. Beleidigt man sich in Nachbarschaftsstreitigkeiten nur wüst oder wird gleich zugeschlagen? Und worüber kriegt man sich im wohlhabenden München-Bogenhausen oder im Problemstadtteil Neuperlach so sehr in die Haare? Überhaupt bekommt man mit der Zeit und den vielen Wohnadressen der Angeklagten eine neue innere Stadtkarte mit Vierteln, in denen typischerweise der Kiffer oder Schläger wohnt, und Gegenden, deren Bewohner scheinbar nie vor Gericht müssen. Selbst in die Betten dieser Stadt blicken wir vom Richtertisch hinab, wenn Rotlichtgänger, Ehefrauenschläger oder Sextäter vor uns stehen.
Am Vormittag meines letzten Verhandlungstages habe ich, gemeinsam mit einer Mitschöffin und dem Berufsrichter, einen Vater zweier Söhne wegen Betrugs verurteilt – zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Als ihm der Justizvollzugsbeamte im Gerichtssaal die Handschellen anlegte, drehte er sich noch einmal zur Richterbank um, unsere Blicke trafen sich, ich blickte in seine rot geweinten Augen, ich sah seine Angst. Dann holten sich der Richter und ich eine belegte Semmel. Der nächste Angeklagte wartete schon. Er saß seit vier Monaten wegen Diebstahls in Untersuchungshaft, ihm drohten bis zu vier Jahre, nervös und bleich erwartete er den Urteilsspruch. Wir gaben ihm aber nur eine Bewährungsstrafe, er durfte nach Hause. Der Mann ging vor mir aus dem Gerichtsgebäude in den stärker werdenden Regen, er blieb stehen, breitete die Arme aus, schaute zum Himmel und ließ die Tropfen auf sein Gesicht fallen. Er lächelte.
II. Vor Gericht
Kapitel 2
Wie man Schöffe wird, ohne es zu wollen
Ich habe nie gesagt: «Ja, ich will Schöffe werden.» Ich habe nur «vielleicht» gesagt und später ausdrücklich «nein» und «bitte nicht». Aber da war es schon zu spät. So wurde ich Schöffe. Dabei wollte ich nur meinen Personalausweis erneuern.
Als meine hohe Wartenummer endlich aufgerufen wurde, an einem zäh dahinkriechenden Dienstagvormittag im Kreisverwaltungsreferat, fragte mich der Sachbearbeiter nebenbei: «Könnten Sie sich vorstellen, Schöffe zu sein?» Ich versuchte mich zu erinnern, was Schöffen noch mal genau machen. Ging es da nicht irgendwie um das Schlichten von Familienstreitigkeiten vor Gericht? «Vielleicht», antwortete ich, «was macht man denn so als Schöffe?», fragte ich den Beamten, der mich aufmunternd ansah. «Ich lasse Ihnen eine Informationsbroschüre zusenden», sagte der Sachbearbeiter, er lächelte und meinte: «Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass Sie als Schöffe gewählt werden, Sie wohnen nicht lange genug in München.» Er gab mir den Ausweis. Ich ging. Und vergaß die Sache nach einigen Tagen. Wochen später rief mich meine Freundin mit ernster Stimme in der Arbeit an. «Du hast ein Schreiben vom Gericht!», sagte sie. Ich erschrak kurz, dann fiel mir aber kein Grund ein, warum ich mich erschrecken sollte. Weder Fahrerflucht noch Beleidigungen, vielleicht eine übersehene Rechnung? «Hier steht, die gratulieren dir», las meine Freundin vor. «Hab ich was gewonnen?», fragte ich. «Du bist zum Schöffen ernannt worden», sagte sie, «für fünf Jahre!» Moment mal. «WAS? Was bin ich geworden? Und wie lange?», fragte ich, mir fiel der Passbeamte wieder ein. «Die Schöffenperiode dauert vom 1.1.2009 bis zum 31.12.2013, steht hier. Am Amtsgericht in der Nymphenburger Straße», las meine Freundin weiter. «Ich wurde zum Schöffen ernannt», murmelte ich erstaunt vor mich hin. «Schön», sagte meine Bürokollegin, die mir gegenübersaß. «Das ist nicht schön», antwortet ich, «die haben mich gar nicht gefragt!» Aus dem Telefonhörer klang wieder die Stimme meiner Freundin: «Pro Jahr wird ein Schöffe für dreizehn Verhandlungen eingeteilt, macht mal fünf Jahre, ähm, insgesamt fünfundsechzig Gerichtstermine», rechnete sie vor. «Fünfundsechzig Tage? Vor Gericht? Spinnen die?», fragte ich. «Oh», sagte die Arbeitskollegin. «Wie stellen die sich das vor?», seufzte ich. «Wieso hast du dich dann überhaupt beworben?», fragte meine Freundin am Hörer. «Hast du dich da beworben?», fragte die Kollegin gegenüber. «Ich hab mich nicht beworben! Beim Passamt haben die mich gefragt, und ich hab nur ‹vielleicht› gesagt», entschuldigte ich mich. «Wenn du sagst, dass du ‹vielleicht› ein Stück Kuchen willst, würde ich dir eins aufheben. ‹Vielleicht› ist ein kleines Ja», sagte meine Freundin.
Dem Schreiben lag, wie ich später am Abend sah, eine Einladung zu einer Einführungsveranstaltung bei. Und ein Leitfaden für Schöffen. Wo war eigentlich meine angekündigte Informationsbroschüre, die ich vor der Entscheidung für oder gegen das Amt bekommen sollte? Vor allem aber: Dürfen die das? Mich einfach so ohne Rückfrage zum Schöffen machen? Ich hätte nie zugestimmt, wenn ich gewusst hätte, dass man sich für fünf Jahre verpflichtet. Und hieß es nicht, meine Chancen seien ohnehin gering? Was ich zu jenem Zeitpunkt nicht wusste: Der Staat kann seine Bürger zum Schöffensein zwangsverpflichten. Nicht selten muss er das sogar. Die Bayerische Staatszeitung vermeldete im März 2013 in einem Artikel: «Schöffen verzweifelt gesucht!», und schrieb: «Für die bayernweit voraussichtlich 4321 Plätze haben sich bisher allein in München rund 200, in Augsburg immerhin zehn, aber in vielen angefragten Ortschaften noch kein einziger Bewerber gemeldet.» In dieser Not klang mein angedeutetes Interesse für die Schöffenfindungskommission wohl wie ein laut gebrülltes: «Ich will! Ich! Ich!» Ob der Passbeamte meine Bitte um mehr Informationen überhaupt weitergegeben hat, kann ich nicht sagen.
Ich las im Schöffenleitfaden nach: Wer Schöffe werden möchte, bewirbt sich bei seiner Gemeinde oder seiner Stadt, wer Jugendschöffe werden will, beim Jugendamt. Gibt es zu wenig Kandidaten – oder zu wenig naive «Vielleicht»-Sager wie mich, zieht der Zufallsgenerator Namen aus dem Melderegister. In Frage kommt, wer nicht jünger als 25 und nicht älter als 69 Jahre ist, deutscher Staatsangehöriger mit festem Wohnsitz. Wer weder Jura studiert hat noch ernsthaft erkrankt ist oder eine mehr als sechsmonatige Haftstrafe verbüßt hat. Wobei ich den letzten Punkt diskutabel finde. Kann nicht gerade jemand, der im Gefängnis war, besonders gut beurteilen, was eine Haftstrafe bedeutet? Ist nicht gerade der Experte?
In meinem Schöffeninformationsblatt stand viel über den Eintritt ins Schöffenamt, aber nichts über das Ablehnen des Schöffenamts. «Sag denen doch einfach, dass du es dir anders überlegt hast», riet mir meine Freundin. Aber das schlägt nur vor, wer mit seinem Anliegen noch nicht an den harten Gesichtszügen der Sachbearbeiter des Amtsgerichts München zerschellt ist. «Da können wir leider gar nix mehr machen», entgegnete man mir bestimmt. Die Wahl zum Schöffen ablehnen können nur Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen «sowie Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen», so der Leitfaden. Der Bundespräsident und Regierungsmitglieder sind ebenfalls befreit. Die Übrigen müssen schon einen Härtefall vorweisen können, etwa pflegebedürftige Eltern. Ich wählte ein letztes Mal die Nummer der Schöffenstelle und versuchte es mit mehr Schärfe im Ton: «Hören Sie, das will ich nicht!» Vergeblich. Dann fing ich an zu betteln: «Bitte nicht, ich habe keine Zeit dafür, ich arbeite und werde gerade Vater.» Erfolglos. Könnte ich Weinen vortäuschen, hätte ich das auch noch probiert. Aber die gute Nachricht sei doch, sagte mir die Schöffenbeauftragte, dass ich keine Angst vor Benachteiligung am Arbeitsplatz haben müsse: «Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Ihnen an Verhandlungstagen freizugeben.» Danke, auf die zusätzliche Sorge, dass ich mit all den Schöffensitzungen auch noch meinen Chef verärgere, war ich noch gar nicht gekommen.
Das Schöffenamt wird als Ehrenamt nicht bezahlt, aber Schöffen, die selbständig sind, erhalten neben einer Zeitentschädigung von sechs Euro in der Stunde eine Verdienstausfallentschädigung von maximal 24 Euro pro Stunde sowie An- und Abfahrtskosten. Dass ich als zugereister Münchner nicht lange genug in der Stadt lebte, um Schöffe zu sein, war außer dem Mann vom Passamt niemandem negativ aufgefallen. Dabei wird die Kandidatenliste erst vom Stadtrat bestätigt und dann vom Amtsgericht noch mal deutlich reduziert. Wer übrig bleibt, wird zur Einführungsveranstaltung eingeladen, auf der theoretisch noch Problemfälle ausgesiebt werden können, wenn sich jemand zu sehr danebenbenimmt. Das wäre meine Chance zum Ausstieg in letzter Minute gewesen: Mit rot gefärbtem Irokesenschnitt und großem «Anarchie»-Zeichen auf dem T-Shirt zur Einführungsveranstaltung fahren und dort für die Abschaffung des Rechtsstaates argumentieren. Wobei Punksein an sich kein Ausschlusskriterium sein dürfte: «Bei der Auswahl der Schöffen soll ein möglichst breiter Querschnitt der Bevölkerung abgebildet werden», steht im Leitfaden. Meine Mitschöffen kamen mir eher wie ein enger Querschnitt der Bevölkerung vor: Mitte 30 bis Anfang 50, weiß, Bildungsbürgertum, berufstätig.





























