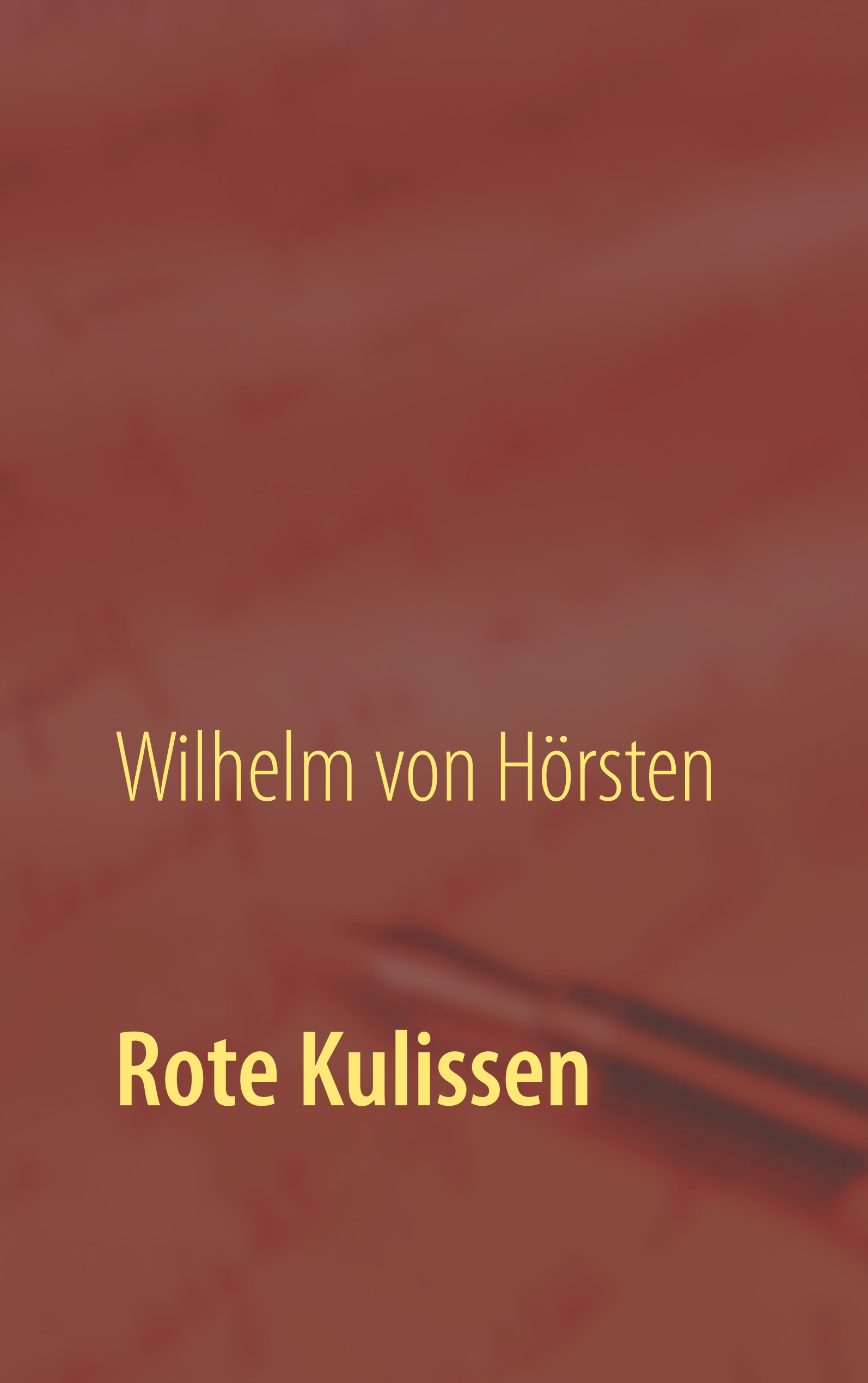
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Rote Kulissen" - ein Zeitzeugenbericht aus den Jahren 1931-39 über politischen Widerstand gegen die Machtergreifung der Nationalsozialisten, über Verraten werden, über das Warten auf einen Prozess, über das Leben in einer Gefängniszelle, über das Leben in totaler Armut nach der Haftentlassung und vor allem geschrieben von einem Mann, der Zeit seines Lebens gradlinig für das eingetreten ist, was ihm wichtig war und sich mutig eingemischt hat. In dankbarer Erinnerung an diesen Vater hat sich die jüngere Tochter von Wilhelm von Hörsten entschlossen, die "Roten Kulissen" als Buch herauszugeben. Das unveröffentlichte Manuskript fand sie erst Jahre nach dessen Tod in seinem schriftstellerischen Nachlass. Dieser Nachlass ist recht umfangreich, denn Schreiben war die Leidenschaft von Wilhelm von Hörsten. So enthalten die "Roten Kulissen" auch eine Reihe von Kurzgeschichten aus der Feder des Autors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Vorwort
Mein Vater, Wilhelm von Hörsten, Jahrgang 1905 schrieb das Manuskript „Rote Kulissen“ Anfang der 70-iger Jahre. In diesem autobiographischen Zeitbericht thematisiert er seinen politischen Widerstand gegen die Machtergreifung Adolf Hitlers.
Erst vor einiger Zeit hielt ich das Manuskript das erste Mal in den Händen. Ich hatte die „Roten Kulissen“ im umfangreichen schriftlichen Nachlass meines Vaters übersehen. Voller Spannung begann ich zu lesen und fühlte mich sofort meinem Vater, der bereits 1978 verstorben ist, sehr nahe. Ich wusste, dass er als KPD-Mitglied im aktiven Widerstand gegen das Naziregime gekämpft hatte, verraten worden war und eine Haftstrafe verbüßt hatte. Aber, dass er seine Erlebnisse aus den Jahren 1933 - 1939 aufgeschrieben hatte, wusste ich nicht.
Erst als Rentnerin las ich, was es für ihn damals persönlich bedeutet hatte, vehement für seine politischen Ziele einzutreten. Ohne Rücksicht auf sich selbst hat er viel Mut und Tatkraft aufgebracht, um die Naziherrschaft mit zu verhindern. Zweifellos habe ich in meiner Kindheit meinen Vater als gradlinigen Mann erlebt, der immer seine Meinung offen gesagt hat, auch wenn es für ihn selbst von Nachteil war. In den „Roten Kulissen“ nachzulesen, dass er seinen menschlichen und politischen Idealen auch in der Einsamkeit der Gefängniszelle treu geblieben war, hat mich von daher nicht überrascht.
Sehr berührt hat mich, wie er nach seiner Haftentlassung in totaler Armut leben musste, da er als Vorbestrafter keine Anstellung fand. Manfred Hausmann sei Dank, der ihm seinerzeit Mut gemacht hat, an seine Begabung zum Schreiben zu glauben. Mein Vater hat seinen Lebensunterhalt dann vorübergehend als freier Schriftsteller mit dem Schreiben von Kurzgeschichten verdient, die in verschiedenen Tageszeitungen abgedruckt wurden. Von 1936 - 1938 wohnte er im Künstlerdorf Worpswede und hat gemeinsam mit Theodor Heinz Körner, Bastian Müller, Waldemar Augustini und anderen jungen Künstlern seine Texte diskutiert. Diese Geschichten gehören mit in die „Roten Kulissen“ und ebenso die kritische Auseinandersetzung meines Vaters mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Schreiben war zweifellos seine Leidenschaft. Aber den Zwang zum Schreiben, um Geld zu verdienen, hat er auch als Fluch erlebt, der den Menschen erniedrigt, wie er es formuliert. „Dann ist es schon besser, man klopft Steine. Moralisch bleibt man dann der, der man ist, “ schreibt er in seinem Manuskript (vgl. S. 141).
Ich habe meinen Vater in all diesen Zeilen wiedererkannt. Gut 40 Jahre nach seinem Tod wurden für mich seine ihm eigene Sprache, seine markigen Worte und seine Ehrlichkeit sich selbst gegenüber neu lebendig. So kannte ich ihn, so prägte er meine Kindheit und darauf bin ich stolz.
Ich habe großen Respekt vor der gradlinigen Haltung meines Vaters, für das einzutreten, was ihm wichtig war, sich nicht zu verbiegen, unbestechlich zu sein und sich mutig einzumischen. Das hat er Zeit seines Lebens getan. Im Nachwort gehe ich auf sein politisches Wirken während meiner Kindheit im Rahmen der sogenannten Bremer Kaisenhausbewegung näher ein.
Die Frage, warum er nicht mit seiner Familie und insbesondere seinen beiden Töchtern über seine Erlebnisse, seine Erfolge und auch sein Scheitern gesprochen hat, beschäftigt mich. Ich hätte ihn gerne so Vieles gefragt. Wahrscheinlich war die Zeit nicht reif dafür.
Zum Abdruck des Manuskriptes „Rote Kulissen“ habe ich mich entschieden, da es sich meiner Ansicht nach um einen wichtigen Zeitzeugenbericht eines politisch Verfolgten des Nationalsozialismus handelt. Zudem denke ich, mein Vater hätte mit den heutigen Publizierungsmöglichkeiten sein Werk sicherlich veröffentlicht.
Ulrike von Hörsten-Wenzl
Scheeßel, im April 2020
Wilhelm von Hörsten
15.07.1905 – 16.12.1978
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Bettler
Der alte Agent
Das Mädchen Marie schläft allein
Das Mädchen mochte mich nicht leiden
Das Kontobuch
Der kleine Bruder
Der Besuch
Der Streit
Der Wurf gegen das Fenster
Die Baskenmütze
Eine Familie fährt in die Ferien
Die kleine, bunte Tasse ist entzwei
Das Mädchen mit dem Ring
Die Versöhnung
Die Heiratsfalle
Der Mondsüchtige
Das Wiedersehen am Mittagstisch
Zwei silberne Ringe
Nur ein alter Weidepfahl
Die Verlobungsanzeige
Als ich meine kleine Schwester vergaß. . .
Und außerdem die Liebe
Das schadet der Liebe nichts
Abschied von Angelika
Das Mädchen mit dem Schleierhut
Die Sache mit dem Schauspieler
Nachwort
Den Bericht beginne ich mit dem schäbigen Gesicht eines Mannes, der am Straßenrand stand und grinste, als ich am 24. März 1933 abends gegen 18.00 Uhr von der politischen Polizei verhaftet worden war und abgeführt wurde.
Er grinste.
Sie grinsten alle – Männer und Frauen, Burschen und Mädchen, Feierabendzeit, Nachhauseweg – und genossen das Schauspiel eines Abtransportes von Gefangenen: zwei Männer und eine Frau, angekettet an robuste Gesellen: Mäntel, Hüte und Melonen.
Viele Gesichter.
Und doch prägte sich mir nur das Gesicht eines Mannes ein. Es lugte unter einem Hut hervor, der Ähnlichkeit mit einem Schiff hatte. Der Mann war nicht groß. Alter ungefähr 40 – 45 Jahre. Dem Bild nach ein Arbeiter, der auf dem Heimweg war. Möglicherweise kein unrechter
Mensch. Vielleicht hatte er bis zur Stunde seine Partei- und Gewerkschaftsbeiträge pünktlich bezahlt. Wer weiß, ob er nicht auf die Barrikaden gegangen wäre, wenn seine Gewerkschaftsleitung ihn gerufen hätte. Die letzte große Arbeiterdemonstration Anfang März 1933 hatte er wahrscheinlich mitgemacht. Aber nun stand er am Straßenrand und grinste….
Und er grinste nicht allein. Und doch war es gerade sein Gesicht, das sich mir einprägte. Er grinste stellvertretend für alle, die den Faschismus beobachteten, hier und zu dieser Stunde und in der ganzen Welt: Bonzen und Bürger, Politiker und verwandte Berufe, Regierungschefs, Minister und Ratgeber, Könige und alles was da kreucht und fleucht.
Sie lehnten zwar den Faschismus ab, aber sie grinsten und ließen die verbluten, die das demokratische Banner, das Banner der Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit hochhielten.
Aus.
Am 24. März 1933 um 18. 00 Uhr saß ich in der Zelle. Im Augenblick meiner Verhaftung versuchte ich noch zu flüchten, aber dann guckte ich in die Pistolenläufe der Kriminalbeamten. Der eine sagte: Bleiben Sie stehen oder ich schieße und der andere befahl: Gehen Sie in die Gartenlaube oder ich schieße. Eine brenzlige Situation, zumal erst einige Tage vorher Hermann Göring befohlen hatte: Schießt! Ich verantworte das.
Links und rechts von dem Gebäude, das ich verlassen hatte, stand ein Beamter mit der Pistole im Anschlag. Ich hatte die Arme hochgenommen und rief: Zum Teufel nochmal, was wollen Sie von mir? Der eine sagt: Ich soll stehenbleiben, der andere sagt: Ich soll ins Haus gehen. Geben Sie mir einen klaren Befehl und ich befolge ihn.
Meine klare und laute Sprache veranlasste die Herren, sich zu verständigen. Sie forderten mich auf, in das Gartenhaus zurückzugehen. Ich wiederholte ihre Worte. Als sie sie mir bestätigten, erklärte ich: Ich gehe jetzt ins Haus zurück.
Ich ging.
Gut ein Jahr später wurde ich von einem Gefängnis im Oldenburgischen nach Bremen zu einer Vernehmung abgeholt: Ein Auto, 2 Beamte, eine herrliche Fahrt durch den Frühling.
Ich mache Sie darauf aufmerksam: Bei einem Fluchtversuch schießen wir, sagte einer der Beamten.
Wir fuhren durch eine hübsche Landschaft: Rechts ein Tal mit einem kleinen Fluss. Wunderschön. Einmal hätten wir sie schon fast um ein Haar über den Haufen geschossen, sagte einer der Beamten. Sie wissen doch noch, damals…..
Seine Stimme klang vorwurfsvoll. Er guckte mich an. Ich stierte geradeaus. Es stimmt also: fast um ein
Haar….
Er zeigte mir einen Revolver. Vielleicht war es derselbe, mit dem er mich bei meiner Gefangennahme bedroht hatte. Ich zuckte die Achseln: warum fliehen?
Wir fuhren durch eine hübsche Landschaft. Rechts ein Tal mit einem kleine Fluss. Sonnenschein über alles.
Wunderschön.
Ich sah das und sah das auch nicht. Ich hatte seit gut einem Jahr nichts als Gefängnismauern und Gitter gesehen. Mir ging das Herz über und doch fragte ich mich beklommen: Was hat man mit dir vor?
Vielleicht wollte man mich auf der Flucht erschießen? Oder in einem berüchtigten Lokal SA-Quartier am Buntentorsteinweg - dem früheren Lokal der Arbeiterzeitung vernehmen? Begleiterscheinungen: Drangsalierungen, zusammenschlagen, an die Wand stellen, erschießen.
Meine Begleiter waren nett zu mir. Sie redeten auf mich ein, wie auf einen kranken Gaul. Je freundlicher sie sich verhielten, desto zurückhaltender wurde ich. Mir blieb der Mund verschlossen. Ich nickte, sagte ja oder nein. Schweigen.
Nein, auf der Fahrt passierte nichts. Die Herren lieferten mich im Untersuchungsgefängnis ab. Sie sorgten noch dafür, dass ich einen Schlag Essen bekam. Nette, freundliche Leute, die sich von mir verabschiedeten. Als ich wieder auf einer Zelle saß und in dem Essen herumstocherte, ärgerte ich mich doch, dass ich die Einladung zu einem Gasthausessen abgelehnt hatte. Die Beamten hatten mich gefragt, haben Sie Hunger? Möchten Sie etwas essen? Sie brauchen nur ja zu sagen. Ich schüttelte den Kopf. Nein danke.
Es kam mir darauf an, mich mit diesen Leuten nicht sonderlich einzulassen. Ich traute ihnen nichts Gutes zu.
Sie konnten mich über den Haufen schießen, ohne dass man ihnen deswegen ein „Haar krümmen“ würde. Im Gegenteil: Es winkten Orden und Ehren…
Um ein Haar hätten wir sie damals über den Haufen geschossen, hatte der Beamte erklärt. Sie erinnern sich doch noch? Damals…..
Damals:
An dem Tag, an dem man mich verhaftet hatte, lebte ich seit drei Wochen illegal. Kurz nach dem Brand des Reichstagsgebäudes wurden die aktiven Mitglieder der KPD und der Antifaschistischen Aktion verfolgt. Sie verkrochen sich bei Genossen, die weniger bekannt waren. Die Solidarität der Arbeiterklasse bewährte sich. Der Faschismus triumphierte, und seine Gegner teilten die Furcht und die Hoffnungslosigkeit und das Brot. Keiner hatte etwas Besonderes in den Tee zu brocken. Sie lebten von heute auf morgen, von niedrigen Löhnen oder kargen Unterstützungen. Aber sie hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Gegen den Faschismus! Gegen die Sklaverei, den Krieg und den Tod. Für den Sozialismus! Für die Freiheit, den Frieden und das Leben. 1931 war ich der Kommunistischen Partei beigetreten.
Nicht enthusiastisch. Und nicht von heute auf morgen. Ich stand ihr außerordentlich fremd gegenüber. Ja, ich lehnte sie ab. Zwischen uns befand sich ein tiefer Graben.
Familienmäßig bin ich in einer sozialdemokratischen Tradition aufgewachsen. Mein Vater war ein gewerkschaftlich organisierter Handwerker. Er las das Volksblatt. Es ging ihm um Aufklärung, Fortschritt, Demokratie. Er war eng mit seiner Klasse verbunden. Er sagte: Wir und umschloss damit seine Kollegen und Genossen.
Was heißt aufgewachsen?
Wir standen „links“. Wir, die Arbeiter und die Angestellten, unser ganzes Wohnviertel, Tausende von kleinen Leuten, eine ganze Klasse. Die anderen gehörten nicht zu uns und wir nicht zu ihnen. Mein Vater umriss sie manchmal mit dem Ausdruck: Scharfmacher. Er sprach nicht gerade von Kapitalisten und Blutsaugern.
Aber irgendwie lagen diese Bezeichnungen, wenn nicht gar Begriffe, in der Luft.
Tägliche politische Randbegleitungen und Ereignisse geisterten auch durch unsere Wohnung und Familie.
Die Eltern unterhielten sich über die Aussperrung von Arbeitern, die den 1. Mai gefeiert hatten. Den Gemaßregelten gehörte unsere Anteilnahme, unsere Sympathie.
Oder der Vater belustigte sich über die dummdreisten Bemerkungen unserer bäuerlichen Verwandten, für die der Sozialismus ein rotes Tuch war. Die Eltern frohlockten miteinander oder guckten finster in den Tag, je nachdem, wie es um unsere Sache stand.
Nun, das spielte sich alles nur am Rande des Lebens ab. Mein Vater gehörte um diese Zeit außer der Gewerkschaft keiner politischen Organisation an. Ihm mangelte es wahrscheinlich noch am Selbstbewusstsein. Er steckte vermutlich noch mit einem Fuß in seiner ländlichen Vergangenheit, die er verachtete. Die ihn aber doch wohl nicht losließ.
Er war der Jüngste einer Bauernfamilie der Lüneburger Heide. Während seine Brüder körperlich nicht besonders in Erscheinung traten, überragte er sie. Statt für die Landwirtschaft, interessierte er sich für Steine. Damit spielte er als Kind. Aus diesem Hang entwickelte sich vielleicht der Wunsch, Maurer zu werden. Er wurde erfüllt.
Ein Bauernsohn, der ein Handwerk erlernte, war um diese Zeit – besonders aus der stolzen Perspektive unserer Familie- etwas Außergewöhnliches. Ich verneige mich im Stillen vor meinem Großvater, der das zugab.
Vielleicht konnte er mit seinem jüngsten Sohn nichts anderes anfangen, vielleicht war er froh, ihn auf diese Weise vom Hof zu entfernen. Das Spiel mit den Steinen aber hatte wohl den Ausschlag gegeben.
Steine haben ihn auch sein Lebtag nicht losgelassen. Bei einem Gang durch die Stadt konnte es vorkommen, dass er sagte: Den Giebel habe ich gebaut. Oder: An dem Haus habe ich auch mitgearbeitet. Er interessierte sich für jedes fortschrittliche Bauwerk. Es konnte geschehen, dass er mit der Hand gegen eine Wand schlug, gleichsam um sie zu prüfen. In dieser Geste lag eine Liebkosung.
Die Zeit, in der lebte, gehörte den Robusten. Man brauchte nur 2 Gedanken zu leben und keine 100. Er hatte 100, aber er war sich seiner Kraft nicht bewusst.
Die Robusten triumphierten; er unterlag.
Es ist möglich, dass aus diesem Gegensatz seine sozialistische Einstellung entsprang. Er lernte sie vermutlich in seiner ersten Gesellenzeit im Ruhrgebiet kennen. Er hatte Bebel und andere legendäre Arbeiterführer gehört.
Eine Welt begann sich in ihm abzuheben, die hell und licht und weit war: Freiheit, Demokratie, Sozialismus.
Er hat wegen seiner politischen Haltung manchen Nasenstüber eingesteckt; das hat ihn aber nicht angefochten. Andererseits ist er über eine gefühlsmäßige sozialistische Bindung nicht hinausgewachsen. Meinen Schritt zur kommunistischen Partei hat er nicht verstanden.
Lass die Finger davon, riet er mir inständig, als wir uns einige Tage nach Hitlers Machtergreifung vor dem Arbeitsamt trafen. Sie sperren dich ein. Was hast du davon?
Ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe. Vielleicht habe ich an ihm vorbeigeguckt. Vielleicht habe ich aber auch gesagt: das musst du doch verstehen, die Arbeiterklasse…… Besonders zuversichtlich war mir in dieser Stunde nicht zumute. Die Auseinandersetzung zwischen Faschismus und Sozialismus stand zwar noch bevor. Eine Einigung zwischen SPD und KPD und eine Äußerung des ADGB würde genügen, um Hitler und seine Faschisten von heute auf morgen wegzufegen. Die Antifaschistische Front war bis zur Stunde ungeschlagen.
Ich fühlte mich also zunächst der sozialdemokratischen Partei verbunden. Klar, dass ich von der ersten Stunde meiner Berufstätigkeit an gewerkschaftlich organisiert war. Im Grunde war das in der damaligen Zeit eine Leistung für einen jungen kaufmännischen Angestellten, zumal ich mich aktiv am Aufbau und der Leitung einer Jugendgruppe beteiligte. Meinem Chef blieben diese Vorgänge nicht verborgen. Er sah sie vielleicht nicht gern, wenn es aber um Gehalts- und Sozialfragen ging, zog er mich als Verbandexperten zu Rate.
Viele Jahre bedrängten mich weder politische noch gewerkschaftliche Fragen. Ich war dabei. Ich gehörte dazu.
Genau wie der Refrain des Liedes: Mit uns zieht die neue Zeit! Mit uns zieht die neue Zeit!
Erst als es mir wirtschaftlich an den Kragen ging, wurde ich wach. Ich verlor meine Stellung und gehörte zu der Arbeitslosenarmee. Statt zu verzagen, beobachtete ich aufmerksam das Geschehen um mich. Ich guckte in die Zeitung – in erster Linie in die SPD-Presse und zog vielerlei Schlussfolgerungen aus dem, was ich las. Je aussichtsloser meine berufliche Lage wurde, desto stärker klammerte ich mich an sozialistische Theorien, um einen Ausweg zu finden. Neben vielen guten Erkenntnissen und Schlussfolgerungen, die ich zum Leben – zum Weiterleben - brauchte, begannen mich aber auch Zweifel zu plagen, die mich in Depressionen stürzten, unter denen ich kategorisch erkannte: Alles, was du dir zusammengereimt hast, was die SPD zu vertreten vorgibt, dieses ganze Drum und Dran um ihren Sozialismus ist Schwindel. Da steckt in Wirklichkeit nichts hinter. Du befindest dich auf dem Holzweg.
Zu meinen Hausgenossen gehörte auch ein junger Mann, ein Buchdrucker, mit dem ich viele interessante Gespräche geführt habe. Er war politisch und gewerkschaftlich organisiert und verfügte über gute Urteile und Ansichten.
Aber dann begann er mir auszuweichen. Wir kamen nur noch selten zu einer Aussprache. Und wenn, dann fehlte ihm das Feuer, der alte Elan. Er lehnte meine Fragestellungen ab oder wurde nicht mehr in seiner alten Art mit ihnen klar. Das enttäuschte mich.
Eines Morgens holten sie ihn ab. In einem Sarg. Er hatte sein Leben beendet. Das große Warum wusste keiner im Haus zu beantworten. Alle standen vor einem Rätsel.
Solch ein ordentlicher junger Mann. Er hatte solch eine gute Stellung. Er war immer so freundlich und hilfsbereit. Allerdings, in letzter Zeit war er oft sehr missmutig gewesen. In solch einer Stimmung war es dann wohl passiert.
Die Partei wies diesen Mann als ein Opfer der kapitalistischen Epoche aus. Ein Widerspruch erfolgte nicht. Sie half, ihn unter die Erde zu bringen. Und nach wie vor galten die alten Lieder.
Ich benötigte eine lange Zeit, um mit den Zusammenhängen fertigzuwerden. Mit der SPD fühlte ich mich nicht mehr verbunden. Ich suchte Realitäten und keinen Pseudosozialismus. Es ist verständlich, dass in meinen Blickpunkt auch die KPD geriet. Auch eine Arbeiterpartei, auch links. Und… Nein, ich bin keineswegs mit fliegenden Fahnen zu ihr übergegangen. Uns trennte ein tiefer Graben, über den ich nicht wegkonnte. Der Einfluss der SPD wirkte sich noch aus. Ich traute denen da drüben alles Gute und Großartige zu und sicherlich auch einen ehrlichen Kampf um den Sozialismus, aber ich konnte mich ihnen nicht anschließen, meine Abneigung war zu groß.
Nichtsdestoweniger versuchte ich, mich über die kommunistische Partei zu informieren. Ich las ihr Zeitungsorgan, mit dem ich aber nicht viel anfangen konnte. Die SPD-Presse bezeichnete das Blatt als „Blutigen Knochen“. So ungefähr konnte einem die Zeitung auch vorkommen, wenn man die auf Aufputschung und Hass ausgerichteten Artikel las.
Ich erwartete von einer Arbeiterpresse Aufklärung, Analysen, Lichtblicke. Sie hatte vor nichts zurückzuschrecken, auch nicht vor sich selbst, wenn es um die Sache und die Zukunft der Arbeiterklasse ging. Und damit auch um Deutschland und die Internationale.
Man fischte aber leider nur für den Augenblick. Die großen Perspektiven fehlten.
Mehrmals besuchte ich Versammlungen des kommunistischen Jugendverbandes, die mich aber gleichfalls nicht überzeugten. Meistens erfolgte ein hektischer Vortrag in Ausdrücken, die mir fremd waren. Anschließend gab es oft eine Aussprache, in denen sich die Teilnehmer mit Fäusten gegenüberstanden. Das gefiel mir nicht. Ich suchte einen soliden Grund, eine Überlegenheit und keine Faustpolitik.
Aber dann siegte doch wohl meine innere Bereitschaft: Die da drüben können was. Die machen eine ehrliche Arbeiterpolitik, denen musst du dich anschließen. Eines Tages füllte ich dann einen Aufnahmeantrag für die KPD aus. Damit trennte ich mich von meiner Vergangenheit. Als ich den Schein in der Parteizentrale abgegeben hatte, war mir zumute, als wenn ich alle Brücken hinter mir abgebrochen hätte. Nun stand ich auf der anderen Seite der Barrikade. Ich war gespannt, was ich erleben würde.
Ich hatte bislang viel von der kommunistischen Aktivität gehört und war enttäuscht, dass man offensichtlich keine Notiz von meinem Beitritt zur Partei genommen hatte. Es vergingen Wochen, ohne dass man sich um mich kümmerte. Eines Tages jedoch erhielt ich eine Einladung zu einer Zellensitzung. Sie fand in der Privatwohnung eines Genossen statt und zwar in dessen Küche. Außer mir war noch ein Mann zu dieser Versammlung erschienen. Und natürlich auch ein Referent, der sich als Stadtteilleiter vorstellte und gut eine Stunde auf uns einsprach. Er hielt ein Referat, als ob er tausende von Zuschauern vor sich hatte. Anschließend forderte er uns zur Aussprache auf.
Wir schwiegen.
Ich hatte ohnehin nichts zu sagen, denn seinem Vortrag war ich nicht gefolgt. Das einzige, woran ich mich erinnerte waren sein großer Mund und seine Armgestikulationen, mit denen er seine Worte unterstrich. Alles andere war an mir vorbeigegangen.
Dennoch brachte der Abend ein positives Ergebnis zuwege. Die Parteizelle wurde neu aufgebaut. Ich wurde als politischer Leiter vorgeschlagen und mein Genosse als Orgleiter. An uns lag es nun, etwas aus unserem Auftrag zu machen.
Der Genosse und ich gingen gemeinsam nach Haus, Er war Seemann von Beruf und lag im Augenblick arbeitslos an Land. Der Partei gehörte er schon viele Jahre an.
Quatsch, sagte er. Das mit dem Referat - großer Quatsch.
Als ich der Einladung folgte, bekannte ich, hatte ich noch etwas Mut. Aber nun bin ich enttäuscht. Ist das die kommunistische Partei?
Gar nicht um kümmern, antwortete er. Wir bauen die Zelle auf, sollst mal sehen. Übrigens hier habe ich eine Broschüre. Wenn du die lesen willst?
Ich hielt ein schmales Heft in der Hand, sagte: Danke und wir verabredeten uns, um die weitere gemeinsame Parteiarbeit aufzunehmen.
Auf diese Weise gelangte ich in den Besitz einer Broschüre von Karl Marx. Heute – 35 Jahre später - bemühe ich mich, mich an ihren Titel zu erinnern. Ich glaube, die Broschüre hieß: Lohn, Preis und Profit. Sie gab mir damals einen klaren Überblick über wirtschaftliche Zusammenhänge, über den Mehrwert und die Rolle der Arbeiterklasse im Rahmen der kapitalistischen Epoche.
Ihr Inhalt war einfach und klar gehalten. Er ging mir ein wie Honiglecken. Ich bekam plötzlich einen sicheren Boden unter den Füßen. Mein Entschluss, der KPD beizutreten, bestätigte sich mir als gut und richtig.
Sicherlich hatte ich für die Kenntnisnahme dieser Broschüre in mir schon einen guten Boden vorbereitet. Ich hatte mir über die Verhältnisse, die mich umgaben, Gedanken gemacht, sie aber nicht so präzise und entschlossen formuliert, wie ich sie in der Broschüre meines Genossen vorfand. Die hier erarbeiteten Ergebnisse rissen mir eine Binde von den Augen. Ich war bisher blind gewesen, nun aber war ich sehend geworden.
In der letzten Zeit habe ich mich bemüht, diese Broschüre wieder aufzufinden. Das ist mir leider nicht gelungen. Aber was für Schriften von Marx und Engels mir auch in die Hände fielen, jede verkörperte die Erkenntnis, die mir damals zu Eigen wurde.
ich entdeckte damals, dass die Lage der Arbeiterklasse hoffnungslos ist, dass man ihre Mitglieder immer nur im Schnitt so viel verdienen lässt, wie sie zur Erhaltung ihrer Arbeitskraft und ihrer Fortpflanzung benötigen.
Was sie über diesen Betrag hinaus schaffen, gehört ihrem Arbeitgeber, der den Mehrwert einheimst. Dieser Vorgang führt zur Anhäufung des Kapitals und im Endergebnis – in der Endauseinandersetzung – zur Enteignung der Enteigner und zum Sozialismus.
Ich gewann einen Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge und politische Schluss-folgerungen, wie ich sie mir klarer und eindeutiger nicht wünschen könnte.
Bislang hatte ich mich mit meinen Gedanken und Auffassungen im Nebel aufgehalten, aber nun überschaute ich nicht nur meine Lage, sondern auch die meiner Klasse; ich wurde ihr überzeugter Kämpfer.
Es ist für das Leben unerlässlich, wichtige Erkenntnisse unter den Füßen zu haben. Karl Marx hat die kapitalistischen Zusammenhänge ergründet und in seinen Lehrsätzen an uns weitergegeben. Die damit verknüpften politischen Hoffnungen und Schlussfolgerungen werden sich erfüllen, wenn wir die Marxsche Lehre mit der jeweiligen gesellschaftlichen Form konfrontieren.
Zu Beginn des 2. Weltkrieges berichtete ein Freund, der in Bremen als Hilfspolizist die Vorlesungen einer Verwaltungsakademie besuchte, dass ein Professor aus Münster über den Geldumlauf und seine Gesetzesmäßigkeit gesprochen hätte. Der Vortragende schloss seine Erklärungen mit dem Hinweis, dass sie nicht von ihm stammten, sondern von Karl Marx. Danke.
Mein Freund amüsierte sich noch nachträglich über die langen Gesichter der Zuhörer, die das nationalsozialistische Parteiabzeichen im Knopfloch trugen. Nein, dem Professor geschah nichts. Die Faschisten verdammten den Politiker Marx, auf den Wissenschaftler Marx konnten sie und kann auch heute noch keiner verzichten.
Umso lächerlicher ist es, wenn es, wenn es Nachbeter gibt, die Karl Marx als überholt bezeichnen. Sie fischen im Trüben, um sich den herrschenden Leuten Liebkind zu machen. Die wirtschaftlichen Erkenntnisse des Wissenschaftlers Karl Marx sind nicht zu widerlegen; sie bestätigen sich täglich. Seine Leistung aber ist ohne seine politischen Schlussfolgerungen wohl nicht richtig zu würdigen.
Gerade diese politischen Schlussfolgerungen glaubt man heute mit einem Achselzucken abzutun, obgleich sie einem auf Schritt und Tritt in ihrer Realität begegnen. Die Anhäufung des Kapitals nimmt in all seinen Erscheinungen immer extremere Formen an. Auf der einen Seite stehen die Millionen Menschen, die man ohne Rücksicht auf ihre Klassenherkunft zur Massenexistenz verdammt. Die Voraussetzungen für die Umwandlung der kapitalistischen Gesellschaft in eine sozialistische spielen sich vor unseren Augen ab.
Eines Tages holte mich der Orgleiter unserer Zelle ab. Wir besuchten die Stadtteilleiter-sitzung, in der die Org- und Polleiter der unteren Einheit unseres Bremer Stadtteiles zusammengefasst wurden. Der Leiter des Stadtteils war der Genosse, der auf der ersten Zellensitzung, an der ich teilgenommen hatte, zwei Stunden vor zwei erschienenen Mitgliedern gesprochen hatte.
Er hielt auch auf der Stadtteilleitersitzung ein langes politisches Referat. Anschließend wurden organisatorische Fragen besprochen. Die verabredeten Aufgaben blieben aber meistens in der Luft hängen; selten, dass sie sonderlich zum Zuge kamen.
Im Laufe der Zeit wurde ich durch die tägliche Parteiarbeit mit den Genossen innerhalb der Zelle bekannt.
Sie nahmen mich in ihren Familien freundlich auf. Durch sie wurde ich mit der Bremer Parteigeschichte bekannt. Viele von ihnen hatten die Bremer Räterepublik aktiv verteidigt. Sie gehörten zu den Mitbegründern der KPD. Durch sie wurde ich auch mit den internen Auseinandersetzungen und Kämpfen innerhalb der Partei bekannt. Es gab linke und rechte Genossen, richtige und falsche Plattformen, kurz gesagt, den Berichten nach ein tolles Durcheinander. Erst nach der Übernahme der Parteiführung durch Ernst Thälmann festigte sich die politische Organisation. Es ging aufwärts und vorwärts. In diesen Stunden war ich dabei. Drei Monate nach meinem Beitritt zur KPD wurde ich von den Genossen unseres Stadtteiles auf einer Stadtteilleitersitzung zum politischen Leiter gewählt. Der bisherige Stadtteilleiter hatte nach einer heftigen Aussprache seine Funktion zur Verfügung gestellt und mich, der ich ihm die Hölle heiß gemacht hatte, zu seinem Nachfolger vorgeschlagen.
Auf der vorletzten Stadtteilleitersitzung war beschlossen worden, die Genossen auf dem Lande durch einen Besuch zu unterstützen. Unserem Stadtteil war der Landkreis Soltau zugeteilt worden. Wir verabredeten uns, am Sonnabend mit Rädern nach Soltau zu fahren, bei den dortigen Genossen zu übernachten und am nächsten Morgen mit ihnen auf dem Lande zu agitieren.
Im Laufe der Woche gelang es mir insbesondere die jungen Genossen für die Agitationsfahrt zu interessieren. Wir setzten unsere Räder instand oder beschafften sie leihweise. Auf jeden Fall waren wir für die Agitationsfahrt vollständig zur Stelle, ausreichend mit Broschüren bewaffnet, um die Landbevölkerung zu informieren.
Wir warteten an der Abfahrtstelle auf den Genossen Stadtteilleiter, der uns begleiten wollte. Es stelle sich dann allerdings heraus, dass er zu Hause auf dem Sofa lag und schlief. Er hatte nicht mit der Aktivität seiner Mitglieder gerechnet. Du liebe Zeit, es waren schon so viele Beschlüsse gefasst und nicht durchgeführt worden. Und gerade heute…..
Er räkelte sich auf dem Sofa hoch und sah nicht nach einer 80 Kilometer Radfahrt aus, um anschließend den Bauern politische Broschüren zu verkaufen. Es wäre ihm wohl am liebsten gewesen, wenn wir unser Vorhaben aufgegeben hätten. Doch die Genossen waren mächtig in Form: Sie wollten auf jeden Fall fahren.
Wissen die Soltauer Bescheid, dass wir kommen, wurde der Stadtteilleiter gefragt. ja, sie wissen Bescheid, antwortete er.
Und ab ging die Reise.
80 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, ist keine Kleinigkeit. Da gehört schon etwas dazu, zumal wenn man nicht sonderlich trainiert ist. Und das waren wir alle nicht. Aber unsere Begeisterung für eine beschlossene politische Aufgabe meisterte alle Schwierigkeiten.
Abends gegen 9 Uhr trafen wir in Soltau ein.
Leider hatte unser Genosse Stadtteilleiter die Soltauer Genossen über unseren Beschluss und unsere voraussichtliche Ankunft nicht informiert. Das gab den Bremern einen Knacks. Sie wollten wohl schier verzweifeln über die Lage, in die sie die eigene Parteileitung gebracht hatte. Die Soltauer Genossen aber fanden sich schnell zusammen. Die Bremer wurden samt und sonders in ihren Familien untergebracht. Die Quartierfrage war gelöst.
Am nächsten Morgen begleiteten uns die Soltauer Genossen auf unserer Agitationsfahrt. Wir wählten eine Route, die uns gleichzeitig wieder auf die Heimreise brachte. Wir setzten eine Menge Broschüren um und hatten viele interessante Diskussionen.
Gegen Mittag verabschiedeten sich die Bremer von den Soltauer Genossen mit einem dreimal kräftigen Rotfront. Der Abschied fiel allen schwer. Abends trafen wir wieder wohlbehalten in Bremen ein. Und am nächsten Abend fand das Debakel in der Stadtteilleitersitzung statt.
Es ging hoch her.
Ich hielt meine Jungfernrede. Mein Herz pochte wie nicht recht klug. Aber ich kam gut über die Runden und brachte alles vor, was uns über das Versagen der Stadtteilleitung bedrückte. Nachdem auch von anderen Genossen eine durchgreifende Änderung verlangt worden war, stellte der Genosse Stadtteilleiter seine Funktion zur Verfügung, indem er mich gleichzeitig zu seinem Nachfolger vorschlug. Dieser Vorschlag wurde von den Anwesenden begeistert aufgenommen. Die Abstimmung ergab meine einstimmige Wahl zum Stadtteilleiter.
Noch nicht, sagte mein Vorgänger. Die Wahl muss von der Bezirksleitung, abgekürzt BL, bestätigt werden. Erst dann ist sie gültig. Er rechnete vermutlich damit, dass die BL meine Wahl beanstanden würde. Dieses Recht stand ihr zu; das gehörte zu einer zentralistischen Demokratie, wie man uns erklärt hatte.
Dem Genossen oblag es also, der Bezirksleitung mitzuteilen, dass er abgewählt worden war.
Diese Mitteilung löste, wie ich später erfuhr, bei der zuständigen Leitung ein lautes Gelächter aus. Ein Polleiter, der seine eigene Abwahl bekannt gab, so etwas war ihr noch nicht vorgekommen. Er musste den Vorgang genau erzählen.
Obgleich er mich in übelster Weise verdächtigte, erkannte man die Wahl an. Man war gespannt, mich auf der nächsten Sitzung aller Bremer Stadtteilleiter kennenzulernen.
Die Sitzung fand jede Woche am Donnerstag statt. Sie wurde von dem Organisationsleiter der Partei geleitet.
Einer der anwesenden Genossen gab einen politischen Überblick, der anschließend aus der Sicht der BL ergänzt wurde. Der Abend schloss mit organisatorischen Besprechungen.
Ich erinnere mich noch, dass man mich bei meinem ersten Aufkreuzen in diesem Kreise besonders aufmerksam angeguckt hat, dass ich aber von Stund an der anerkannte politische Leiter der Bremer Altstadt und der Vorstadt Findorff war. Mein Vorgänger bekam einen Posten in der Abwehr, das heißt, ihm oblag es, parteifeindliche Vorgänge aufzuklären und die Linie der Partei zu sichern Die ersten Sporen für dieses Amt hatte er sich vermutlich durch meine Charakterisierung verdient.
Diese Zusammenhänge, die mir nicht verborgen blieben, berührten mich nicht. Ich bemühte mich, die Stadtteilorganisation in den Griff zu bekommen. Abend für Abend war ich in den verschiedenen Zellenbereichen unterwegs. Meine Aktivität steckte die Organisation an.
Die Betriebe und die Bevölkerung wurden fortlaufend mit Flugblättern und Zeitschriften angesprochen. Morgens um 5 Uhr waren die Genossen oft schon auf den Beinen um zu agitieren und zu werben. Zur Durchführung ihrer Arbeiten hatte sich die Parteieinheiten einen ausreichenden Bestand an Maschinen zugelegt. Unser Stadtteil verfügte über mehrere Garnituren Schreibmaschinen und Vervielfältigungsapparate, die an Geheimstellen untergebracht waren, um sie bei einer evtl. Illegalität vor dem Zugriff der Polizei zu sichern.
Aber nicht nur technisch waren die unteren Parteieinheiten von der vorgesetzten Stelle unabhängig, sondern auch agitatorisch und propagandistisch. Die Texte der verbreiteten Flugblätter und Werbe - resp. Betriebszeitschriften wurden von den Genossen der betreffenden Einheiten selbst verfasst. Es bestand lediglich die Verpflichtung, 3 Exemplare der BL zur Information vorzulegen.
Wir gaben eine Menge Flugblätter und Zeitschriften heraus, nach der die Bürger und die Betriebsarbeiter unseres Stadtteils griffen, denn unsere Sprache war offen und herzlich, und was wir schrieben, kam an. Alteingefleischten Funktionären von der Art meines Vorgängers kam unsere Propaganda oft nicht geheuer vor.
Sie studierten jede Veröffentlichung und legten sie der BL vor in der Hoffnung, dass man uns abkanzeln und zur Rechenschaft ziehen würde. Doch ich habe nie eine abfällige Bemerkung der vorgesetzten Leitung gehört.
Dagegen blieben mir die innerparteilichen Störversuche gegen unsere Arbeit nicht verborgen, die von der BL damit abgetan wurden, indem sie erklärte: Die Stadtteilleitung arbeitet ideologisch.
Der Erfolg unserer Arbeit blieb nicht aus. Sie fand ihren Niederschlag in den Wählergebnissen und der fortlaufenden Steigerung unserer Mitgliederzahlen. Eine besonders starke Ausweitung unseres Einflusses aber setzte mit der Propaganda für die „Antifaschistische Aktion“ ein, zu der wir alle demokratischen Kräfte unseres Stadtteils aufriefen.





























