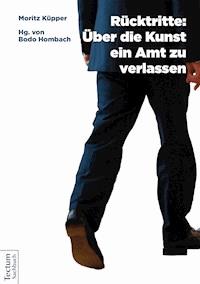
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Rücktritt von einem Amt ist keine leichte Sache. Zwar heißt es "Man soll die Dinge verlassen, bevor sie uns verlassen", doch zeigt sich, dass es oftmals schwer ist, diese Regel zu befolgen. Mancher Rücktritt wird von außen regelrecht erzwungen. Oft reagiert die Öffentlichkeit zudem anders als erwartet. Im schlimmsten Falle wird das Ansehen der Person dauerhaft beschädigt. Doch es gibt auch positive Beispiele. So gilt der freiwillige Rücktritt Hans-Dietrich Genschers auf dem Zenit seiner Karriere vielen als gelungener Abschied aus der Politik. Der Journalist Moritz Küpper hat mit Prominenten gesprochen, die selbst die Erfahrung eines Rücktritts gemacht haben. Zu Wort kommen: Kurt Beck, Bodo Hombach, Klaus Kinkel, Roland Koch, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Christian Lindner, Hartmut Mehdorn, Matthias Platzeck, Marcel Reif, Rudolf Scharping, Marina Weisband u.a.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Moritz Küpper
Rücktritte
Moritz Küpper
Rücktritte:
Über die Kunst ein Amt zu verlassen
Hg. von Bodo Hombach
Tectum
Moritz Küpper
Rücktritte: Über die Kunst, ein Amt zu verlassen
Herausgegeben von Bodo HombachMit einem Vorwort von Bodo Hombach und einem Beitrag von Volker Kronenberg
© Tectum – ein Verlag der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2017
ISBN 978-3-8288-6682-9
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter
der ISBN 978-3-8288-3846-8 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: Moritz Kappeler | © dpa; Fotografie Moritz Küpper – Gustav Kuhweide | FOTO-KUHWEIDE.DE
Lektorat: Volker Manz
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
INHALT
Vorwort
Prof. Bodo Hombach
GRUNDLAGEN UND HINTERGRÜNDE
Das große Schweigen: Warum das Thema Rücktritt tabuisiert wird – und doch auf die Tagesordnung gehört
Rücktritt, Abgang, Rückzug, Karriereende: Begriff und Wissensstand
»Damit beschäftigt man sich nicht so gerne«: Über die psychologische Seite des Abtritts
Aufsteigen ist einfacher als aufhören: Statistiken über (politische) Rücktritte in Deutschland
Verblasster Zauber? Macht, Moral und Allzumenschliches – Abschiede von Ämtern vor der Zeit
Prof. Dr. Volker Kronenberg
RÜCKTRITTE IN DER PRAXIS
Fallbeispiele aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft
Erkenntnis: Wie merke ich, dass Schluss ist?
Ausbleibender Rücktritt: »Nicht aufgeben, weitermachen!«
Umsetzung: Wie trete ich zurück?
Handeln: Schnell und konsequent
Organisation: Umfassend und distanziert
Timing: Überlegt, aber unverzüglich
Begründung: Plausibel und überzeugend
Informationsmanagement: Von innen nach außen
Rücktrittserklärung: Stilvoll und prägend
Nachfolgesuche: Verantwortung und (abzuwendendes) Vakuum
Rückzug: Still und glaubwürdig
»Ein epochales Ereignis«: Die Bedeutung des Rücktritts von Papst Benedikt XVI. für Kirche und Gesellschaft
Bedeutung: Der Platz in den Geschichtsbüchern
Nach dem Rücktritt ist vor dem Comeback: Über die Umstände der Rückkehr
Die Umsetzung des Rücktritts im Überblick
PERSPEKTIVEN
Diskussion: Amtszeitbeschränkungen – hilfreiches oder einengendes Konstrukt?
Schlussbetrachtung: Haltung statt Handlungsanweisungen
ANHANG
Literatur
Personenregister
Herausgeber und Autoren
Dank
»Nicht abwarten, dass man eine untergehende Sonne sei: Es ist eine Regel der Klugen, die Dinge zu verlassen, ehe sie uns verlassen. Man wisse, aus seinem Ende selbst sich einen Triumph zu bereiten.«
Balthasar Gracián
(philosophischer Schriftsteller Spaniens, der von 1601 bis 1658 lebte)
VORWORT
von Herausgeber Prof. Bodo Hombach
Sigmar Gabriel verließ im März 2017 die Kommandobrücke in klarer Einschätzung der Situation von Partei, Person und historischer Notwendigkeit: ein beispielgebender Fall demokratischer Rücktrittskultur.
Einen ähnlichen Coup landete Benedikt XVI. Er tat, was in 2000-jähriger Kirchengeschichte bis dahin erst einer getan hatte (Coelestin V. im Jahr 1294). Entsprechend aufgeregt und gegensätzlich waren die Reaktionen. Die einen erklärten seinen Schritt als folgerichtig und sachgerecht. Die anderen verwiesen auf den Weihecharakter des Amtes und behaupteten ein unauflösliches Band zwischen Funktion und Person.
Im größten Teil der Geschichte und der Welt wurde und wird die Macht charismatisch verstanden. Sie wurde vererbt oder durch »Handauflegung« übertragen. »Es steht geschrieben«, war die Antwort auf jede Frage nach der Legitimation. Die deutschen Könige wurden zwar durch die Kurfürsten gewählt, dann aber gesalbt und mit den Reichsinsignien versehen. Die Reichskrone zeigt Bilder der biblischen Könige David und Salomon als idealisierte Herrschergestalten. Wen wundert es: Nach ihrer Krönung in Aachen begaben sich die Karls, Heinriche und Ludwige als Erstes nach Köln, um sich am Schrein der Heiligen Drei Könige eine hohe Dosis ihres Gottesgnadentums zu besorgen. Und so, wie sie ihr Amt verstanden, setzte es sich bis in die kleinste Amtsstube fort. Wer es bis dorthin geschafft hatte, hatte es geschafft. Er residierte »im Nebel seiner Wichtigkeit« (Joseph Sonnenfels) und betrachtete die Bittsteller als sehr viel sterblicher als sich selbst. – Entsprechend konvulsivisch waren die Zuckungen einer Gesellschaft oder eines Staates, wenn der Inhaber des Thrones vor der Zeit abdankte oder abgedankt wurde. Dazu bedurfte es zumeist einer Revolution und eines Schafotts oder eines Krieges. Es kam die Bürger teuer zu stehen und bedeutete lange Zeiten der Unruhe.
Aber dann kam in Westeuropa die Aufklärung. Man begann, die Dinge im Licht der Vernunft zu betrachten und definierte den Staat als einen Gesellschaftsvertrag zum Wohle aller. Noch war es sensationell, wenn der Müller von Sanssouci gegen die Willkür Friedrichs II. an das Reichskammergericht in Berlin appellierte, und es ging nicht ohne eine Revolution, in der viele Köpfe rollten. Der moderne republikanische Staat war geboren. Er funktionierte auf der Basis vernünftiger Gesetze, hielt die Macht durch Teilung in Schach und erfand den Bürgerstolz.
Die Demokratie hatte ein modernes und gänzlich anderes Amtsverständnis. Man ist dessen Verwalter und nicht Besitzer. Der Rücktritt eines Amtsträgers ist weder ungewöhnlich, noch dramatisch. Wie lange und mühsam er darum gekämpft und den Augenblick des Triumphes genossen hat, es ist alles auf Widerruf. Schon bald kann etwas geschehen, was ihn zum Rücktritt zwingt. Er muss nicht persönlich schuldig sein. Es genügt ein schwerer Fehler von Mitarbeitern seines Verantwortungsbereiches. Der Respekt vor dem Amt sollte ihn veranlassen, die Konsequenzen zu ziehen. Es ist eine Frage der Hygiene. So betrachtet ist ein Rücktritt kein Zeichen der Schwäche, weder des Systems, noch des Betroffenen, sondern ein Zeichen für beider Stärke. Im Umkehrschluss kann ein fälliger, aber beharrlich verweigerter Rücktritt das Amt beschädigen und letztlich auch seinen Träger. In der Skandalchronik fehlt es nicht an Beispielen. Mancher kann seinen Hut nicht nehmen, weil er an dem Sessel klebt, auf dem er sitzt. Argumente beeindrucken ihn nicht. In Schillers »Wallenstein« sagt Oberst Butler: »Ich hab ein Amt und keine Meinung.«
Andererseits können gehäufte Rücktritte auch Sorgen machen, dann nämlich, wenn eine »wölfische« Gesellschaft, angeheizt durch demagogische Kräfte, den starken und kompetenten Träger eines Amtes in die Erschöpfung treibt. Verantwortungslose Medien und die Hetzkampagnen des Internets bieten dazu ein ganzes Arsenal von Möglichkeiten. Das richtet nicht nur akuten Schaden an, es kann auch bewirken, dass niemand mehr bereit ist, sich für ein Amt zur Verfügung zu stellen (»Warum sollte ich mir das antun?«). Wie in jedem Betrieb ist auch die innere Kündigung des Bürgers der Super-GAU. Der nächste Schritt ist passive Sabotage. Man lässt etwas vor die Wand laufen, obwohl man es retten könnte. In der Politik bleibt ein Vakuum nicht leer. Wo die Guten weichen, füllt es sich mit den Schlechten, mit Machtjunkies, Emporkömmlingen und Glücksrittern. Der Weg eines solchen Gemeinwesens führt vor die Wand.
Diese sehr spontanen und thesenhaften Überlegungen machen bewusst: Der Rücktritt in der Demokratie ist nicht nur ein spezielles Ereignis. Er ist auch ein Thema. Er fordert heraus. Er polarisiert. Er kann dazu beitragen, erodierte Tugenden und Kriterien wieder freizulegen. Ein besonnener Diskurs kann helfen, drohende Gefahren zu erkennen und vorbeugend tätig zu werden.
Dazu liefert das vorliegende Buch eine Fülle von Material. Es referiert die spektakulären Rücktritte der neueren Geschichte, sondiert aber auch die dahinterliegenden Strukturen. Allen Autoren und Organisatoren dieses Werkes ist zu danken.
GRUNDLAGEN UND HINTERGRÜNDE
»Nein, nie. Warum sollte ich?«
Lewis Hamilton
(der Formel-1-Rennfahrer zu Beginn der Saison im April 2016 auf die Frage, ob er schon mal an sein Karriereende gedacht habe; am Ende derselben Saison trat sein Konkurrent und Teamkollege Nico Rosberg als Weltmeister überraschend ab)
DAS GROßE SCHWEIGEN
Warum das Thema Rücktritt tabuisiert wird – und doch auf die Tagesordnung gehört
Dagmar Reim sammelt Todesanzeigen. Es ist ein Hobby, das die erste Intendantin einer ARD-Anstalt und langjährige Chefin des Rundfunks Berlin Brandenburg (rbb) durch ihre gesamte journalistische Karriere begleitet hat. Egal, ob lustige, skurrile oder auch traurige: Unzählige solcher Anzeigen hat Reim mittlerweile archiviert. »Der Lebensabschied ist dem Rücktritt ähnlich«, erzählt Reim, die sich 2016 nach über zehn Jahren an der Spitze des rbb freiwillig zurückzog. »Das Interessante ist, dass man die verschiedenen Typen erkennen kann.« So gebe es beispielsweise Autoanzeigen. Das sind Selbstanzeigen, die von den Verstorbenen selbst verfasst sind und nach ihrem Ableben erscheinen. »Solche Menschen wollen bis zum bitteren Ende die Kontrolle behalten«, hat Reim festgestellt, »bei anderen merkt man, was den Hinterbliebenen im Gedächtnis geblieben ist, und was ihnen wichtig ist.« Eine Todesanzeige zeigt also, was für ein Mensch, die oder der Verstorbene war oder sein wollte – und prägen damit ein Stück weit auch das Bild. Genauso wie ein Ab- oder Rücktritt – egal aus welchem Amt.
Wer mit Menschen in herausragenden öffentlichen Ämtern aus Politik, Wirtschaft, Medien oder anderen gesellschaftlichen Bereichen über Rücktritte, egal ob selbstmotiviert oder erzwungen, oder das endgültige Karriereende sprechen will, bekommt vor allem eins: Absagen. Natürlich, der Terminkalender ist immer eng, ein Zeitfenster schwer zu finden. Eine Begründung wird selten mitgeliefert. Er wolle noch ein paar Jahre im Fußballgeschäft bleiben, sagte ein ehemaliger, durchaus erfolgreicher Bundestrainer am Telefon, deswegen könne er derzeit über seinen Abschied nicht reden. Und weiter: Dafür habe man doch sicherlich Verständnis. Auch zahlreiche weitere Politiker, parteiübergreifend, egal ob Frau oder Mann und unabhängig davon, ob noch in Amt und Würden oder mittlerweile im Ruhestand, sagten ab. Genauso wie Wirtschaftsbosse, Entertainer oder Personen aus der Kirchenhierarchie. Knapp 50 Anfragen sind für dieses Projekt gestellt worden, und immerhin: 15 Interviewpartner haben – teilweise freilich erst nach mehreren Überzeugungsgesprächen – zugesagt, mitzumachen. Mitunter, um dann später, nach dem Gespräch, ihre Zusage an dem Projekt zurückzuziehen. Und letztendlich ließ sich ein solches Projekt nur so realisieren: Alle Gesprächspartner bekamen die Zusage, jederzeit wieder auszusteigen und waren teilweise nur so bereit, sich zu öffnen.
Doch diese persönliche Sicht einmal darzustellen, Einblicke in Gedankengänge rund um die Rücktrittsentscheidung zu bekommen, war die Grundidee des vorliegenden Buches. Dabei ging es weniger darum, die einzelnen Rücktrittsgründe zu bewerten, sondern vielmehr darum, die dann anstehenden Schritte zu identifizieren und darzustellen, aber auch die möglichen Folgen zu skizzieren. Letztendlich gibt dieser natürliche Entscheidungsprozess somit auch die (Buch-)Struktur vor: Neben einem allgemeinen Aufriss des Themas, einer historischen Einordnung und einem (statistischen) Überblick in den ersten Kapiteln, folgt anhand zahlreicher Beispiele eine ausführliche Darstellung der Rücktrittsprozesse in der Praxis. Und zwar nach dem Dreiklang: Entscheidung, Umsetzung und Folgen. Die Aussichten auf ein Comeback sowie eine grundsätzliche Schlussbetrachtung schließen eine Darstellung ab, die auf ein hochrelevantes gesellschaftliches Thema aufmerksam machen soll.
Denn: Eine Debatte darüber ist überfällig, meint auch Reim. Ihr genereller Eindruck: »Ich denke, dass wir als Gesellschaft das Ausscheiden und Abtreten tabuisieren. Ich habe es zumindest selten als Gesprächsthema erlebt.« Eine Erkenntnis, die von vielen Befragten geteilt wird: »Es findet eher punktuell statt, wenn der Verdacht einer Verfehlung bei Menschen des öffentlichen Lebens besteht«, meint Rudolf Seiters, der als Bundesinnenminister überraschend seinen Rücktritt einreichte, nachdem bei einem missglückten Polizeieinsatz der gesuchte RAF-Terrorist Wolfgang Grams und ein GSG-9-Beamter ums Leben gekommen waren. Letztendlich, das fällt auf, läuft es in Gesprächen über die Gründe für einen Rücktritt immer wieder auf drei Punkte hinaus:
Man will sich nicht damit beschäftigen, …
… weil sich diese Frage zu Beginn einer Amtszeit gar nicht stelle. Die ehemalige Bundesjustizministerin und FDP-Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger meint: »Wer ein solch herausgehobenes Amt übertragen bekommt, der beschäftigt sich nicht damit, dass in vier Jahren wieder Wahlen sind oder dass man das Amt verlieren könnte.« Es sei beispielsweise für einen Berufspolitiker das Höchste, einmal Minister zu werden: »Die Grundhaltung lautet dann, dass man das durchhalten und -stehen muss.« Schließlich habe man ja auch viel dafür getan: »An einen Rücktritt außerhalb des turnusgemäßen Wahlwechsels wird nicht gedacht«, so Leutheusser-Schnarrenbergers Einschätzung, »bei vielen ist der Rücktritt damit auch nicht wirklich eine Alternative.« Zumal die Zeit knapp ist: Man wolle ja in seiner Funktion viel bewegen, Dinge anstoßen. Und Zweifel? »Wie kommst du denn auf die Idee?«, heißt es dann oft, weiß auch die ehemalige rbb-Intendantin Reim. Es sei strukturell so, dass sich Personen in herausgehobenen öffentlichen Ämtern überproportional über diese Ämter definieren würden. Das Ergebnis: »Diese Art der Überidentifikation führt im schlimmsten Fall dazu, dass man sich für unersetzlich hält«, so Reim, »und damit den eigenen Abgang für unvorstellbar.«
Man darf sich nicht damit beschäftigen, …
… zumindest nicht öffentlich, weil es »zu persönlich und zu gefährlich« ist, weiß Ex-Ministerin Leutheusser-Schnarrenberger. Der Grund: Es habe schlichtweg große Auswirkungen, denn »wenn auch nur unüberlegt in einem Hintergrundgespräch mit einem Journalisten ein Halbsatz fällt, dann ist es ein Desaster«, so Leutheusser-Schnarrenberger, »dann hat man eine Entscheidung nicht mehr in der Hand.« Gerade bei einem überraschenden, selbstbestimmten Rücktritt gehe das nicht. Sie selbst habe ihren eigenen Rücktritt daher nur in der Familie und im engsten Freundeskreis besprochen, selbst »mein Parteivorsitzender oder Generalsekretär waren keine Vertraute«. Eine Haltung, die sich bei vielen öffentlichen Personen findet: »Außer meiner Frau wusste das selbstverständlich niemand, weil es in diesen Beziehungen keine Vertraulichkeit gibt«, sagt auch der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch, der im Mai 2010 öffentlich (und auch überraschend) bekannt gab, sich zurückzuziehen. »Da gibt es die alte Theorie: Dein bester Freund hat einen besten Freund.« Dabei sei das Thema Vertraulichkeit nicht nur ein wichtiger Punkt unter Politikern: »Das gilt auch für einen Fußballspieler«, so Koch. »Wenn der wechseln will, redet der auch nicht mit den Mitspielern oder seinem Trainer darüber.« Generell, so hat es zumindest die ehemalige Intendantin Reim beobachtet, »rät einem die Klugheit, solche Gedanken nicht auf dem offenen Markt zur Schau zu stellen, weil man in diesem Moment zur ‚lame duck‘ wird.« Gerade bei Personen, die in großen Institutionen Verantwortung trügen, würde ein lautes Nachdenken über diese Frage zu Recht als Unentschlossenheit ausgelegt werden. Daher sei es gut, wenn solche zeitfordernden Entscheidungsprozesse nicht öffentlich werden: »Nach meinem Verständnis muss alles fertig sein, und dann muss es auch über die Bühne gehen.« Auch Matthias Platzeck, der einst aus gesundheitlichen Gründen als SPD-Parteivorsitzender und Jahre später, ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen, als Ministerpräsident von Brandenburg abtrat, hat zwar bei diesen Schritten keine schlechten Erfahrungen gemacht, sagt aber: »Ich verhehle nicht, dass Schwäche zu zeigen nicht unbedingt in jeder Situation hilfreich ist.« Zwar werde es weniger vordergründig politisch ausgenutzt, so seine Erfahrung, »aber Sie haben das Getuschel, Sie haben das Hinterzimmer, die Vermutungen und Unterstellungen. Und das hilft im Alltag einfach nicht gerade viel.«
Man sollte sich nicht damit beschäftigen, …
… weil es innerlich Kräfte binde. »Ich würde nicht dazu raten, es zu tun«, sagt jedenfalls der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner. Als Generalsekretär seiner Partei trat er im Dezember 2011 aufgrund inhaltlicher Differenzen aus freien Stücken zurück, um dann – nach dem erstmalig verpassten Einzug seiner Partei in den Deutschen Bundestag – das Comeback der FDP zu organisieren. Seine Haltung: »Ich befinde mich von innen und von außen in einem Wettbewerb, indem ich mich mental nicht dadurch schwächen darf, dass ich fortwährend über Niederlagen und das Ende nachdenke«, so Lindner. Und das schließe eben einen Rücktritt oder in seinem Fall das Scheitern mit ein: »Welcher Fußballtrainer sagt seiner Mannschaft, dass sie ja im Viertelfinale auch ausscheiden könnte? Das wird dann schnell zu einer ‚self-fulfilling prophecy‘. Man muss die Mannschaft ja aufbauen.« Gerade in einer Lebensphase, in der er weiterhin um politische Inhalte und Mehrheiten kämpft, ist Lindner überzeugt, wäre das sehr kontraproduktiv. Und auch Ex-Ministerpräsident Koch stimmt zu: Er habe für sich einst erkannt, dass er – einen Wahlerfolg vorausgesetzt – in der kommenden Legislaturperiode über einen Rücktritt nachdenken werde. Aber: »Nicht verbindlich und abschließend«, so Koch, »das darf man innerlich nicht, weil man dann anders wird, in dem Amt aber die Spannung nicht verlieren darf.«
Dabei ist klar: Man muss sich damit beschäftigen, …
… weil die Frage schlichtweg in jeder Konstellation und in jedem Amt auftreten kann. »So ist es«, so Reim. Sie selbst sei immer wieder überrascht, wie unvorbereitet mitunter einzelne Personen in herausragenden Ämtern seien. »Darauf habe ich keine wirkliche Antwort, außer dass Weihnachten immer so überraschend kommt«, merkt sie ironisch an. Doch, so die Meinung vieler, es tut sich was. Marcel Reif, jahrzehntelang Fußballkommentator bei öffentlich-rechtlichen sowie privaten TV-Sendern und selbst eine Figur des öffentlichen Interesses, glaubt zu erkennen, dass sich sogar das schnelllebige, wenig einfühlsame Fußballgeschäft verändert habe: »Es gibt ja diese sogenannte ‚Lame Duck‘-Diskussion«, so Reif, »aber ich glaube, dass das in einem mittlerweile so hochprofessionalisierten Umfeld wie dem Fußball nicht mehr so dramatisch ist wie früher.«
Innerhalb der Politik wird in Netzwerken, in denen man sich gut kennt, mittlerweile doch über die Möglichkeit eines Rücktritts gesprochen. Zumindest der einstige hessische Ministerpräsident Koch bestätigt, sich mit ebenfalls zurückgetretenen führenden CDU-Politikern ausgetauscht zu haben: »Natürlich reden wir miteinander«, so Koch, der in einer Generation von CDU-Politikern wie Christian Wulff, Ole von Beust, Peter Müller oder auch Roland Pofalla, die sich alle gut kennen, als Vorreiter galt: »Ich bin als Erster ins Amt gekommen und als Erster auch wieder gegangen.« Zwar habe man nicht darüber geredet, bevor die Entscheidungen konkret waren, das sei von keiner Seite aus gewünscht gewesen, aber »wenn es auf dem Weg war, dann kam es schon zu Gesprächen«. Ihn hätten einstige Mitstreiter gefragt, wie er das gemacht, welche Überlegungen er davor angestellt habe, welche Risiken es gebe: »Ich denke, das ist ein positiver Trend in der CDU-Führungsriege gewesen«, sagt Koch heute. So seien viele berufliche Wechsel in die Wirtschaft ermöglicht und der Gesellschaft damit ein Dienst erwiesen worden. Aber: »Sich selbst auch. Denn das macht man nicht aus Altruismus.« Solche Gespräche, solchen Austausch würde sich auch der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident und SPD-Bundesvorsitzende Kurt Beck wünschen: »Es wäre spannend, sich in Gesprächen, Diskussionen und Betrachtungen damit auseinanderzusetzen, wie so ein Prozess gereift ist«, so Beck, »um eben Menschen darauf vorzubereiten und Tipps zu geben, dass alles ein Ende hat und nur die Wurst halt zwei.« Auch die einstige rbb-Intendantin Reim hält eine offene Diskussion für notwendig – und unterstreicht dies mit einer kleinen Anekdote um den einstigen Medienmogul Joseph von Ferenczy. Dieser wurde kurz vor seinem 80. Geburtstag von einem Reporter gefragt, ob er bald aufhöre. Nein, ich höre nie auf, erwiderte er, und wenn ich einmal sterben sollte, kann man mir Telefon- und Faxleitung auf den Friedhof legen. Für Reim steht fest: »Aufhören ist nicht trivial.« Und daher ein lohnendes Thema.
»Rücktritt, der. Substantiv, maskulin – das Zurücktreten, Niederlegen eines Amtes (besonders von Mitgliedern einer Regierung).«
(Definition des Begriffs »Rücktritt« laut Duden)
RÜCKTRITT, ABGANG, RÜCKZUG, KARRIEREENDE
Begriff und Wissensstand
Die Zahl der Synonyme ist groß: »Abdankung, Amtsabtretung, Amtsaufgabe, Amtsniederlegung, Amtsverzicht«, listet der Duden auf. Und weiter: »Ausscheiden, Austritt, Demission, Kündigung; (veraltet) Abdikation, Abschied.« Doch die Bedeutung ist stets gleich: Schluss, würde man umgangssprachlich sagen. Ende. Auch im bürgerlichen Recht ist die Sache relativ klar geregelt: Der Rücktritt ermöglicht einer Person, Rechtsfolgen rückgängig zu machen, zum Beispiel Verpflichtungen aus einem Vertrag. Zu welchen Bedingungen dies geschehen kann, wird ebenso genau benannt. Und im praktischen Leben, erst recht bei öffentlichen Ämtern wie in der Politik? Da sieht es mitunter anders aus. Die Konsequenz ist zwar ähnlich, doch der Weg dahin, die Umstände und Zusammenhänge sowie die Gründe und die Art des Abgangs sind oft unterschiedlich – und gerade daher interessant: »In den Debatten und Kommentaren über Rücktritte findet eine Verständigung über Normen und Werte statt«, schreibt beispielsweise Michael Philipp, Autor des wohl umfangreichsten deutschsprachigen Buches (»Persönlich habe ich mir nichts vorzuwerfen. Politische Rücktritte in Deutschland von 1950 bis heute«) zu einem bislang wenig erforschten Thema. Und weiter: »Deshalb sind sie ein Indikator über den Zustand der Moral und des Miteinanders in Politik und Gesellschaft.« Für sein Werk hat Philipp 250 unterschiedlichste Rücktrittsfälle analysiert und dabei eine Typologie der Rücktrittsgründe entwickelt:
Rücktrittsgrund
Szenarien
Biografische Entwicklung
Wechsel in ein anderes Amt / eine andere Funktion aufgrund eines Angebots; Amtsmüdigkeit; Altersgründe
Politische Entwicklung
Verlorene Unterstützung durch die Partei; Konflikte mit dem Regierungschef oder mit der Fraktion; gewandelte inhaltliche Konzepte; Auseinandersetzung in einer Koalition
Protest
Amtsniederlegung als symbolische Geste gegen die Verfahrenheit einer Situation, die Bedrohlichkeit einer Entwicklung oder die Unzumutbarkeit einer Entscheidung
Verantwortung
Bekenntnis zur politischen Verantwortung ohne persönliches Fehlverhalten; externer Zwang zur Übernahme von politischer Verantwortung durch Medien, Opposition oder die eigene Partei; Bekenntnis des Regierungschefs zur politischen Verantwortung mit Konsequenzen für den Minister
Politisches Vorleben
Verfehlungen im vorpolitischen Leben (auch im NS-Staat und der DDR)
Persönliche Verfehlung
Privates Verschulden; Fehlverhalten; Entgleisungen oder Dummheiten, die einen gravierenden Verstoß gegen Sitte und Anstand darstellen und somit die Eignung der Person für ein politisches Amt infrage stellen
Politische Verfehlung
Verstoß gegen Grundsätze oder Vorschriften einer ordentlichen Geschäftsführung, entweder durch Untätigkeit oder falsche Handlungen
Geldgeschichten
Annahme von Gefälligkeiten und Vergünstigungen; Einkommenszuwächse durch gesetzliche Regelungen, deren Legitimität nicht zweifelsfrei ist; Nebeneinkünfte
Tab. 1: Typologie der Rücktrittsgründe nach Michael Philipp
Zudem beschäftigt Philipp sich mit dem »Rücktritt als Waffe«, also mit Forderungen nach oder der Drohung mit einem Rücktritt sowie mit verweigerten Demissionen und Entlassungen. Sein grundsätzliches Fazit ist ein Plädoyer für eine neue Kultur der politischen Beziehungen: »Rücktritte hätten dann nicht mehr den sensationellen Ausnahmecharakter. Sie würden zu einem akzeptierten Reaktionsmuster, wären eine reguläre Handlungsoption. Diese könnte so selbstverständlich wie respektiert sein. Die Kultur des Rücktritts würde dem einzelnen Politiker nutzen, aber sie würde auch der politischen Kultur im Allgemeinen dienen.«
Auch Frank Überall, mittlerweile Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Journalisten-Verband (DJV), und der langjährige NRW-Korrespondent der tageszeitung (taz) Pascal Beucker haben sich in ihrem Buch »Endstation Rücktritt. Warum deutsche Politiker einpacken« mit der Schlussphase im Amt beschäftigt. Ihre Haupterkenntnis: Fällt die Rückendeckung der Parteifreunde, so ist der Abgang meist unumgänglich. Zu weiten Teilen eine »Affären-Chronik« zu sein, attestiert der Politikwissenschaftler Jörn Fischer von der Universität zu Köln, der sich selbst mit dem Thema beschäftigt hat, dagegen diesem Werk. Fischers eigener Forschungsschwerpunkt liegt auf erzwungenen Rücktritten, sogenannten Push-Rücktritten. Er hat sich zudem in seiner Diplomarbeit (»Ministerrücktritte in der Bundesrepublik Deutschland 1983 bis 2002. Eine quantitative Analyse«) sowie seiner Dissertation (»Deutsche Bundesminister: Wege ins Amt und wieder hinaus. Selektions- und Deselektionsmechanismen im Bundeskabinett unter besonderer Berücksichtigung von Push-Rücktritten«) des Themas angenommen – und kommt zu dem Schluss: »Je größer der Bezug einer Rücktrittsdiskussion zur Ministerverantwortlichkeit, desto geringer ist die empirische Rücktrittswahrscheinlichkeit. Vielmehr sind es politische Kosten-Nutzen-Kalküle der den Minister politisch tragenden Akteure, die zu einem Rücktritt führen. Verspricht der Amtsverzicht einen höheren Nutzen für die Partei des Ministers bzw. für den Bundeskanzler als der Verbleib im Status Quo, so ist das Schicksal des Ministers in aller Regel besiegelt. Entscheidender Faktor in dieser Kosten-Nutzen-Rechnung ist dabei die Haltung der Wählerschaft als ‚ultimativer‘ Prinzipal.«
Eine Art Streitschrift hat dagegen Regina Maria Jankowitsch verfasst, die als Politikcoach in Österreich arbeitet. »Tretet zurück! Das Ende der Aussitzer und Sesselkleber« ist ein Plädoyer für einen raschen, selbstbestimmten Rücktritt: »Nicht selten endet eine Politikerkarriere unrühmlich. Viel zu lange haben zu diesem Zeitpunkt die Öffentlichkeit, die Opposition und im schlimmsten Fall die eigenen Parteikollegen schon den Rücktritt gefordert«, heißt es da. Es gelte, so Jankowitsch, die somit ähnlich wie Philipp argumentiert, »unsere Rücktrittskultur nachhaltig zu verbessern«. Dieses Ziel im Blick, hat sie mit sechs (vor allem österreichischen) Politikerinnen und Politikern gesprochen und dabei auch eine Anleitung zum »professionellen Rücktritt« verfasst. Dazu gehören – so Jankowitschs Erkenntnis – Freiwilligkeit, Rechtzeitigkeit, Kommunikation. Letztendlich ist so eine interessante Bestandsaufnahme mit Einblicken von einigen Betroffenen entstanden. Doch eine Aufarbeitung, gerade auch aus deutscher Sicht, steht noch aus – und soll daher nun folgen.
»Ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod, und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben.«
Cesare Borgia





























