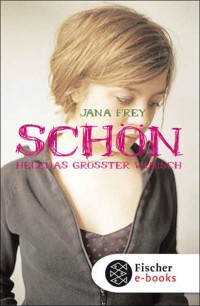Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Lilli ist gerade 14 Jahre alt, als sie schwanger wird. Alle wollen für sie entscheiden. Alle wissen, was gut für sie ist – eine Abtreibung. Doch Lilli ist sich nicht so sicher. Am liebsten möchte sie für immer in ihrem Zimmer bleiben. Was für ein eigenartiger Gedanke, ein Baby im Bauch zu haben. Davids und ihr Baby. David mit dem schönen Lächeln. Lilli horcht in sich hinein und versucht, die richtige Entscheidung zu treffen. Schwangere Mädchen müssen mit vielen Ängsten kämpfen und plötzlich eine ungeheuer große Verantwortung übernehmen – wie auch Lilli. Jana Frey erzählt die Geschichte eines Mädchens, das sich gegen alle Widerstände für das Baby entscheidet. Zusammen mit ihren Freunden muss sie mit einer ungewollten Schwangerschaft fertig werden und trotzdem ihre Lebensfreude bewahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Epilog
Adressen
Für Lilli und Camillo
PROLOG
Lilli setzte sich mir gegenüber und schaute mich direkt an. Dann erzählte sie mir mit leiser Stimme ihre Geschichte.
Und Davids Geschichte.
Und Camillos Geschichte.
Wie alles anfing. Und wie alles durcheinander und außer Kontrolle geriet.
Und wie es heute ist.
1
Wir waren die kleinste Familie der Welt, denn es gab nur meine Mutter und mich.
Meine Freundin Annalena hat eine Mutter und einen Vater und einen Stiefvater und eine Schwester und eine Halbschwester und einen kleinen Neffen. Außerdem hat sie zwei Großmütter und eine Stiefoma und einen Stiefopa. Und die Stiefoma hat selbst noch ihre Mutter, die damit sozusagen Annalenas Stiefuroma ist. Annalena besucht sie fast jede Woche für einen Nachmittag und spielt mit ihr Nintendo oder diskutiert mit ihr über das Leben und solche Sachen.
Meine Freundin Viktoria hat auch eine Mutter und einen Stiefvater und drei kleine Halbgeschwister, und ihr leiblicher Vater lebt in Paris und ist dort auch wieder verheiratet und hat zwei kleine Zwillingssöhne, die Viktorias Halbbrüder sind und die sie in den Ferien besucht. Außerdem hat sie eine Großmutter, die mit ihr im selben Haus wohnt, und einen französischen Großvater, der bei ihrem Vater in Paris wohnt.
Und dann gab es da eben mich und meine Mutter.
Einmal, vor zwei Jahren, in der siebten Klasse, bekamen wir in Gemeinschaftskunde als Hausaufgabe auf, unsere Wurzeln zu suchen. Wir sollten unsere Familie beschreiben und einen Familienstammbaum erstellen.
„Toll, in meinem Fall eine schnelle Hausaufgabe“, sagte ich achselzuckend zu Annalena. „Ich schreibe meinen Namen und den Namen meiner Mutter hin und – voilà – mein Familienstammbaum ist komplett!“
Nachdenklich starrte ich aus dem Fenster. Draußen war Winter, kalter, nasser, trostloser Februarwinter. Weihnachten war vorbei, Silvester war vorbei, die Weihnachtsferien waren vorbei. Und ich fühlte mich auf einmal merkwürdig traurig.
Diese Vater-Gefühle, die kannte ich natürlich schon lange. Diese Wo-ist-er?-Was-macht-er?-Denkt-er-manchmal-an-mich?-Warum-meldet-er-sich-nie-bei-mir?-Gefühle. Aber zum ersten Mal vermisste ich auch eine Drumherumfamilie. Die Eltern meiner Mutter. Die Eltern meines fremden Vaters. Meine Mutter hatte keine Geschwister. Hatte mein Vater welche?
Dass meine Mutter überhaupt existierte, war nur ein Zufall, ein kleiner, geheim gehaltener Skandal, eine verstrickte Angelegenheit. Ihr Vater war ein katholischer Priester gewesen. Und ihre Mutter stammte aus Polen und hatte jahrelang als Haushälterin im katholischen Pfarrhaus gearbeitet. Und erst als sie schon über vierzig war, wurde sie schwanger und bekam meine Mutter. Der Vater meiner Mutter war sogar schon über fünfzig, und er stand nie zu diesem Kind, das er nicht hätte zeugen dürfen. Er blieb in seiner Kirche und vertuschte die Sache, so gut es ging, indem er meine Großmutter, schwanger wie sie war, zurück nach Polen schickte. Dort wuchs meine Mutter auf und kam erst nach Deutschland, als sie die Schule beendet hatte und ihren Vater kennenlernen wollte. Aber der war in der Zwischenzeit längst gestorben. Trotzdem blieb meine Mutter hier. Und als sie gerade mit mir schwanger war, starb ihre Mutter in Polen.
„Was weißt du überhaupt von deinem Vater?“, fragte mich Annalena an diesem Februarnachmittag.
Ich zuckte mit den Schultern.
„So gut wie nichts“, sagte ich schließlich leise.
„So gut wie nichts heißt, dass du doch etwas weißt“, sagte Annalena und legte ihren Arm um meine Schulter. Ich starrte weiter aus dem Fenster in den grau verhangenen Winterhimmel. Das Haus, in dem ich damals wohnte, war ein relativ einsam stehendes Hochhaus und man fühlte sich von meinem Zimmer aus fast wie im Himmel. Gerade schoss eine große Formation kreischender Vögel über den Himmel, ganz in unserer Nähe. Schön sah das aus, schön wild und ein bisschen unheimlich.
„Erzähl doch mal“, bohrte Annalena.
„Was?“, fragte ich und dachte verwirrt daran, wie vielen Zufällen ich es verdankte, dass ich überhaupt geboren werden konnte.
„Von deinem Vater“, sagte Annalena.
Die Vögel waren vom Himmel verschwunden, aber schon im nächsten Moment kamen sie wie aus dem Nichts zurück und wirbelten in einem triumphierenden schwarzen Bogen erneut an meinem Fenster vorbei. Wieder kreischten sie dabei wie verrückt. Sie schienen dieses wilde Herumfliegen aus reinem Vergnügen zu betreiben. Ob sie eine Familie hatten? Krähenvater, Krähenmutter, Krähenkinder, Tanten, Onkel, Großeltern? Gab es so etwas? Oder waren sie bunt durcheinander gewürfelt und hatten sich ganz zufällig zusammengeschlossen? So wie Leute, die sich zufällig auf einer Reise treffen und sich nach ein, zwei Wochen wieder aus den Augen verlieren?
„Lilli, nun sag doch mal was“, drängte Annalena und legte sich bäuchlings auf mein Bett.
„Mein Vater heißt Paul“, sagte ich.
„Aha“, machte Annalena. „Und weiter?“
Ich schwieg und dachte an mein Gemeinschaftskundeheft, in dem seit heute stand:
Stammbaum meiner Familie:
1. Lilli Milewski.
2. Maria Milewski. (Meine Mutter)
Nicht einmal an den Namen meiner polnischen Großmutter konnte ich mich erinnern. Aber schließlich hatte ich sie auch nie gesehen.
„Erzähl doch mal“, sagte Annalena.
Ich schaute weiter in den Himmel, aus dem der schwarze Vogelschwarm jetzt endgültig verschwunden war, und anschließend auf das graue Stück Stadt, das man von hier oben in weiter Ferne sehen konnte. Minihäuser, Miniautos, kahle Minibäume, Minigrünanlagen und ein unordentliches Gewirr aus Ministraßen breiteten sich vor meinem Blick aus.
Ich sehnte mich nach dem Frühling und dem Sommer und danach, in den Stadtpark zu gehen und am Entenweiher zu sitzen und Steine ins Wasser zu werfen. Und am Abend könnten Annalena, Viktoria und ich unter der schönen, weit ausladenden Linde am hinteren Ende des Parks sitzen, ohne zu frieren.
„Meine Mutter redet nicht gerne über ihn“, sagte ich schließlich zögernd. „Sie hat ihn halt irgendwie, irgendwo, irgendwann kennengelernt und dann mich bekommen, aber er wollte kein Kind haben und ist in eine andere Stadt gezogen – und mehr weiß ich auch nicht …“
Annalena runzelte die Stirn. „Aber er hätte sich doch um dich kümmern müssen“, sagte sie, obwohl ich mir wünschte, sie hätte das nicht ausgesprochen. Und auch nicht das, was danach kam: „Du bist doch seine Tochter. So ein blöder Typ …“
Damals waren wir zwölf. Und am Abend dieses Tages fiel der Blick meiner Mutter auf mein aufgeschlagenes Hausaufgabenheft. Ich lag schon im Bett.
„Deine Großmutter hieß Jirina Milewski“, sagte meine Mutter und setzte sich auf meinen Bettrand. „Und sie war sehr hübsch. Aber auch schrecklich ernst und irgendwie ein bisschen langweilig. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, sie wäre jünger und lustiger und weniger schwerfällig und würde mehr erzählen und lachen. – Aber hübsch war sie, und du hast ihre schönen Augen geerbt, Lilli Milewski …“
Ich schaute meine Mutter an. „Und was habe ich von meinem Vater geerbt?“, fragte ich vorsichtig.
Meine Mutter seufzte, aber sie wich meinem Blick nicht aus. „Die Form deiner Hände“, sagte sie nach kurzem Zögern und streichelte meine Hand, die auf der Bettdecke lag. „Und die Art, wie du lachst.“
Mehr sagte sie nicht, und mehr fragte ich auch nicht.
Am nächsten Tag suchte meine Mutter für mich ein Foto meiner polnischen Großmutter aus ihrem Sammelsurium an Kisten und Schachteln, die sich überall in ihrem Zimmer türmten. Sie befestigte es an der großen Pinnwand in der Küche.
Ich schaute es eine Weile an.
„Damals war ich gerade geboren worden“, sagte meine Mutter und goss sich ein Glas Rotwein ein. „Es ist in Breslau aufgenommen.“
Ich schaute von der alten Fotografie zu meiner Mutter hinüber. Meine Mutter war gerade mal fünfunddreißig, und sie hatte dunkle, lockige Haare, die sie nachlässig hochzustecken pflegte. Außerdem hatte sie einen roten Farbklecks auf der Stirn und ein paar grüne Farbspritzer auf ihren nackten Füßen. Sie arbeitete als Narkoseschwester im städtischen Krankenhaus. Aber sobald sie aus der Klinik nach Hause kam, zog sie sich um, tauchte unsere kleine Wohnung in laute Musik und widmete sich einem ihrer vielen Kunstprojekte. Manchmal malte sie riesige Bilder, Leinwand für Leinwand, die sie dann in der Galerie eines Freundes ausstellte. Oder sie formte Gipsplastiken oder erschuf Wesen aus Holz- und Metallabfällen, die sie zusammennagelte und mit bunten Dosenlackfarben besprühte. Unsere ganze Wohnung stand voller Wesen und Skulpturen und anderer Merkwürdigkeiten.
Ich schaute zurück zu der ernsten Frau auf dem Foto. Sie trug eine helle, hochgeschlossene Bluse, die Stirn leicht gerunzelt, und lächelte mit geschlossenem Mund. Ihre Haare waren ordentlich zurückgekämmt und zusammengebunden. Nur direkt am Haaransatz konnte man sehen, dass ihr Haar leicht gelockt war. Sie sah erschöpft und gereizt aus.
„Kaum zu glauben, dass du ihre Tochter bist“, sagte ich schließlich.
Meine Mutter nickte. „Aber schau dir ihre Augen an“, sagte sie dann. „Sie sind wie deine.“
Ich schüttelte den Kopf. „Kann ich nicht finden“, murmelte ich ablehnend.
„Aber natürlich“, sagte meine Mutter. „Derselbe Farbton, dieselben Wimpern, dieselben Augenlider – sogar dieselbe Augenbrauenform.“
„Und von deinem Vater – gibt es von dem auch ein Bild?“, erkundigte ich mich neugierig.
Meine Mutter schüttelte den Kopf.
„Meine Mutter hatte wohl früher ein paar Aufnahmen von ihm. Von einer Reise nach Israel mit der Kirche, aber meine Mutter hat sie alle weggeworfen, nachdem mein Vater sie zurück nach Polen geschickt hatte …“
Wir schauten uns an.
„Und – von meinem Vater?“, fragte ich leise.
„Ich habe ein einziges Bild, auf dem er zu sehen ist“, antwortete meine Mutter zögernd. „Es ist irgendwo in einer Kiste. Ein Bild von einem Nachmittag in der Mainzer Altstadt. Ich werde es eines Tages bestimmt wieder finden, und dann gebe ich es dir, versprochen.“
Ich schwieg dazu und spürte mein Herz schlagen.
Im darauf folgenden Frühling, es war kurz nach meinem dreizehnten Geburtstag, schnappte ich einen Satz auf, als meine Mutter gerade telefonierte. Sie stand auf einer Leiter im Wohnzimmer und war gerade dabei, einem dürren grünen Wesen ein dürres grünes Pappmaschee-Gesicht zu formen. Das schnurlose Telefon hatte sie zwischen Ohr und Schulter geklemmt, und am anderen Ende der Leitung war Bernhard, dem die Galerie gehörte, in der sie in der kommenden Woche ihre grünen Pappwesen ausstellen würde.
„Ich wünschte, er würde auf der Stelle tot umfallen!“, schimpfte sie. „Noch nie hat er einen einzigen Cent Unterhalt für Lilli gezahlt – und jetzt höre ich, er hat in der Zwischenzeit eine Bombenkarriere gemacht und längst zwei neue Kinder!“
Ich blieb wie angewurzelt stehen. Ihre Worte dröhnten und hallten in meinem Kopf. Leise und vorsichtig drehte ich mich um und schlich zurück in mein Zimmer. Meine Mutter hatte zum Glück nichts mitbekommen.
Ich weiß nicht, was ich danach tat. Ich weiß nur, dass ich die Worte meiner Mutter noch tagelang im Kopf hatte. Sie ließen sich durch nichts verscheuchen. Ich schlief mit ihnen ein und wachte mit ihnen auf.
Mein Vater hatte mich nicht gewollt und er hatte in den letzten dreizehn Jahren kein einziges Mal Interesse an mir gezeigt. Es war ihm egal, ob ich lebte oder tot war, ob es mir gut ging oder schlecht. Aber er hatte neue Kinder, für die er da zu sein schien.
Ich erzählte keinem etwas von diesen Gedanken, nicht mal Annalena oder Viktoria.
Jeden Freitag wurde Annalena mittags von ihrem Vater von der Schule abgeholt. Und Viktoria telefonierte jeden Samstagabend mit ihrem Vater in Paris.
„Willst du mit meinem Vater und mir zu Luigi Pizza essen gehen?“, fragte mich Annalena am Freitag derselben Woche.
Ich schüttelte schnell den Kopf und beobachtete eine Weile später von Weitem, wie Annalena über den Schulhof auf ihren Vater zulief, der neben dem Schultor an der Hofmauer lehnte und auf sie wartete. Er küsste sie auf die Nasenspitze, nahm sie an der Hand, und dann gingen die beiden davon.
In diesem Moment fühlte ich mich bleischwer. Sehr langsam ging ich zur Bushaltestelle, stieg in den Bus und fuhr nach Hause. Mein ganzer Kopf war voll mit Fragen. Ich spürte, wie ich Kopfschmerzen bekam. Zu Hause stellte ich mich an mein offenes Fenster und atmete in tiefen Zügen die kalte, nasse Stadtluft ein. Der Himmel war grau mit grauen Wolken und grauen Schlieren darin. Eine einsame schwarze Krähe flatterte schwerfällig über ihn hinweg. Ich schaute ihr hinterher, bis ich sie nicht mehr sehen konnte. Wo waren die anderen Vögel? Warum war dieser hier so alleine?
Mein Gesicht war ganz kalt geworden. Ich spürte, dass ich zitterte und ein bisschen weinte, ein paar Tränen bloß. Warum war ich so traurig in letzter Zeit? Früher hatte ich Annalena und ihren Vater oft zu Luigi begleitet, warum hatte ich es heute nicht getan? Ich musste an Annalenas Vater denken. Er war lustig und immer sehr nett zu mir, wenn ich ihn zusammen mit Annalena besuchte. Er hatte schon ziemlich schütteres Haar und sanfte veilchenblaue Augen, die ein bisschen wie Kinderaugen aussahen. Außerdem war er sehr groß und sehr dünn, und überall in seiner Wohnung hingen Fotografien von Annalena. Annalena als Baby, Annalena als Kleinkind, Annalena als Kindergartenkind, Annalena in der Schule, Annalena bei den Pfadfindern, Annalena, Annalena, Annalena …
Mein Vater dagegen besaß kein einziges Bild von mir!
Ich fühlte mich plötzlich wie die einsame, schwerfällige schwarze Krähe, deren Flug ich vor ein paar Minuten beobachtet hatte.
Wo, verdammt nochmal, war mein Vater, und was tat er im Moment?
Mit einem Ruck schloss ich das Fenster.
Und dann wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich würde mich auf die Suche nach meinem Vater machen.
2
Es war viel einfacher, als ich angenommen hatte. Meine Mutter würde den ganzen Nachmittag mit ihren grünen Pappmaschee-Wesen in Bernhards Galerie sein, da morgen ihre Ausstellung begann, und darum hatte ich genügend Zeit.
In der Wohnung war es ganz still, die Anlage meiner Mutter war ausgeschaltet und das Telefon klingelte kein einziges Mal. Und so fing ich im Zimmer meiner Mutter an zu suchen. Drei Ordner befanden sich sichtbar in einem der vier zimmerdeckenhohen Regale. Ich zog sie der Reihe nach heraus und fand Steuerunterlagen, Telefonrechnungen und Versicherungspolicen. Ungeduldig stellte ich die Ordner zurück und ließ meinen Blick weiter über die hohen, voll gestopften Regale wandern. Dabei entdeckte ich etliche Pappschachteln und sechs Blechkisten. Vorsichtig zog ich Kiste für Kiste aus dem Regal. Ich fand Unmengen alter Fotos, Briefe und Postkarten, Pinsel und Buntstifte, Land- und Straßenkarten, Zeugnisse, alte, zerknitterte Bewerbungsunterlagen und zwei Plastikrosen, wie es sie an Schießständen auf Jahrmärkten gibt. Woher die wohl stammten und warum meine Mutter sie aufbewahrte? Dann fand ich auch noch ein kleines Plastikdöschen mit den trockenen Überresten alter Kontaktlinsen. Kopfschüttelnd legte ich es zurück und wischte meine staubigen, kalten Hände an meiner Jeans ab. Ich hatte Herzklopfen vor Aufregung. Ich war mir sicher, dass meine Mutter wütend werden würde, wenn sie wüsste, dass ich hier alles durchstöberte.
Irgendwann hatte ich alle Kisten und Schachteln durchsucht. Erschöpft und ratlos setzte ich mich auf das zerwühlte Futonbett meiner Mutter. Ich hatte eine Menge alter Fotos gefunden, auf denen ich zu sehen war. Ein paar von ihnen breitete ich vor mir auf dem Boden aus. Da war ich als nacktes, neugeborenes Baby in den Händen meiner Mutter. Dieses Bild war in Schwarzweiß aufgenommen. Auf einem anderen Foto hockte ich vergnügt in Schweden auf einem Holzsteg am Meer. Ich lächelte mir zu. Auf einem dritten Bild saß ich mit geflochtenen Zöpfen und verweinten Augen in einem Straßencafé und trank aus einem Strohhalm Limo. Auf einem vierten Bild war ich zusammen mit Annalena und Viktoria zu sehen, Arm in Arm. Meine Mutter hatte es letzten Sommer im Schwimmbad geknipst. Das fünfte Foto zeigte mich und meine Mutter bei ihrer allerersten Ausstellung. Damals war ich gerade vier, und meine Mutter hatte dürre, große Metallwesen erschaffen, in die elektronische Impulsgeber eingebaut waren. Jedes Mal, wenn man an ihnen vorüberging oder mit den Händen die Luft um sie herum berührte, gaben sie summende Töne von sich. Ich konnte mich noch gut daran erinnern, weil ich anfangs richtig Angst vor ihnen hatte.
Ohne darüber nachzudenken, was ich tat, stand ich auf und holte einen großen Briefumschlag vom Schreibtisch meiner Mutter. Ich steckte die Bilder hinein, klebte ihn zu und schrieb anschließend mit einem schwarzen Edding Lilli darauf. Diese Bilder würde ich meinem Vater schenken, wenn ich ihn jemals fand.
Ich stand jetzt mitten im Zimmer meiner Mutter, und ganz plötzlich, ganz von alleine, fiel mein Blick auf eine dünne graue Mappe, die im letzten Regal auf dem allerobersten Brett zwischen der Wand und ein paar Büchern klemmte. Wie hypnotisiert starrte ich sie an. Ich spürte meinen Herzschlag im ganzen Körper. Das musste sie sein! Die Mappe, in der ich das finden würde, was ich suchte!
Ich war mir ganz sicher, obwohl ich nicht begriff, woher diese Sicherheit kam. Sie war ganz einfach da. Auf zittrigen Beinen zog ich den Schreibtischstuhl heran und stieg hinauf. Ich zog die Mappe hervor und schlug sie schnell auf. Sie enthielt zehn Blätter. Da waren meine Geburtsurkunde, der zweiseitige Brief eines medizinischen Labors, ein Blatt, auf dem Vaterschaftsanerkennungsurkunde stand, und sechs weitere Blätter, die von zwei verschiedenen Rechtsanwälten stammten.
Und auf allen diesen Unterlagen stand immer wieder ein Name: Paul Bergmann.
Paul Bergmann – mein Vater!
Ich schwitzte und fror gleichzeitig. Benommen kletterte ich vom Stuhl, als ich einen weiteren kleinen Zettel entdeckte. Er musste aus der Mappe herausgerutscht sein und lag jetzt auf dem Boden. Vorsichtig hob ich ihn auf. Es war eine kleine, vergilbte Quittung. Café Korfmann – Mainz, stand darauf, und auf der Rückseite war etwas hingekritzelt. … wie wunderschön, dass es dich gibt, Maria!, stand da. Und darunter: Dein Paul.
Paul Bergmann … Ich saß in meinem Zimmer auf dem breiten Fensterbrett und schaute über die Stadt. Meine Mutter war noch immer unterwegs und ich fühlte mich von Kopf bis Fuß aufgeregt. Ich hatte mir alle Unterlagen aus der grauen Mappe sorgfältig durchgelesen. Auf meiner Geburtsurkunde war unter der Rubrik Eltern nur der Name meiner Mutter eingetragen, und der Brief des medizinischen Labors war das Ergebnis einer Untersuchung, ob mein Vater tatsächlich mein Vater war! Dazu hatten sie sein Blut, mein Blut und das Blut meiner Mutter untersucht! Damals war ich gerade erst zehn Monate alt gewesen und hatte von alledem natürlich nichts mitbekommen. Ganz zuunterst war vermerkt, dass mein Vater wirklich und wahrhaftig mein Vater war. Ich las es wieder und wieder.
Aber das Blatt mit der Überschrift Vaterschaftsanerkennungsurkunde war das beste Blatt der ganzen Mappe. Ich bekam immer wieder Herzklopfen, wenn ich es mir anschaute. Darauf stand mein Name und darunter der Name meines Vaters und ganz unten war seine eigene Unterschrift! Ich schaute sie mir wieder und wieder an. Seine Handschrift war schön. Schwungvoll und flüssig. Dabei war mein Vater damals erst zwanzig Jahre alt gewesen. Also war er jetzt dreiunddreißig, zwei Jahre jünger als meine Mutter. Und er hatte im März Geburtstag, so wie ich.
Die Briefe der beiden Anwälte waren weniger schön. Aus ihnen ging hervor, dass mein Vater keinen Unterhalt für mich zahlte. Die ersten beiden Jahre hatte er einfach zu wenig Geld, und darum hatte es das städtische Jugendamt übernommen, meiner Mutter eine monatliche Summe für mich zu überweisen. Aber auch später hatte mein Vater keinen Cent für mich bezahlt.
Ich betrachtete wieder die schöne Unterschrift auf der Vaterschaftsurkunde, mit der mein Vater anerkannt hatte, mein Vater zu sein. Paul Bergmann und Lilli Milewski. – Paul Bergmann und Lilli Bergmann. Lilli Bergmann.
Kurz darauf hörte ich meine Mutter nach Hause kommen und versteckte die graue Mappe schnell in meinem Schrank. Nur den kleinen Quittungszettel aus dem Café Korfmann legte ich in mein Tagebuch. … wie wunderschön, dass es dich gibt, Marie! Dein Paul. Ich holte tief Luft und beschloss, meine Mutter jetzt nach der ganzen Geschichte zu fragen. Aber als ich in die Diele ging, sah ich, dass meine Mutter nicht alleine gekommen war. Sie hatte Bernhard mitgebracht und Bernhard blieb den ganzen Abend.
„Bernhard und ich haben noch so viel zu besprechen wegen der Ausstellung“, erklärte meine Mutter gehetzt. Aber dann setzten sich die beiden einfach in die Küche an unseren kleinen Tisch und tranken zusammen eine Flasche Rotwein. Ich setzte mich zu ihnen, und nach und nach begriff ich, dass Bernhard nicht nur ein Galeriebesitzer war, sondern meiner Mutter offensichtlich mehr bedeutete.
Bernhard legte seine Hand auf die farbgesprenkelte Hand meiner Mutter. Da stand ich auf und ging in mein Zimmer.
Ich legte mich auf mein Bett und sehnte mich nach einem anderen Leben. Einem Leben, in dem mein Vater vorkam.
Es wurde Sommer und Herbst und Winter und ich war nach außen weiterhin überall Lilli Milewski. Aber tief in mir drin war ich Lilli Bergmann. Und nachts, im Bett, schrieb ich es immer wieder in mein Tagebuch: Lilli Bergmann. Lilli Bergmann. Lilli Bergmann … Ich wollte es so oft schreiben, bis ich es häufiger geschrieben hatte als Lilli Milewski.
Kurz nach Weihnachten besuchten Annalena und ich Annalenas Stiefuroma. Zuerst aßen wir eine riesige Pizza zusammen, und Annalenas Uroma trank ein Glas Montepulciano dazu, während sie für uns eine Kanne Tee gekocht hatte, dann spielten wir eine Runde Nintendo zusammen und unterhielten uns noch ein bisschen. Zuerst erzählte Annalenas Uroma von ihren drei Ehen und ihrem letzten Freund, der Italiener gewesen war und mit dem sie ein paar Jahre in Rom gelebt hatte, bis er dann eines Tages einfach so gestorben war, ohne Vorwarnung, während er am Gartentisch saß und gedankenverloren zu seinem Magnolienbaum hinüberschaute.
„Gut, er war schon fast achtzig“, räumte Annalenas Uroma nachdenklich ein. „Aber es war dennoch der größte Schock meines Lebens. Und ich vermisse ihn immer noch immerzu! Es vergeht keine Stunde, in der ich nicht an ihn denke. Ich habe ihn sozusagen immer bei mir, und das ist gut und traurig zugleich …“
Ich musste an meinen Vater denken, als ich das hörte. Ich vermisste ihn auch immerzu, aber ich hatte noch nicht einmal Erinnerungen an ihn, an die ich mich halten konnte. Ich wusste ja noch nicht einmal, wie er aussah.
Und plötzlich sprudelte alles aus mir heraus, die ganze Geschichte. Mein Vater, der meiner Mutter … wie wunderschön, dass es dich gibt auf einen Quittungszettel geschrieben hatte und der mich gezeugt hatte und dann verschwunden war, der mich nicht kannte und den ich nicht kannte, der sich nichts aus mir zu machen schien und mich wahrscheinlich längst vergessen hatte.
Irgendwann hielt ich erschöpft inne. Ich hatte sogar erzählt, dass ich mich im Geheimen Lilli Bergmann nannte und dass meine Hände den Händen meines Vaters ähnelten.
„Na, dann wird es Zeit, dass du ihn dir anschaust, Lilli“, sagte Annalenas Uroma und schenkte sich ein zweites Glas Rotwein ein.
Ich schaute sie stumm an.
„Klar, wir gehen gleich nachher zu deiner Mutter und fragen sie, ob sie seine Adresse kennt“, schlug Annalena vor.
„Und wenn nicht?“, fragte ich leise.
„Dann wird sie jemanden kennen, der seine Adresse kennt“, sagte Annalenas Uroma energisch. „Lilli, man muss das Leben anpacken, sonst kommt man nie zu etwas!“
Ich schwieg, weil ich nicht wusste, was ich darauf antworten sollte. Ich wünschte mir nur, Annalenas Uroma wäre meine Uroma und ich hätte ein Recht auf sie. Ein Recht, hier bei ihr zu sitzen, ein Recht, sie anzurufen, wenn mir danach war. Aber das hatte ich natürlich nicht.
Etwas später machten wir uns auf den Nachhauseweg. Draußen regnete ein kalter, nasser Schneeregen vom weißen Himmel und Annalena und ich gingen schweigend zur Bushaltestelle.
Meine Mutter war im Wohnzimmer, als ich mit Annalena nach Hause kam. Sie baute konzentriert an dem Haus, an dem sie schon die ganzen letzten Wochen arbeitete, sobald sie aus dem Krankenhaus nach Hause kam. Dafür vergaß sie einzukaufen, unserem Kater Gandalf etwas zu essen hinzustellen, die Telefonrechnung zu bezahlen und zu kochen. Für all das waren Bernhard oder ich zuständig, bis meine Mutter ihr Haus fertig haben würde.
Das Haus war zwei Meter hoch und zwei Meter breit, wie eine Puppenstube, und hatte alles, was sich in einem normalen Haus auch findet: Zimmer, Treppen, Toilette, Küche, Spüle, Waschmaschine, Fernseher, Grünpflanzen. Nur dass darin ein arbeitsloser, einsamer, unglücklicher Minimann lebte, dessen Leben sinnlos geworden war und der sich dem Nichtstun und dem Verfall hingab. Das erkannte man an überquellenden Aschenbechern, ungewaschener Wäsche, dem voll gestopften Briefkasten, den er nicht mehr leerte, und den Zimmerpflanzen, die vor sich hin welkten. All das baute meine Mutter in minimalistischem Format um ihn herum zusammen.
„Na, habt ihr Spaß gehabt bei Martha?“, fragte sie und schaute kurz hoch. Martha war Annalenas Uroma.
Wir schauten uns an, und Annalena stieß mich auffordernd in die Seite. Und da tat ich es. Ich fragte nach meinem Vater.
„Wo ist er? Was weißt du von ihm? Was für einen Beruf hat er? Wie sieht er aus? Wo finde ich ihn?“
Ich lehnte mich erschöpft an den Türrahmen. Wenn keine Musik gelaufen wäre, wäre es jetzt totenstill gewesen.
Das