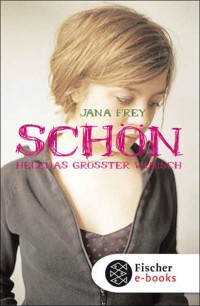8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein dunkles Familiengeheimnis – von der Bestseller-Jugendbuchautorin Jana Frey Kassandra hat schon fast überall gewohnt: in Paris und Prag, auf Stromboli und in der Walachei. Daran ist ihre Mutter schuld: Sobald sie von der großen Unruhe gepackt wird, zieht sie um. Und jedes Mal muss Kassandra sich wieder neu einleben. Manchmal fühlt sie sich geradezu erdrückt. Und immer öfter spürt sie, dass da etwas fehlt in ihrem Leben. Nur was? Hat es mit ihrer Vergangenheit zu tun? Warum hat ihre Mutter eigentlich jeglichen Kontakt zu den Großeltern abgebrochen? Kassandra will es herausfinden. Und dann entdeckt sie etwas, das ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt … Authentisch, packend, dramatisch – Lesen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jana Frey
Weil du fehlst
Impressum
Covergestaltung: bilekjaeger unter Verwendung einer Abbildung von Getty Images/Flickr/Rekha Garton
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401308-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto und Widmung]
Was machst du? Ich [...]
Aber nach und nach [...]
Es hilft nichts, sich die Vergangenheit zurückzurufen, wenn sie nicht einigen Einfluss auf die Gegenwart ausübt.
Charles Dickens
Für Elena Gastring. Und Julia Ruttke. Und Fynn Saddei. Danke!
Was machst du? Ich lasse das Leben auf mich regnen.
Meine Mutter gibt sich Mühe, immer wieder alle Brücken hinter uns abzubrechen, alle Spuren zu verwischen. Wir haben schon fast überall gewohnt, was natürlich übertrieben ist, denn kein Mensch kann fast überall gewohnt haben. Aber ich kann Paris aufweisen und Prag und ein Kaff namens Afumati – das liegt in Rumänien in der Region Walachei und das ist kein Witz. Außerdem waren da natürlich einige amerikanische Städte, Philadelphia und Milwaukee und so weiter, aber am schönsten und verrücktesten war es auf Stromboli. Die Insel liegt im Mittelmeer nördlich von Sizilien und es ist eine sehr hohe, aber sehr kleine Insel. Nicht mal sechshundert Menschen wohnen auf Stromboli, und eine Weile waren meine Mutter, meine Schwester Oya und ich drei von ihnen. Von Stromboli stammt auch Billyboy, unsere Katze.
Eine kurze Frage und eine kurze Antwort:
Wer bin ich?
Ich bin Kassandra.
Geboren wurde ich ganz unspektakulär in Springfield, Connecticut, einer eher unspannenden Kleinstadt mit vielen Highways rundherum und einer hübschen Altstadt, die aber so klein ist, dass man wahnsinnig oft hindurchlatschen kann in einer einzigen popeligen Stunde, ohne allzu viel zu sehen. Auch Oya ist in Springfield geboren. Das war noch vor der Zeit, in der unsere Mutter Mrs Ruhelos wurde und anfing, durch die Welt zu jagen auf der Suche nach Keineahnungwas. Sie legt sich – und damit auch uns – neue Wohnorte zu, wie sich andere Frauen Schuhe zulegen. Aber in diesem Fall nicht mal normale Schuhe wie Riemchensandalen, Pumps und so was, sondern eher, als kaufe sie besessen schräge Mokassins, schillernde, orientalische Opanken und solche Sachen. Prag, Stromboli, Paris eben.
Ich kann eine Menge Klassenlehrerinnen aufweisen durch unsere vielen Umzüge. Meine Mutter, die mal, vor langer Zeit, Kunst studiert hat, verdient ihr und damit unser Geld mit Malerei. Was sie malt? Alles. Wirklich alles. Auftragsarbeiten, manchmal der übelsten Art. Haustiere in Acryl zum Beispiel. Pudel von alten, senilen Damen und so weiter. Einmal hat sie auch das schwermütige, knotige, äußerst hässliche Krokodil eines Mannes Namens Edgar Nash gemalt, der dann ein paar Monate ihr Lover wurde. Durch ihn kamen wir nach Milwaukee. Es war unglaublich. Edgar und meine Mutter und immer dieser Reptiliengeruch in Edgars Haus. Er hatte auch Leguane und andere Gruselviecher. Aber er war Collegeprofessor für diese Art von Tieren, und manchmal konnte er ganz nett sein. Er tanzte mit meiner Mutter zu imaginärer Musik Polka durch sein unordentliches Reptilienhaus und weinte, als seine Gelbwangenschildkröten an einer Seuche eingingen.
Aber zurück zu meinen Klassenlehrerinnen. Es gab eine Mrs Cardasis, zwei Mrs Thomas, nur verschieden geschrieben, eine Miss Aronsson, eine Mrs Olariu, besser gesagt Doamna Olariu in Afumati, eine Pani Sládekova in Prag, eine Madame Baffour und eine Madame Runné in Paris und vorher die lieben, verrückten Signora Tozzi und Signora Graziano auf Stromboli. Signora Graziano verdanke ich die beinahe einzig stabile Komponente in meinem Leben. Ich meine außer dem ewigen Zusammenglucken mit meiner Mutter und mit Oya und Billyboy. Aber das nenne ich keine stabile Komponente. Das ist eher eine Zwangsverbindung. Darum zurück zu Achmed. Denn Signora Graziano schenkte oder vielmehr verpasste ihn mir: Achmed, der kein Terrorist ist, weder ein toter noch ein lebender, sondern ein netter türkischer Achtzehnjähriger aus Ankara, der mein Brief – Quatsch – E-Mail-Freund ist. Signora Graziano verpasste allen in der kleinen Schule, die es auf Stromboli gibt, einen E-Mail-Freund, um uns multikultureller zu gestalten, wie sie erklärte. Oya hat damals eine schwedische E-Mail-Freundin verpasst bekommen, der Kontakt ist inzwischen eingeschlafen. Aber Achmed ist mir geblieben. Damals, als ich ihn bekam, war er dreizehn und ich zwölf, und er verehrte Madonna, Atatürk, den Staatsgründer der Türkei, und außerdem die originalen, britischen Matchboxautos von Lesney Products & Co. Die vor allem. Heute verehrt er Cher, Mahatma Gandhi und amerikanische Actionfilme. Die vor allem.
Hier ein Auszug aus einer Mail an Achmed:.
… wir ziehen zurück in die USA. Ist das zu fassen? Gerade hatte ich mich an Paris gewöhnt. All die irren Franzosen und der Café au lait und die Schule und Madame Runné und unsere kleine, miefige Wohnung im Vorort Porte de la Chapelle (bekannt aus den Nachrichten, weil sie sich dort dauernd die Köpfe einschlagen in den Nächten.) Oya hat rasend schnell französisch gelernt. Ich finde, R. mutet uns zu viel zu.
(Anmerkung: mit R. ist meine Mutter gemeint, sie heißt Rabea, und so nenne ich sie auch. Sie ist nicht so der Mommy-Mutter-Typ, Rabea ist schon okay, aber in meinen E-Mails an Achmed, der kein Terrorist ist und sich vehement gegen Frauenunterdrückung à la Kopftuch, Scharia und Zwangsverheiratungen ausspricht, nenne ich meine Mutter kurz R.).
Wie geht’s dir, Achmed? …
Achmed geht es eigentlich irgendwie immer gut, darum ist meine Wie-geht’s-dir-Frage mehr eine Floskel als eine ernstzunehmende Frage. Manchmal wünschte ich, ich könnte Er werden und in sein Leben schlüpfen. Er hat Mutter, Vater, zwei Grandmas, einen Grandpa, einen Urgroßvater, dazu drei Brüder und massenweise Tanten und Onkel, die alle auch nett zu sein scheinen. Nett und normal. Seine Mutter malt keine schranzigen Krokodile oder zieht zu Edgar Nash, dem Reptilienmann, um mit ihm Polka zu tanzen und ihn dann eines Tages sang- und klanglos wieder zu verlassen, sein Vater ist anwesend und liberal und ebenfalls ein Kopftuchablehner. Seine Großeltern scheinen friedliche Rentner zu sein, die ihre Enkel lieben und verwöhnen. Seine Brüder? Keine Ahnung, über die schreibt er eher wenig bis nichts.
Ich habe gar keinen Vater.
Nein, das stimmt nicht. Oyas und mein Vater ist tot. Er starb, als ich vier war und Oya zwei. An Krebs.
Nach seinem Tod wurde meine Mutter von dieser inneren Unruhe gepackt, die dazu führte, dass ich diese Massen von Exlehrerinnen habe.
Eine Statistik:
1995 wurde ich geboren.
1999 starb Raymond, mein Vater.
Seit 2000 ziehen wir um.
Die Wolke begleitet mich.
Frage:
Wer oder was ist die Wolke?
Antwort:
Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Die Wolke ist schwarz und stürzt aus dem Himmel auf mich drauf und hüllt mich ein. Ich fühle mich, als erstickte ich. Die Wolke ist mein Albtraum. Ich träume den Schwarzewolkentraum in unregelmäßigen Abständen. Und nach einem Wolkentraum muss ich mich umziehen, weil ich widerlich schweißdurchtränkt bin. Angstschweiß ist eklig. Nach dem Umziehen liege ich manchmal wach, bis es hell wird. Jeder wird vermutlich verstehen, dass ich den Wolkentraum fürchte wie die Leute im Mittelalter die Pest.
Wir kamen also zurück nach Amerika, gerade als Oya so perfekt Französisch gelernt hatte, und ich mittelmäßig. Anderthalb Jahre Paris waren von einem Tag auf den anderen schnöde Vergangenheit. Ich siebzehn, Oya fünfzehn.
»Manchmal hasse ich sie regelrecht«, sagte Oya düster und besprühte Billyboy mit Antiflohspray. Sie ist Rabea. Vor Paris war Stromboli gewesen, Billyboys Heimat. Auch aus Stromboli hatte Oya nicht mehr fortgewollt. Sie verhaftet sehr schnell. Dieser Satz stammt nicht von mir, natürlich nicht, so geschwollen rede ich nicht. Dieser Satz stammt von Rabea, der Umzugsfetischistin. Sie sagte ihn am Telefon zu irgendjemandem, ich bekam es mit einem Ohr mit. Jedenfalls, als wir auf Stromboli wieder die Zelte abbrachen, sozusagen (in Wahrheit hatten wir in einem kleinen, schönen, lichten, etwas meerwasserfeuchten Haus gewohnt, dessen Besitzer Sergio Milazzo gewesen war, dem Wir-leben-auf-Stromboli-Grund unserer Mutter: ihr Lover, ein Touristenherumführer mit tiefen, schwarzen Augen), tobte Oya und spuckte Flüche gegen Rabea aus und drohte damit, sich auf der Stelle im Meer zu ersäufen. Es nützte ihr aber alles nicht. Rabea wollte nach Paris.
»Welcher Scheißtyp wartet da auf dich?«, brüllte Oya so aufgebracht, dass ihr die Spucke nur so aus dem Mund sprühte. Wäre Oya bei Besinnung gewesen, hätte sie sich dafür geschämt, sie ist ein sehr feiner, aufgeräumter Typ und Spucke-aus-dem-Mund ist absolut unoyahaft. Aber so bekam sie es gar nicht mit.
»Niemand wartet auf mich in Paris. Aber ich habe genug von dieser schmuddeligen, kleinen öden Insel. Ich brauche Luftveränderung.«
Wir wollten keine Luftveränderung. Wir liebten die Insel und die Luft dort und den Vulkan und Sergios Mutter, die wir Nonna nannten, und Billyboys dicke, behäbige Katzenmutter, und Signora Graziano, die uns Achmed und die schwedische Jonna verpasst hatte.
Aber, wie gesagt, es nützte uns alles nichts, denn Rabea und Sergio hatten sich auseinandergelebt, und wir zogen um nach Porte de la Chapelle, wo sich weiße und schwarze Franzosen nachts gerne killen und dabei einen Riesenkrach machen. Und oft auch Feuer, wenn sie Autos anzünden, die das Pech haben, zwischen die nächtlichen Fronten zu geraten.
Und nach Paris jetzt wieder die USA. Good-old-New-England.
»Ich drehe durch«, sagte Oya und hielt Billyboy gnadenlos zwischen ihren Knien eingeklemmt fest. Dabei war sie mit dem Gegen-Flöhe-Einsprühen inzwischen fertig. Aber sie hat den Kater gerne auf dem Schoß, er ist ihre Stromboli-Erinnerung, während Billyboy kein unbedingter Auf-dem-Schoß-Sitzer ist, sondern lieber für sich alleine liegt.
»Und nächste Woche Schule«, seufzte ich und beendete eine E-Mail an Achmed.
Auszug aus der E-Mail an Achmed:
… Elfte Klasse. Und wieder mal ein Schulwechsel, obwohl das Schuljahr hier schon angefangen hat und alle ihre Kurse gewählt haben. R. tut das natürlich mit einem Schulterzucken ab. Ach ja, du hast nach meinen Großeltern gefragt. Ein paarmal schon. Ich weiß, du hältst viel von Großeltern, weil deine prima sind. Aber hier bei uns gibt es niemanden. R.‘s Eltern sind mit R. (und dadurch auch mit Oya und mir, wie es aussieht) seit Jahren zerstritten. Und die Eltern meines Vaters? Keine Ahnung. Ich glaube, mein Vaterseitengrandpa ist schon seit einer Ewigkeit tot, und meine Vaterseitengrandma? Großes Fragezeichen …
»Schreibst du an Achmed? Gute, alte Signora Graziano! Ich wünschte, ich hätte Jonna Sjöborg noch. Sie hatte so was Beruhigendes. Schweden sind durch Astrid Lindgren zum Beruhigendsein verdonnert, findest du nicht auch?«
Ich nickte zweimal. Einmal, weil ich ja tatsächlich an Achmed geschrieben hatte, und einmal wegen Oyas Schwedentheorie.
»Oya, was wissen wir eigentlich über Raymonds Mom? Und, wegen Jonna: Schreib ihr doch einfach mal wieder. Oder hast du ihre E-Mail-Adresse nicht mehr?«
Oya zuckte mit den Achseln. Sie kann manchmal enervierend wortkarg sein. Vielleicht liegt es an dem Sprachenwirrwarr in ihrem sprachbegabten Kopf. Amerikanisch, erzwungenes Schulspanisch, Tschechisch, Rumänisch, Italienisch, Französisch. Ich habe mal einen Artikel über das gehirntechnische Verarbeiten von Mehrsprachigkeit gelesen und da stand, dass gerade Sprachgenies mitunter Wortfindungsprobleme bekommen können, wenn zu viele Sprachen im Muttersprachensektor landen.
»Was meinst du damit?« (Ich meinte ihr knappes Achselzucken). »Du weißt nichts über Raymonds Mutter – oder du weißt nichts über die E-Mail-Adresse deiner Schwedin?«
»Weder noch«, antwortete meine kleine Schwester, die körperlängentechnisch strenggenommen meine große Schwester genannt werden müsste.
Zwei äußerliche Beschreibungen:
1. Mittelgroß, mittelblond, ziemlich dünn, einige unordentlich verteilte Sommersprossen, unspektakuläre graue Augen, sehr dünne Finger (»Spinnenfinger« nannte sie Pani Sládekova in Prag einmal in einem Tonfall, den ich nur abfällig nennen kann. – Wen verwundert es, dass Pani Sládekova nicht unbedingt meine Lieblingslehrerin war?), gelockte Haarspitzen (»wie ein Engelchen«, sagte Signora Graziano manchmal entzückt. Sie war dann auch meine Lieblingslehrerin. Verdanke ich ihr doch zudem noch Achmed, den Guten.)
2. Sehr groß! Dunkle Haare. Grüne Augen. Schön. Viel schöner als ich. Die Welt ist ungerecht. Und Gene auch.
Eine Woche später, an einem sehr verregneten, sehr trüben, grauen, nordamerikanischen Tag, begann für uns die Schule. Jahrgang Elf für Kassandra Armadillo. Jahrgang Neun für Oya Armadillo.
Vornamen werden einem geschenkt. Nachnamen muss man ertragen. Jedem, der es nicht weiß, aber wissen will, was ein Armadillo ist, sei es ans Herz gelegt, es selbst nachzuschlagen. Oder zu googeln. Oder was auch immer.
»Tatsächlich Kassandra, wie diese Seherin aus Troja, der niemand glaubte?«, fragte ein Mädchen zwei Plätze weiter.
Ich nickte.
»Aber dir glaubt man?«
»Ich hoffe es jedenfalls«, antwortete ich.
Wir lächelten uns etwas zu. Das war nach der ersten durchstandenen Stunde, Mathe. Die nächste Stunde würden wir gemeinsam Englische Literatur haben bei einer Mrs O‘Bannion. Sie war in diesem Schuljahr meine Ansprechlehrerin, was in etwa dem Status einer Klassenlehrerin entsprach. Der Tag zog sich hin. Mrs Cardasis – Mrs Thomas – Mrs Tomas – Miss Aronsson – Doamna Olariu – Pani Sládekova – Signora Tozzi – Signora Graziano – Mme Baffour – Mme Runné – Mrs O’Bannion.
Ich seufzte mich durch den Vormittag. Die Stadt war voller beiger Menschen. Die Welt auch.
»Und, wie war’s bei dir?«, fragte mich Oya hinterher. Wir waren wieder zu Hause. Haha, zu Hause! Man kann ein kleines, schäbiges, gemietetes Haus, in dem man gerade einmal drei Wochen wohnt, schwer ein Zuhause nennen.
Ein paar Gedanken über Besitztümer:
Achmeds Familie besitzt eine Eigentumswohnung in Ankara. Mutter, Vater, er und seine Brüder wohnen darin. Und dann haben sie noch ein Haus am Marmarameer für alle: Omas, Opa, Onkel und so weiter. Ich stelle mir das Haus vollgestopft bis unters Dach vor. Vollgestopft mit Anverwandten und Möbeln, Fotos, Erinnerungen. Schön.
Selma, die in meiner neuen Schule eine Menge Kurse zusammen mit mir hat, sieht aus, als habe sie ebenfalls eine Menge Besitztümer. Bestimmt Sachen wie einen eigenen Fernseher, viele CDs und DVDs, vielleicht sogar Bücher, aber auf jeden Fall Schränke voll Klamotten und Schminksachen und Schmuck. Beneidenswert.
Oya und ich haben jede zwei Reisetaschen voll, was bedeutet: ein paar Anziehsachen, je ein eher schon antiker Laptop, ein paar Fotos, einige Bücher in verschiedenen Sprachen, ein bisschen staubigen Diesunddaskleinkram. Und dann natürlich Billyboy. That’s it. Wer so viel umzieht wie wir, kommt nicht dazu, erwähnenswerte Besitztümer anzusammeln …
»Es war auszuhalten«, beantwortete ich Oyas Frage nach meinem Schultag. »Und bei dir?«
Oya zuckte mit den Schultern. »Öde«, sagte sie und durchsuchte ihren Laptop schon wieder nach der verloren gegangenen E-Mail-Adresse ihrer schwedischen Brieffreundin. »Allerdings haben wir einen Lehrer in Bildhauen, der angeblich aussieht wie Brad Pitt. Ich finde das ja etwas übertrieben, aber er sieht schon nicht schlecht aus. Mr Walenta. Weil er so hot ist, wollten ihn bei der Wahl viele als Vertrauenslehrer, wurde mir berichtet. Aber es hat nicht geklappt. Stattdessen hat mein neuer Geschichtslehrer, der angeblich die totale Schnarchnase ist, den Posten bekommen. Ein Mr Rosen. Er ist dieses Jahr mein Ansprechlehrer. Tja, Pech gehabt.«
Oya vertiefte sich wieder in ihren Laptop.
Kurz darauf kam unsere Mutter nach Hause, also: in das neu gemietete, lichtarme Dreizimmerhaus am Ende der Sunland Road.
»Was hast du?«, fragte ich, als ich ihre Miene sah.
»Nichts. Nur Jobprobleme«, antwortete Rabea und warf einen Blick in unseren, wie immer, recht karg gefüllten Kühlschrank. »Es läuft nicht so gut, wie ich gehofft hatte«, fügte sie erklärend hinzu, während sie Makkaroni mit Käse für uns machte.
Um es kurz zu erklären: Vereinbart war gewesen, dass Rabea die Kinderstation des städtischen Krankenhauses dieser Stadt anmalen sollte, Wand für Wand, ein netter Auftrag, der ein halbes Jahr regelmäßiges Einkommen bedeutet hätte. Aber im letzten Moment war der Job für sie geplatzt, die Klinik hatte sich umentschieden und setzte jetzt auf schlichte, aprikosenfarbene Wandbemalung, und die konnte natürlich ein ebenso schlichtes, gewöhnliches Malerunternehmen übernehmen. Dafür brauchten sie meine Mutter nicht.
»Idioten. Alles Idioten«, seufzte Rabea und strich sich die Haare aus der Stirn. Sie und ich sehen uns ähnlich. Oya, die Schönere, kommt angeblich nach Raymond, unserem verstorbenen Vater. Wir haben allerdings nur ein Bild von ihm in unserem Gepäck, um das zu beweisen, die meisten alten Sachen sind irgendwo im Nirvana verschwunden, als meine Mutter vom Dauerumzugsfieber gepackt wurde. Sie hat vieles weggeschmissen oder hier und da untergestellt und mit den Jahren vergessen, wo was.
»Jetzt habe ich finanziellen Leerlauf. Im Winter gehe ich dann, wie besprochen, in den Knast. Aber davor?«
Im Knast würde man sie nicht einsperren, sie sollte nur mit den Gefangenen dort malen. Einen Malkurs für Strafgefangene geben. Als Projekt. Die anglikanische Kirche dieser Stadt organisierte und finanzierte das.
»Mist. Mist. Mist«, murmelte Rabea sorgenvoll.
Der nächste Tag begann damit, dass ich eine Fliege einatmete, während ich eine Morgenmail von Achmed las. Angeekelt begann ich zu husten und mich zu räuspern und was man eben noch alles so macht, wenn man eine gewöhnliche Stubenfliege irgendwo in der Luftröhre stecken hat.
Aus der Küche drangen Kaffeemaschinengeräusche, aus dem engen, fensterlosen Badezimmer Oyaduschgeräusche. In der Diele klingelte das Telefon, und gleich darauf sprang unser Anrufbeantworter an. Wortfetzen drangen an meine Ohren, während ich immer noch hustete und würgte. Job-für-Rabea-Wortfetzen, so klang es.
»Und?«, fragte ich hoffnungsvoll, als ich in die Küche kam. Meine Stimme klang immer noch etwas belegt. »Wer war das? Worum ging es? Doch ein Job in Sicht?«
Ein paar erklärende Worte über die Mimik meiner Mutter:
Sie sieht annehmbar aus, wenn sie vergnügt ist. Wenn sie aufgedreht ist, Polka tanzt oder etwas Ähnliches tut. Wenn sie Ärger oder Sorgen hat, wird sie blass und ihr Gesicht unbewegt, ihr Mund ein Strich. Ein Maskengesicht. Sie hat öfter Sorgen und Ärger, als dass sie vergnügt und aufgedreht ist. Diese starre Miene an ihr ist ein sehr vertrauter Anblick. (Als kleines Kind habe ich mir oft vorgestellt, ihren Strichmund auszuradieren und ihr mit rotem Crayola-Wachsstift einen lachenden, frohen Mund zu malen.)
»Jemand vom City Council«, sagte Rabea mit angespannter, oben beschriebener Miene. Maskengesicht. »Sie wollen, dass ich statt der Kinderstation jetzt die Psychiatrische Abteilung anmale. Verdammter Mist, wenn du mich fragst.«
»Wieso? Ist doch egal, welche Station du anmalst, oder?«, fragte ich irritiert, während ich mir einen Tee machte und einen Sesambagel aufschnitt. Oya kam dazu, und wir setzten uns zu dritt an den Tisch. Wir redeten eine kurze Weile hin und her, weil wir nicht verstanden, warum Rabea so niedergeschlagen war und dem angebotenen Job so ablehnend gegenüberstand. Schließlich gab sie nach und versprach, die Sache zuzusagen.
»Obwohl ich nicht weiß, was ich da malen soll«, murmelte sie gereizt und verscheuchte Billyboy mit einem Klaps vom Tisch.
Oya warf mir einen vielsagenden Blick zu. Auf dem Weg zur Schule nahm sie den Faden, dessen Anfang dieser vielsagende Blick gewesen war, wieder auf.
»Wer weiß, wie lange wir diesmal bleiben«, murmelte sie düster. »Wie soll man sich einleben, wenn man doch immer nur auf der Durchreise ist?«
Ich gab keine Antwort, und darum redete Oya weiter. »Normalerweise war doch nach einem Umzug immer erst mal alles okay, wenigstens eine Weile, aber diesmal hat sie jetzt schon wieder diesen gehetzten Ich-will-weg-Blick drauf. Du hast es doch auch gesehen, oder?«
Es regnete, der Himmel war dunkelgrau, es war die passende Morgenfortsetzung zu einem Tag, der mit einer Fliege in der Luftröhre begonnen hatte. Wir erreichten den weitläufigen Schulhof unserer neuen Highschool, der Regen wurde stärker, und mich lächelte ein Junge an, der mit mir in Mathe, Literatur und Spanisch ging. Dean, wenn ich mich nicht irrte. Er saß in Englischer Literatur einen Tisch hinter dieser Selma und mir.
»Was machst du für ein betrübtes Gesicht?«, erkundigte er sich. »Magst du keinen wilden Regen? – Wild rain, sozusagen. Mann, ich stehe voll auf so ein Wetter.«
Er deutete eine Spur verächtlich auf ein paar andere Seniors, die sich unter dem Vordach unseres Juniorspavillons drängten, um nicht nass zu werden.
»Deppen«, murmelte er. »Den Himmel gibt’s zum Unterstellen! Nicht das idiotische Vordach.«
Dann reichte er mir eine nasse Regenhand. »Darius Seaborn«, stellte er sich vor. »Falls du’s noch nicht weißt.«
Ach ja. Darius, nicht Dean. Und dazu ein beeindruckender Nachname. Wie Aphrodite, die Schaumgeborene. Besser als Armadillo, das … Egal.
»Kassandra«, sagte ich und fühlte mich auf einmal ganz eigenartig mit meiner Hand in seiner. Ich starrte diesen Darius an, er hatte blumenblaue Augen, die machten, dass mir kalt im ganzen Körper wurde, warum auch immer. Es war, als habe jemand oder etwas jeden Fizzel Wärme aus meinem Inneren gezogen. Von einer Sekunde zur nächsten. Ich spürte, dass ich auf einmal zitterte.
»He, was hast du?«, hörte ich ihn fragen, und in seinem Gesicht war ein merkwürdiger, erschrockener Ausdruck.
Anmerkung über das erste Mal:
Die ersten Schritte, Worte. Das erste allein gegessene Truthahnsandwich. Das erste Mal Fahrrad ohne Stützräder in der Auffahrt fahren. Wahnsinn. Crazy. Kamera raus! Es gibt viele erste Male: Meine erste Erinnerung an diese schwarze Wolke, mein erster Albtraum, in dem ich an ihr erstickte, lag Jahre zurück. Und jetzt: Zum ersten Mal kam die Wolke am Tag und erstickte mich bei vollem Bewusstsein. Unter Menschen, die dabei zusahen. Darius und Oya und die anderen Seniors unter dem Vordach.
Am
Helllichten
Tag.
Im Regen.
Auf dem Schulhof dieser neuen Highschool, während meine Hand, inzwischen gefühllos und kalt, schlaff in der Hand dieses Darius Seaborn mit den blauen Augen lag.
Die Dunkelheit kam auf einen Schlag. Die Wolke verschluckte jedes Licht um mich herum. Wie ein Tornado. Sie überfiel mich und ließ mich in die Knie gehen, presste meine Stirn auf den harten Asphalt, ließ mich Darius‘ Hand loslassen. Die Wolke war wie immer wahnsinnig laut. Sie brüllte. In meinen Ohren. In mir. Überall.
»Kassandra!«, schrie Oyas Stimme dazwischen wie aus weiter Ferne. »Kassandra!«
Ich hatte das Gefühl, weinen, schreien zu müssen, aber ich war wie erstarrt, rührte mich nicht mehr. Versank nur in der tosend lauten Dunkelheit und presste den Mund fest zu.
Jemand streichelte meine Stirn, die heiß war. Oder kalt? Ich konnte es nicht richtig spüren. Wo war ich? Mühsam öffnete ich die Augen.
Da war Oya. Sie sah zu Tode erschrocken aus. Aber es war nicht ihre Hand, die mich gestreichelt hatte.
»Kassandra?«, fragte der fremde Mann. Seine Stimme klang besorgt und behutsam. Fast so, als spräche er mit einem sehr kleinen Kind.
»Kassandra? Geht es dir wieder besser?«
Ich schaute mich verwirrt um.
»Das ist das Schulbüro«, erklärte der Mann, der meinen Blick gesehen hatte. »Ich habe dich hochgetragen, nachdem du ohnmächtig geworden bist.«
»Ohnmächtig?«, flüsterte ich.
Oya und der fremde Mann nickten.
»Ich bin übrigens Elija Rosen, Oyas Ansprechlehrer und außerdem Vertrauenslehrer dieser Schule«, sagte Mr Rosen. Er lächelte mir zu. Sein Lächeln glitt von seinen Lippen und wärmte für Sekunden mein kaltes, schmerzendes Gesicht. Neben seinem Gesicht tauchten weitere Gesichter auf. Wie es aussah, gehörten sie den beiden Schulsekretärinnen.
»Wir erreichen die Mutter nicht«, sagte eine von ihnen eine Spur ungeduldig. »Nicht auf dem Festnetz und nicht mobil.«
»Du sollst ins Krankenhaus. Untersucht werden«, erklärte Oya leise. »Oh Kassandra, was war nur los mit dir? Du bist einfach so zusammengebrochen. Ohne einen Mucks von dir zu geben. Es war so – unheimlich.«
Die Wolke, dachte ich. Aber die Wolke war nur meine Wolke, nachts wie tagsüber. Außer mir sah und vor allem fühlte sie niemand.
Ich richtete mich auf.
»Ich … ich bin in Ordnung«, sagte ich, während sich ein eiserner Ring aus Gereiztheit um meinen Kopf legte, der mir Kopfschmerzen bereitete. Warum hatte mich mein Albtraum derart bloßgestellt? Wie konnte man einen solchen Traum am Tag träumen, während man die Augen offen hatte und bei vollem Bewusstsein war? Ich war mir sicher, nicht wirklich ohnmächtig gewesen zu sein. Es war wie nachts, nur dass ich da alleine war und dass ich da sowieso lag und nicht einknicken musste unter dem Druck der brüllenden, erstickenden Wolke. Ich war einfach still und benommen gewesen, weiter nichts. Vielleicht weggetreten, vor allem aber gelähmt vor Angst und Entsetzen.
»Ich bin wieder in Ordnung, wirklich«, wiederholte ich. Aber mein Wort genügte ihnen nicht. Sie schafften mich ins Krankenhaus. Mr Rosen ging links von mir, Oya rechts, während wir zum Lehrerparkplatz liefen. Zuerst dachte ich, sie wollten mich tatsächlich stützen, aber dann ließen sie mich doch alleine gehen.
»Du blutest an der Stirn«, erklärte Oya, während wir in Mr Rosens Auto stiegen. Eine der Sekretärinnen hatte mir ein Taschentuch in die Hand gedrückt, ehe wir das Büro verließen, und Oya tupfte damit vorsichtig gegen die Schürfwunde an meinem schmerzenden Kopf.
»Hattest du so was schon öfter? Und ist es in Ordnung für dich, dass ich dich ins Krankenhaus begleite?«, fragte Oyas Ansprechlehrer, der Vertrauenslehrer dieser Highschool. Wir fuhren vom Parkplatz auf den Highway.
Ich schüttelte den Kopf und nickte. Zwei Fragen, zwei Antworten.
Im Krankenhaus röntgen sie meinen Kopf und stellten mir Fragen. Zuerst fragten sie, ob Mr Rosen mein Vater sei.
Nein, war er nicht.
Nein, es gab, soweit ich wusste, keine Epilepsie in meiner Familie.
Der Tod meines Vaters? Nein, kein Hirntumor.
Nein, mir war nicht schwindelig gewesen. Nein, auch jetzt war mir nicht schwindelig.
Meine Reflexe, das Röntgenbild, meine Blutwerte, mein Gewicht. Alles war in Ordnung. Man schob es auf meinen Kreislauf, aber ich bekam dennoch einen Termin für eine gründliche Kernspin-Untersuchung in der kommenden Woche.
Dann durfte ich endlich gehen.
Mr Rosen fuhr uns nach Hause. Oya sollte mich begleiten und bei mir bleiben, bis meine Mutter zurück wäre.
»Gute Besserung«, sagte er zum Abschied und lächelte mir aufmunternd zu.