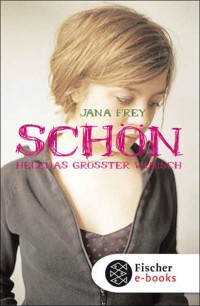Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Sofia ist 14 Jahre alt und lebt auf der Straße. Schnell muss sie begreifen, dass sich auch hier die Hoffnung auf Freiheit für sie nicht erfüllt. Stattdessen wird ihr Alltag ein einziger Kampf gegen Hunger, Sucht, Einsamkeit und purer Verzweiflung. Immer tiefer gerät Sofia in einen Teufelskreis, aus dem sie sich aus eigener Kraft nicht befreien kann. Doch dann lernt sie Ätze kennen.Einfühlsam erzählt Jana Frey die Geschichte eines deutschen Straßenkindes. So schafft sie Einblicke in eine Wirklichkeit die bewegt, schockiert und aufrüttelt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Epilog
Für Sofia
Diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Die Namen und Schauplätze sind von der Redaktion geändert.
Zu diesem Buch steht eine Lehrerhandreichung zum kostenlosen Download bereit unter
Prolog
Es gibt Hunderttausende von Straßenkindern, fast verrückt vor Hunger und Einsamkeit und Sinnlosigkeit in allen Ländern der sogenannten Dritten Welt.
Es gibt Hunderttausende von Straßenkindern in den Elendsvierteln von New York und Los Angeles in Amerika. Es gibt ebenso viele Straßenkinder auf den Straßen von Moskau und Sankt Petersburg in Russland.
Aber auch in Europa gibt es Straßenkinder. Und in Deutschland. Sie leben in Berlin und Hamburg und Frankfurt und Leipzig und in vielen anderen deutschen Städten.
Manche Schätzungen über Kinder auf Deutschlands Straßen belaufen sich auf fünfstellige Zahlen, Tendenz steigend.
Ich lerne Sofia in München kennen. Wir treffen uns in einem Café an der Isar. Ich weiß bis zu diesem Tag nicht viel von ihr. Ich weiß lediglich, dass sie fast zwei Jahre lang obdachlos in ihrer Heimatstadt gelebt hat und dass sie, als sie von zu Hause fortlief, gerade erst vierzehn Jahre alt gewesen ist.
„Hier bin ich“, sagt sie zögernd, als sie vor mir steht. Sie ist allein gekommen und sie setzt sich mir nervös gegenüber. Wir bestellen uns etwas zu trinken und dann fangen wir an zu reden.
Sofias Gesicht ist blass und ernst und nachdenklich. „Ich verstehe wirklich nicht, warum du gerade etwas über mein Scheißleben schreiben willst“, sagt sie einmal zwischendurch.
Und ein anderes Mal sagt sie: „Ich hasse es eigentlich, über mich zu reden. Ich hasse diesen ganzen Mist, der meine Vergangenheit ist.“ Aber wir reden trotzdem weiter, den ganzen Nachmittag über und dann noch an vier weiteren Nachmittagen.
Beim Erzählen will Sofia am liebsten immer herumlaufen, an der Isar entlang, über Wiesen und durch Parks oder einfach mitten durch die laute Innenstadt.
„Ich kann mir das Herumlaufen nicht mehr so richtig abgewöhnen“, erklärt sie mir verlegen. „Ich brauche Bewegung und viel Unruhe um mich herum, um das Leben auszuhalten.“
Also laufen wir herum und Sofia erzählt mir aus ihrem Leben. Von früher und von ganz früher und von heute und von ihren Wünschen für die Zukunft.
„Von meiner Kindheit habe ich gar nichts mehr“, sagt sie traurig. „Keine Fotos und keine alten Tagebücher und keine aufgehobenen Stofftiere, nichts. – Nur meine Erinnerungen, und die sind schrecklich …“
1
Rund um unser Haus waren rote Backsteinmauern. Der Garten zwischen dem Haus und den Mauern war klein und ordentlich und langweilig. Die hohe Mauer schützte unsere Familie vor den neugierigen Blicken der Nachbarn. Dabei gab es bei uns gar nichts zu sehen, zu erspähen, zu beobachten.
Höchstens meine Mutter beim Wäsche auf- und abhängen, denn der nassen Wäsche gehörte unser Garten. Zum Spielen war er nicht.
Ich habe meine Mutter schon fast zwei Jahre nicht mehr gesehen, meine schöne, blasse, gereizte Mutter mit den sonderbar grünen Augen in ihrem misstrauischen, verschlossenen Gesicht. Auf der Nase und unter den Augen hat meine Mutter eine Menge Sommersprossen, die sie sich morgens vor dem Spiegel sehr sorgfältig zupudert. Sie hasst ihre Sommersprossen, dabei sehen sie schön aus, wirklich schön.
Meine Mutter ist überhaupt sehr schön, das habe ich oft gehört in meinem Leben. Sie ist dünn und sieht ein bisschen zerbrechlich aus, und dann hat sie dieses helle, schmale Gesicht mit den grünen Augen. Ihre Haare sind weich und lockig und dunkelblond, und ihre Haut ist makellos und glatt.
Meine Mutter wurde – wie ich – im Sommer geboren.
Als ich auf die Welt kam, war sie gerade sechzehn geworden.
Ich wusste bis vor knapp drei Jahren nichts von meinem Vater und nichts von den Umständen meiner Geburt.
Ich wusste deshalb nichts darüber, weil meine Mutter mit mir nicht sprach.
Unser Garten gehörte der nassen Wäsche und die nasse Wäsche war die Lieblingsbeschäftigung meiner Mutter. Die roten Sachen hingen ausschließlich bei den roten Sachen, festgesteckt mit roten Wäscheklammern. Die blauen Sachen hingen bei blau, festgesteckt mit blauen Klammern. Die grüne Wäsche flatterte, umgeben von anderer grüner Wäsche, an grünen Klammern, und genauso war es mit der gelben und der weißen Wäsche. Alle anderen Farbtöne, für die es keine passenden Klammern gab, knipste meine Mutter ersatzweise mit braunen Holzwäscheklammern an die Leine.
Stundenlang beschäftigte sie sich mit der nassen Wäsche. Sie zupfte sie zurecht, befühlte sie während des Trocknens, und wenn es anfing zu regnen, hängte sie eben alles wieder ab und trug die feuchten Sachen klaglos hinunter in den Trockenraum und hängte sie dort erneut auf, nach Farben und Wäscheklammern sortiert.
Anschließend bügelte sie die Sachen akribisch und sortierte sie zurück in die Schränke. Jede Woche bezog sie sämtliche Betten neu und genauso oft wusch sie die Gardinen. Manchmal war sie so versunken in ihre Wäsche, dass sie, während die Waschmaschine lief, einfach davor stehen blieb und den ganzen Waschgang lang nichts anderes tat, als der brummenden, rauschenden Maschine beim Waschen zuzusehen. Sie vergaß dann das Mittagessen und den Rest des Haushalts und sogar meinen kleinen Bruder Robin.
Erst wenn ich aus der Schule kam, schreckte sie aus dieser merkwürdigen Erstarrung. Robin krabbelte dann meistens auf dem Boden herum und quengelte, als ob sie ihn schon eine Ewigkeit nicht beachtet hätte, und auf dem Küchentisch stapelte sich noch das Geschirr von unserem Frühstück.
„Mama, ich bin zu Hause, es ist Mittag“, erinnerte ich sie vorsichtig. Da zuckte meine Mutter zusammen, strich sich die schönen, ordentlichen Haare aus dem Gesicht, warf mir einen ärgerlichen Blick zu und zwang sich mühsam zurück in den Alltag.
Wir waren nach außen hin eine ganz normale Familie, eine Durchschnittsfamilie. Meine Mutter heißt mit Vornamen Franziska und sie kann Geige spielen, aber sie tut es nie. Außerdem hat sie zwei Kinder geboren, mich und meinen kleinen Bruder Robin. Zwischen Robin und mir liegen elf Jahre, und als meine Mutter schwanger mit ihm war, sagte sie oft zu den Leuten, dass dieses Kind nun hoffentlich ein Junge würde, da sie auf keinen Fall noch ein Mädchen haben wolle.
„Sofia ist ein schreckliches Kind“, erklärte sie jedem, der es hören wollte oder auch nicht, und sie gab sich dabei nicht einmal die Mühe, ihre Stimme vor mir zu senken, denn sie schonte mich niemals.
Als ich zum ersten Mal hörte, dass ich ein schreckliches Kind sei, stolperte ich verzweifelt in mein Zimmer und verkroch mich in meinem Bett, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste weinen, aber dann weinte ich doch nicht. Ich weine nie, ich kann es einfach nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, denn manchmal fühlt es sich so an, als würden die Tränen schon hinter meinen Augen brennen, aber sie kommen eben nie hervor. Früher habe ich manchmal leise gewimmert stattdessen, wenn ich traurig war, aber dieser Ton ging meiner Mutter auf die Nerven.
„Hör mit dem Gefiepse auf, du bist doch kein Meerschweinchen“, sagte sie ungeduldig.
Meine Mutter bekam Robin vor fünf Jahren. Er sah aus wie ein kleiner, lichter Engel. Meine Mutter trug ihn als Säugling stundenlang durch unser Haus und ermahnte mich, leise und noch leiser und noch viel leiser zu sein, um Robins Schlaf zu schützen und um Robin keine Angst zu machen und um Robin nicht lästig zu sein.
„Er ist so niedlich“, flüsterte ich meiner Mutter zu und wollte meinen kleinen Bruder streicheln.
Sie nickte, aber dann nahm sie Robin auf den Arm und streichelte sein schlafendes Babygesicht selber. Ich schaute ihr dabei zu. Robin hatte von Anfang an die gleichen grün gesprenkelten Augen wie meine Mutter und dann bekam er nach und nach auch ihre schmale, geschwungene Stupsnase und ihre weichen, feinen Haare und sogar ihre goldenen Sommersprossen. Er sah so niedlich aus, dass ich ihn immerzu anschauen musste.
„Steh mir nicht im Weg, Sofia“, sagte meine Mutter ungeduldig und schob mich zur Seite. Ihre Hand an meinem nackten Arm fühlte sich kalt und hart und ärgerlich an.
„Ich will doch bloß zuschauen“, murmelte ich benommen, schlich mich davon und verkroch mich im Badezimmer, dem einzigen Raum im Haus, in dem es einen Schlüssel zum Abschließen gab. Ich stellte mich vor den Spiegel und betrachtete traurig mein Spiegelbild. Kein Wunder, dass meine Mutter Robin lieber hatte als mich. Alles an mir war falsch und verkehrt. Ich habe so dunkle Haare, dass die Leute auf der Straße mich manchmal für eine Ausländerin halten, und meine Haare sind nicht nur schwarz, sie sind auch spröde und unordentlich. Selbst wenn ich sie ganz glatt kämme, sehen sie gleich darauf wieder wirr und zerzaust aus. Jedes einzelne Haar ist widerborstig wie Pferdemähnenhaar. Meine Augen sind pfützengrau und meine Haut ist eine ganze Spur dunkler als die Haut meiner Mutter oder als Robins helle Babyhaut.
„Du siehst aus wie eine kleine Zigeunerin“, sagte meine Oma aus Kiel manchmal kopfschüttelnd, wenn sie uns besuchen kam. Es klang nicht sehr freundlich.
Die Oma aus Kiel ist die Mutter meines Stiefvaters. Mein Stiefvater heißt Karl und er besitzt eine kleine Firma für Elektronikwaren. Seit meine Mutter und Karl geheiratet hatten, lebten wir in diesem Haus am Stadtrand.
Vorher wohnten meine Mutter und ich in einem weißen Hochhaus mitten in der Stadt. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, aber ein paar Dinge, die damals passiert sind, habe ich noch im Kopf, ziemlich wirr und unsortiert und wie in Nebel verhüllt.
Ich weiß, wir wohnten damals sehr hoch oben, Schwindel erregend weit oben. Und außer meiner Mutter und mir waren da noch meine Großeltern. Meine Oma war die Mutter meiner Mutter und sie war genauso streng und gereizt und ungeduldig mit mir wie Franziska. Ich erinnere mich daran, wie ich einmal meine Hand auf ihren Rock legte. Sie schob mich sofort zur Seite und schimpfte, ich hätte ihren Rock mit meinen schmutzigen Kleinkinderfingern beschmiert.
Mein Opa aber war gut zu mir. Sein Name war Waldemar und ich nannte ihn auch so, während ich zu meiner Großmutter immer Oma sagte. Ich glaube, Waldemar war der zweite Mann meiner Oma, also im Grunde ebenso mein Stiefgroßvater wie Karl mein Stiefvater ist.
Waldemar nahm mich oft an der Hand und ging mit mir zum Spielplatz und er hob mich dort auf die höchste Rutsche und wippte stundenlang mit mir auf einer windschiefen, knarrenden Holzwippe, nur weil ich das so gerne hatte. Abends sang er mir Lieder vor und deckte mich sorgfältig zu.
Damals, in diesem weißen Hochhaus, hatte ich bereits ein großes Problem. Ich war ein Schandfleck und ein Ärgernis.
„Sofia, wenn du heute Nacht wieder ins Bett machst, gibt es Haue!“, sagte Franziska jeden Abend und schaute mich mit einem Blick an, von dem mir ganz kalt wurde. Damals war meine Mutter gerade neunzehn geworden.
Ich war drei und ich machte jede Nacht ins Bett.
Egal, ob sie mir drohten. Oder mir auf den Po schlugen. Oder mich auf unserer Toilette einsperrten. Oder mich stundenlang zwangen, auf meinem Plastiktöpfchen zu sitzen.
Immer wieder wachte ich mitten in der Nacht auf und immer war mein Bett kalt und nass und klamm. Manchmal schlich ich mich dann ins Schlafzimmer meiner Großeltern und kroch zu meinem Opa ins Bett, aber das war verboten, streng verboten. Denn meine Mutter und meine Oma hatten bestimmt, dass ich in meinem nassen Bett bleiben musste, und erst am Morgen durfte ich es verlassen und dann bekam ich auch einen festen Schlag mit dem Holzkochlöffel auf den nackten Po.
Doch eines Morgens im Sommer, als ich in die Küche schlich, kümmerte sich keiner um mich. Denn an diesem Morgen wurde meine Oma krank, ich glaube, sie hatte einen Schlaganfall. Sie saß einfach in der Küche und schaute mich sonderbar starr und geisterhaft an. Ihr Mund war merkwürdig schief, es sah so aus, als wäre er versehentlich zu ihrem Kinn heruntergerutscht, und sie zischte mir etwas zu, was ich nicht verstand.
Dann kam ein Krankenwagen und brachte meine Oma fort und ich sah sie nicht mehr wieder. Ich glaube, sie lebte noch eine Weile in einem Pflegeheim, aber meine Mutter nahm mich niemals dorthin mit. Aber dafür tat sie etwas anderes. Sie zwang Waldemar, bei uns auszuziehen.
„Nein, nein, nein“, schrie ich, als Waldemar mit gepackten Koffern aus unserer Wohnung ging.
„Nicht weinen, mein trauriges Häschen“, sagte Waldemar und streichelte mein nasses Gesicht, denn damals weinte ich noch.
Dann war Waldemar fort und es sollte über acht Jahre dauern, bis ich ihn wiedersah.
Meine Mutter und ich blieben allein zurück. Es war Winter und draußen schneite es. Meine Mutter suchte sich eine Arbeitsstelle in einer Reinigung, wo sie an der Kasse die gereinigte Wäsche aushändigte und abkassierte.
Mich brachte sie morgens in einen lauten Ganztagskindergarten. Ich machte immer noch nachts ins Bett und immer noch bekam ich Schläge deswegen. Aber ansonsten berührte mich meine Mutter so gut wie nie. Ich wurde fünf und schon lange zog ich mich morgens alleine an, putzte mir alleine die Zähne, schmierte mir mein Frühstücksbrot selbst und betrachtete meine missmutige und unnahbare Mutter nur vorsichtig aus der Ferne.
„Kannst du eigentlich nicht lachen, Mama?“, fragte ich sie einmal.
Ich glaube, meine Mutter gab mir nicht mal eine Antwort auf diese Frage, stattdessen wusch sie Wäsche.
Sobald in der Reinigung ihre Schicht erledigt war und sie mich aus dem Kindergarten abgeholt hatte, sortierte sie zu Hause eilig und unruhig unsere eigene Wäsche, denn alles wurde ununterbrochen gewaschen. Sie stopfte die Sachen, die im Grunde niemals richtig schmutzig wurden, nacheinander in die Maschine, und während der erste Wäscheberg gerade begann, sich im schaumigen Wasser zu drehen, wartete sie bereits ungeduldig darauf, mit dem Aufhängen anfangen zu können. Sie stand vor der brummenden Maschine, so wie sie es noch viele Jahre lang tun würde, und starrte auf das Bullauge in der Mitte des Geräts, als sähe sie dort das Zentrum der Welt.
„Mama, wo ist Oma?“, fragte ich einmal vorsichtig.
„Sie ist gestorben, das weißt du doch“, murmelte meine Mutter.
„Und wo ist Waldemar?“, fragte ich flehentlich.
„Fort“, war die knappe Antwort.
„Ich will ihn besuchen.“
„Nicht jetzt, Sofia.“
„Wann, Mama?“
„Mal sehen.“
Aber wir besuchten Waldemar niemals.
Wenn meine Mutter nicht in der Reinigung stand und auch nicht mit unserer Wäsche beschäftigt war, telefonierte sie. Obwohl uns so gut wie nie jemand besuchen kam, schien sie eine Menge Leute zu kennen.
„Ich würde gerne mit euch kommen, aber ich kann ja hier nicht weg – wegen Sofia“, seufzte sie oft in den Telefonhörer hinein und ihre Stimme klang eisig vor unterdrückter Wut und Ärger. In solchen Momenten legte ich tröstend meine Hände auf mein wild klopfendes Herz. Ich begriff bereits seit einer Weile, welche Last ich für meine Mutter war.
„Du hast schöne Augen, Mama“, sagte ich einmal, um ihr eine Freude zu machen.
„Unsinn“, fauchte meine Mutter und ihre Stimme klang augenblicklich böse.
Ich zuckte zusammen und schwieg. Erst viel, viel später fand ich heraus, warum meine Mutter damals so zornig wurde, als ausgerechnet ich sie auf ihre großen, feenhaften Augen ansprach.
Irgendwann einmal fiel mir auf, dass es da etwas gab, was andere Kinder hatten, ich aber nicht – einen Vater. Überall begegneten mir Väter, auf dem Spielplatz, im Kindergarten und auf der Straße.
„Mama, warum habe ich eigentlich keinen Papa?“, platzte es darum eines Abends aus mir heraus, als ich bereits in meinem Bett lag und schlafen sollte.
Meine Mutter hob mit einem Ruck den Kopf und ich zuckte zusammen, als ich ihren Blick sah. Ich war mir sicher, dass sie gleich furchtbar mit mir schimpfen würde, obwohl ich nicht wusste, was so schlimm an meiner Frage war.
Aber merkwürdigerweise schimpfte sie diesmal nicht. Sie schaute bloß eine kleine Weile stumm vor sich hin mit diesem wilden, wütenden Blick.
„Du hast eben keinen Vater“, war alles, was sie schließlich sagte, ihre Stimme klang eigenartig dabei.
„Aber die Kinder im Kindergarten haben gesagt, jeder hat einen Papa“, beharrte ich stur.
„Bei uns gibt es jedenfalls keinen – Papa“, wiederholte meine Mutter, und dann ging sie abrupt zur Tür. „Schlaf jetzt, Sofia, und denk dran, was passiert, wenn du wieder ins Bett machst!“
„Aber wenn ich einen Papa hätte, hätte er mich dann lieb?“, rief ich ihr unsicher hinterher.
„Sicher“, sagte meine Mutter. „Aber jetzt will ich nichts mehr hören.“
„Hätte er mich so lieb wie Waldemar oder so lieb wie du?“, schrie ich ängstlich, aber meine Mutter gab mir keine Antwort mehr. Da rollte ich mich unter meiner Bettdecke zusammen und weinte, bis mein ganzes Kissen nass war.
Und von diesem Tag an begann ich, mich nach meinem unbekannten, fremden Vater zu sehnen.
Und dann kam eines Tages Karl, ein lustiger, großer Mann mit zentimeterkurzen, blonden Haaren und himmelblauen Augen. Er schenkte mir einen kleinen Kassettenrekorder und drei Märchenkassetten. Dafür nahm er meine Mutter am Abend mit ins Kino.
„Wir werden umziehen, Sofia“, erklärte sie mir schon bald darauf. „Karl wird von jetzt an dein Papi sein.“
Wir schauten uns an, richtig an. Schon das war eine Besonderheit, denn sonst schaute mich meine Mutter so gut wie nie an. Zumindest nicht wirklich.
„Er wird mein Papi sein?“, flüsterte ich beeindruckt.
Meine Mutter nickte und ich spürte, wie ich mich von Kopf bis Fuß zu freuen begann.
Und dann zogen wir in dieses rote Backsteinhaus am Stadtrand.
Aber es wurde nicht schön, wenigstens nicht für mich. Karl war nur selten zu Hause, und wenn er da war, wollte er mit meiner Mutter alleine sein. Aber ich bekam ein schönes Zimmer im Dachgeschoss, auch wenn es außer mir fast nie jemand betrat.
Bald darauf kam ich in die Schule. Und obwohl meine Mutter nicht mehr in der Reinigung arbeitete, schickten sie mich vom ersten Schultag an in einen Kinderhort.
„Ich will da nicht sein“, bat ich zu Hause vorsichtig.
„Hör auf zu fiepsen, du weißt, dass ich das nicht leiden kann“, sagte meine Mutter, die damals sehr oft krank war.
„Warum bist du schon wieder im Bett?“, fragte ich sie einmal besorgt.
„Das geht dich nichts an“, erwiderte meine Mutter und schickte mich aus dem Zimmer.
An meinem achten Geburtstag war meine Mutter wieder krank und kam, wie so oft in der letzten Zeit, für ein paar Tage ins Krankenhaus.
Ich lag morgens in meinem Bett und schaute traurig zu meinem schrägen Dachlukenfenster hinauf. Die Sonne schien herein und in den hellen, warmen Sonnenstrahlen, die sich bis zu meinem grauen Teppich hinunter ausdehnten, tanzte glitzernd eine Menge winziger Staubflocken. Das sah schön aus, auch wenn es nur Staub war, der da funkelte.
Unten in der Küche hörte ich die Stimmen meines Stiefvaters und seiner Mutter aus Kiel. Oma kam jedes Mal, wenn meine Mutter im Krankenhaus lag. Sie schienen gerade über sie zu sprechen, denn ich hörte ein paar Mal, wie meine Stiefoma ihren Namen nannte. Auf Zehenspitzen schlich ich mich zur Tür.
„… fünfmal war Franziska jetzt schon schwanger“, rief die Kieler Oma gerade verärgert.
„Tja, die Ärzte im Krankenhaus wissen auch nicht, warum sie die Babys immer wieder verliert“, antwortete mein Stiefvater und seine Stimme klang genauso verärgert.
„Es ist ein Jammer“, fuhr die Kieler Oma missmutig fort. „Wo ich so gerne ein eigenes Enkelkind hätte.“
Ich war erschrocken und verstand nicht ein Wort. Meine Mutter war fünfmal schwanger gewesen? Wieso hatte ich das denn gar nicht mitgekriegt? Man bekam doch einen runden Kugelbauch, wenn man schwanger war. Eine Menge Kinder in meiner Klasse hatten kleine Geschwister, ich hatte schon viele schwangere Frauen gesehen. Und was sollte das bedeuten, dass meine Mutter Babys verlor? Wie konnte einem das passieren? Merkte man das denn nicht? Und fielen die Babys dann einfach irgendwie auf die Erde und blieben dort liegen?
„Ob diese schreckliche Geschichte mit Sofia schuld daran sein kann?“, fragte die Kieler Oma in diesem Moment nachdenklich.
„Die Ärzte sagen nein“, antwortete Karl knapp.
Ich lehnte verwirrt an meiner Tür und mir wurde so kalt, dass ich zitterte. Was für eine schreckliche Geschichte gab es denn da mit mir? Was hatte ich verbrochen? Konnte ich denn schuld daran sein, dass meine Mutter Babys verlor?
„Arme Franziska“, rief die Kieler Oma. „Es wäre wirklich für alle besser gewesen, wenn sie Sofia verloren hätte und nicht all die Kinder, die sie heute mit dir haben könnte, Karl.“
„Das sagt Franziska auch“, antwortete Karl und dann rief er nach mir, und ich musste zum Frühstück herunterkommen.
Es war mein achter Geburtstag und es war ein Sonntag, sodass ich nicht einmal in die Schule entfliehen konnte. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich ein Geschenk bekam, aber ich weiß noch, dass mich an diesem Tag niemand besuchen durfte, nicht einmal Anna, die im Nachbarhaus wohnte und ein bisschen so etwas wie meine erste Freundin war. Aber Karl und die Kieler Oma wollten keinen Lärm im Haus haben.
„Ich könnte ja für eine Weile zu Anna hinübergehen“, bat ich.
Aber das erlaubte Karl auch nicht, denn von Annas Eltern, die aus Polen stammten, hielt er nichts. Karl mochte überhaupt keine Ausländer und meine schwarzen Haare gefielen ihm aus diesem Grund ebenfalls nicht. Das hatte er mir oft genug gesagt.
Als meine Mutter endlich aus dem Krankenhaus zurückkam und blass und geisterhaft und unruhig im Haus herumging, hielt ich es bald nicht mehr aus.
„Mama, verlierst du Babys?“, flüsterte ich ihr zu, als wir endlich mal alleine miteinander waren.
Meine Mutter schaute mich für einen kurzen Augenblick richtig an. „Was … woher … wie kommst du auf so …?“, fragte sie tonlos.
Ich zog die Schultern hoch. „Die Kieler Oma hat es gesagt und …“
„… du belauschst also die Gespräche Erwachsener, Sofia?“, unterbrach mich meine Mutter.
Ich schüttelte eilig den Kopf. „Nein, aber sie hat außerdem gesagt, ich bin eine schreckliche Sache“, stieß ich hastig hervor, ehe mir meine Mutter einen ihrer bösen Klapse geben konnte.
Aber dann kam dieser Schlag doch und eine Antwort erhielt ich nicht, dafür jedoch eine Woche Zimmerarrest von Karl, der am Abend, als er nach Hause kam, mit mir schimpfte.
Zu dieser Zeit dachte ich noch, mein Leben wäre ganz normal. In der Schule war ich brav und meiner ersten Klassenlehrerin gefiel das. Ich bekam gute Noten und gute Zeugnisse. Die anderen Kinder spielten zwar nicht besonders viel mit mir, aber sie ärgerten mich auch nicht.
Und ich hatte eine Freundin: Anna. Bei Anna im Nebenhaus war es allerdings ganz anders als bei uns: Anna wurde niemals geschlagen und ihre Mutter spielte oft mit ihr, und in der Weihnachtszeit backte sie mit Anna Plätzchen und sie sangen polnische Weihnachtslieder zusammen. Im Sommer gingen Anna und ihre Eltern gemeinsam ins Freibad oder sie machten Ausflüge ins Museum, zu Burgen und Schlössern und in den nahen Wald. Ich beneidete Anna zwar, aber ich dachte, das müsse eben daran liegen, dass ihre Eltern aus Polen stammten, und dort ging man vielleicht anders mit seinen Kindern um als hier bei uns in Deutschland.
„Faules Ausländerpack“, sagte Karl oft angewidert. „Woher die das Geld haben, um sich so ein feines Leben leisten zu können, ist mir schleierhaft. Diese Polaken sind doch alle nur Gangster und Proleten …“
Ich weiß nicht mehr genau, wie es kam, aber eines Tages verboten mir Karl und meine Mutter den Umgang mit Anna und ihrer Familie.
Ich verkroch mich an diesem Nachmittag verzweifelt in meinem Zimmer.
„Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie …“, flüsterte ich unter meiner Bettdecke, weil ich an Anna und ihren Eltern hing, weil Annas Vater ein lustiger, vergnügter Vater war, der sich darüber freute, wenn ich zu Besuch kam, und der mich sogar einlud, an ihren Ausflügen teilzunehmen.
„Wir freuen uns immer, wenn du mitkommst, Sofia“, sagte er oft und zwinkerte mir zu. Und Annas Mutter, die noch nicht so besonders gut deutsch sprechen konnte, drückte mich sanft an sich und lächelte mir zu.
„Wenn ich dich noch einmal bei den Polaken im Garten erwische, sperre ich dich in den Keller“, erklärte Karl am Abend und schaute mich streng an.
Eine Woche später erwischte er mich dort und er machte seine Drohung wahr. Er sperrte mich den ganzen folgenden Samstag in den Keller, während meine Eltern direkt über mir im Wohnzimmer zusammensaßen und den Tag miteinander verbrachten.
Damals wurde mir klar, dass mein Leben anders war. Und ich begann, es zu hassen.
Sieben Treppenstufen waren es bis in den Keller, sieben Treppenstufen und dann eine Holztür und dann eine grün lackierte Eisentür. Dahinter war der Kellerraum, in dem ich sitzen musste. Immer häufiger.
Der Raum hatte drei kleine, quadratische Fenster, die so hoch waren, dass ich mit meiner Nasenspitze an den unteren Rand der engen Gitterstäbe stieß, wenn ich mich direkt davor stellte.
Ich wurde neun und ich wurde zehn Jahre alt, und in den Keller musste ich, wenn sie mich dabei erwischten, wie ich frühmorgens mein nasses Betttuch heimlich und so leise wie möglich in den Wäschetrockner stopfte. Ich konnte nichts dagegen tun, immer noch kam es vor, dass ich nachts im Schlaf ins Bett machte. Es passierte zwar nicht mehr oft, vielleicht ein- oder zweimal im Monat, aber die Tage, die auf diese Nächte folgten, wurde ich zur Strafe in den Keller geschickt.
Und als ich in einer Rechenarbeit meine erste Fünf schrieb, musste ich ebenfalls dort hinunter.
Dabei schlossen sie mich niemals wirklich ein dort. „Abmarsch, zack, zack!“, sagte Karl nur und dann hatte ich zu verschwinden, bis sie mich wieder hinaufriefen.
Und wenn meine Mutter mal wieder diese Sache hatte, bei der sie ein Baby verlor, musste ich zwar nicht in den Keller. Aber ich musste in mein Zimmer und durfte mich nicht blicken lassen.
Ich merkte in der Zwischenzeit jedes Mal, wenn es wieder so weit war. Meine Mutter bekam dann diese Bauchschmerzen und übergab sich und hatte von einem Moment zum nächsten so schlimme Krämpfe, dass sie einfach in sich zusammensackte, was auch immer sie gerade tat. Einmal passierte es beim Mittagessen und einmal gleich morgens früh nach dem Aufstehen. Und einmal sogar, als sie mit Karl in einem Restaurant war. Jedes Mal fuhr ein Notarztwagen sie ins Krankenhaus und jedes Mal kam sie erst eine Woche später wieder, bleich und erschöpft und merkwürdigerweise immer bitterböse auf mich.
„Mama, ich kann doch nichts dafür, dass das passiert“, sagte ich einmal verzweifelt.
Meine Mutter schwieg und schaute an mir vorbei.
„Mama, du hast doch mich“, sagte ich tröstend und lehnte mich behutsam an ihre Schulter. Da fuhr sie herum und stieß mich mit einem Ruck von sich. „Ja, dich – dich – dich!“, schrie sie so laut, dass es mir in den Ohren und im Kopf und eigentlich überall wehtat, und dabei umklammerte sie meine Oberarme mit ihren Händen. „Aber dich habe ich ja vielleicht gar nicht haben wollen – du … du … du Ungeheuer!“
Ich stand ganz ruhig da, obwohl etwas in mir, und das konnte ich ganz deutlich sehen und fühlen, schreiend aus dem Haus rannte. Es war ein merkwürdiges, ein ganz und gar eigenartiges Gefühl. Ich rannte, dass der Wind um meinen Kopf herumwehte, ich war schreiend und schluchzend auf der Flucht, und gleichzeitig stand ich starr und steif und eiskalt im Wohnzimmer vor meiner Mutter, und meine Oberarme, die sie in der Zwischenzeit zum Glück wieder losgelassen hatte, schmerzten schrecklich.
„Geh in dein Zimmer, Sofia!“, schluchzte meine Mutter und wendete sich ab. „Es tut mir leid, dass ich das … ich meine, ich wollte das nicht sagen … ich kann nicht anders, Sofia. Geh hoch, ich brauche Ruhe …“
„Ich bin ja schon draußen“, sagte ich seelenruhig, denn ich war doch davongerannt. Ich fühlte mich ein bisschen gespenstig, aber durchaus nicht schlecht. Leicht und leer.
„Ich kann es einfach nicht ertragen, dich anzuschauen, Sofia“, murmelte meine Mutter und ging davon.
Ich lächelte ihr hinterher und verließ langsam, in winzigen Schritten, das Haus.
In dieser Nacht kam ich zum ersten Mal nicht nach Hause. Zuerst blieb ich noch in unserer Straße und fühlte mich immer noch so leicht und heiter und unwirklich. Ich hatte das Gefühl, unsichtbar zu sein, und für einen Moment überlegte ich, ob ich das alles hier vielleicht nur träumte und in Wirklichkeit in meinem Dachzimmer im Bett lag und schlief.
Ich kniff mich in den linken Arm und es tat weh. Meine Oberarme taten allerdings ebenfalls weh. Als ich vorsichtig meinen Pulliärmel hochschob, waren dunkelrote Flecken auf meinen Armen zu sehen. Wo die wohl herkamen? Ich wusste es nicht.
Nach und nach entfernte ich mich weiter von unserem Haus, von unserer Straße. Ich lief und lief und lief. Der Himmel über mir wurde grau und obwohl ich mir vorgenommen hatte, in den Stadtpark zu gehen, den ich von den Ausflügen mit Annas Familie kannte, kam ich dort nicht an. Ziellos ging ich umher, durch fremde Viertel und über fremde Straßen. Der Himmel über mir wurde noch grauer und zu dem Grauen kam nun auch noch die Dämmerung.
Was hatte meine Mutter noch gesagt? Ich sei ein Ungeheuer? Ich irrte weiter und weiter, und es wurde dunkel und kalt, und als es schließlich ganz finster geworden war, blieb ich stehen. Ein Ungeheuer