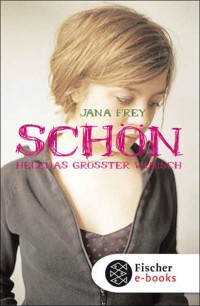
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
4.000 Euro für eine neue Nase? 30.000 Frauen im Jahr unterziehen sich in Deutschland einer Schönheitsoperation, darunter zunehmend junge Mädchen! Auch für Helena steht fest: Sie hat kein Glück gehabt, als die Gene verteilt wurden. Warum musste sie ausgerechnet das hässliche Kinngrübchen von ihrem Vater erben? Und eine Himmelfahrtsnase ist allenfalls niedlich, aber nicht schön – und sie lässt sich nicht kaschieren. Helena mag sich selbst nicht mehr anschauen. Soll sie sich unters Messer wagen? »Jana Freys Romane haben die Qualität einer literarischen Reportage: genau im Detail, bewegend geschrieben, ohne sentimental zu werden.« FRANKFURTER RUNDSCHAU »Mit Bildern einer niemals simplen Sprache schafft Jana Frey einen eindringlichen und zugleich aufwühlenden Realismus, der einen nicht loslässt.« SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Jana Frey
Schön – Helenas größter Wunsch
Roman
Umschlaggestaltung von Moni Port
Fischer e-books
generation www.fischergeneration.de
Liebes Leben, fang mich ein, halt mich auf der Erde, kann doch was ich bin nur sein, wenn ich es auch werde. Liebes Leben, abgemacht? Darfst mir nie verfliegen, hab noch so viel Mitternacht sprachlos vor mir liegen.
Konstantin Wecker, Liebes Leben
Schön. Schön. Schön. Schön. Schön. Schön. Schön. Schön.
Ein Sommer am Meer ist schön. Schönes Wetter ist schön. Sonnenblumen sind schön. Die Golden-Gate-Bridge in San Francisco ist schön. Und Venedig im letzten Herbst, als ich da war. Mette-Marit, die Prinzessin von Norwegen, ist auch schön. Und der Atlantik. Und Magnolien. Und der Film Pretty woman.
Paris im April ist ebenfalls schön, wunderschön. Flamingos sind schön, wenn sie sich gegenseitig anschauen und ihre rosa Köpfe und Hälse dabei zusammen wie ein Herz aussehen. Meine Schwester ist schön. Der Rosenteich in Monets Garten ist schön. Und meine Mutter. Und Miriam ist schön. Sie ist meine beste Freundin. Miss Marple, unsere rotgetigerte Katze, ist auch schön. Gewitter im August sind schön. Und buntes Laub im Oktober. Und Spinnennetze, wenn sie nach dem Regen in der Sonne glitzern. Wind in hohen Bäumen ist schön. Dahinwirbelnde Wolken. Und herumflatternde Schmetterlinge. Und Lagerfeuer. Und Schnee ist schön. Und glitzernde Seen. Und Segelschiffe. Volle Regentonnen, in die Wassertropfen tropfen. Und frisch angeschnittene Wassermelonen. Und Honigwaben. Und ein blühendes Rapsfeld. Und schwimmende Fische. Und die glitzernden Eiszapfen, die im Winter vor meinem Fenster hängen.
Nur ich bin nicht schön.
1
»Was ist los mit dir in letzter Zeit?«, fragt meine Mutter. Nichts, antworte ich.
»Was hast du nur die ganze Zeit?«, fragt meine Schwester. Nichts, habe ich geantwortet.
»Helena, ist irgendwas?«, fragt Miriam und streichelt Miss Marple. Nichts, sage ich.
Nichts. Nichts. Nichts.
Ich heiße Helena. Wie die schöne Helena aus der griechischen Mythologie. Die schönste Frau der Welt. Ihretwegen gab es den Trojanischen Krieg. Nur weil sie so schön war.
Aber ich bin nicht schön. Ich bin nicht die schöne Helena. Ich bin ich, und ich hasse mich dafür. Ich ersticke daran.
Meine Mutter ist schön. Meine Schwester Hannah ist schön.
Und ich?
Ich sehe aus wie mein Vater, mein fortgegangener, aus England stammender Vater. Das haben schon immer alle gesagt: Hannah sieht unserer Mutter ähnlich und ich Dylan, unserem Vater.
Ich bin groß, einen ganzen Kopf größer als Hannah. Meine Haare sind blond und immer wirr. Cocker-Spaniel-Haare. Und meine Augen sind graugrünbraun gesprenkelt.
»Wie Pfützenwasser«, hat Stefano, mein bester Freund, einmal gesagt, als wir noch Kinder waren.
Meine Haut ist so hell, dass ich schnell einen Sonnenbrand bekomme. Und nur schwer braun werde.
Einmal waren wir mit der Klasse in einem Freizeitpark. Das war in der siebenten Klasse, vor zwei Jahren. Dort gab es ein Gruselkabinett. Es quoll fast über vor Besuchern, ich quetschte mich zwischen Miriam und Stefano durch den engen Gang,
Frankenstein, Godzilla, eine kopflose Mumie, ein Werwolf und noch eine Menge anderer Gruselwesen. Und dann, ganz zum Schluss, diese drei Zerrspiegel …
Da war ich, im ersten Spiegel: riesig, bleich, mit wirren Haaren, schlackernden, grotesk langen Armen, die fast auf dem Boden zu schlenkern schienen. Mit weitaufgerissenen Augen stand ich da und starrte mich an. Ich starrte auf meine Nase, auf die Nase meines Vaters. Und auf unser Kinn. Sein Kinn und mein Kinn.
Ich war schrecklich erschrocken.
»Mann, wie wir aussehen, gruselig!«, rief Stefano im zweiten Spiegel und lachte. »Los, ein Foto! Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen … «
Er langte blitzschnell an einen roten Knopf an der Wand neben uns und drückte ihn. Es blitzte, aber da war ich schon geflohen.
»Mensch, Helena, du verwackelst ja alles!«, rief Stefano mir hinterher. Aber das war mir egal. Ich spürte, dass ich fast weinte, und ich beeilte mich, nach draußen zu kommen. Und als ich endlich draußen war, floh ich noch weiter und suchte mir eine Toilette, in die ich mich einschloss.
Mich und diese Nase und dieses Kinn.
Bestimmt eine halbe Stunde blieb ich in meinem Versteck. Wie erstarrt. Unfähig, mich zu rühren.
Das Foto hängt noch heute an Stefanos vollgestopfter Pinnwand über seinem Schreibtisch. Er und Miriam und ein fliehender, grauer, verwackelter Schatten, der ich bin.
Miriam im ersten Spiegel mit schlackernden Armen und einem grotesk langgezogenen Körper. Und Stefano, der nicht besser aussieht, einen schmalen, hohen Zerrspiegel weiter.
Sein grinsender Mund ist breit wie das Maul eines Breitmaulfrosches. Und seine vergnügt winkenden Arme dick und kurz und klumpig, wie kleine, fette Säcke, die an seinem wanstartig zusammengestauchten Oberkörper baumeln.
Und dann noch ich vor dem dritten Spiegel: nur eine Ahnung, ein verschwommener, flüchtender Schatten ohne Konturen.
Ohne meine Nase. Ohne mein Kinn.
Zum Glück, zum Glück, zum Glück.
Mein Vater hat uns verlassen, als ich gerade in die erste Klasse gekommen war. Er ist Theaterdramaturg und hatte sich damals in eine junge Schauspielerin verliebt. Eine schöne, junge Schauspielerin. Mit ihr ist er nach England gezogen, in einen Vorort von London, und mit ihr hat er zwei neue Kinder.
Bei Männern ist es wohl nicht so wichtig, wie sie aussehen. Und keines seiner neuen Kinder hat seine Nase geerbt. Oder sein Kinn.
Nein, ich bin Alleinerbin.
Als ich klein war, war ich einfach ich.
»Meine schönen Töchter«, sagte meine Mutter manchmal.
»Das sagen alle Mütter«, antwortete Hannah dann achselzuckend.
»Aber bei mir stimmt es«, entgegnete meine Mutter und drückte uns an sich.
Eigentlich waren es nur zwei Sätze, die alles für mich veränderten. Aber ich bin mir sicher, ich werde sie nie, nie, nie vergessen.
Der erste Satz fiel letztes Jahr im Kunstunterricht.
Wir hatten eine neue Lehrerin, und sie ließ uns Kohleskizzen machen. Einmal einen Stein, einmal einen zufälligen Schatten … und dann … unseren Sitznachbarn. Nur sein Profil, eine schnelle Skizze in wenigen Strichen.
Es war Juni, ich war gerade vierzehn geworden, und es regnete an dem Tag in Strömen, Regentropfen prasselten laut gegen die hohen Fensterscheiben.
Miriam und ich hatten Streit. Der Grund unseres Streites ist das Einzige, das ich nicht mehr weiß von diesem Vormittag. Jedenfalls saß Miriam seinetwegen in dieser Stunde nicht neben mir. Sie saß neben Konstantin. Und ich saß neben Henry.
Wie benommen saß ich da. Ich wollte nicht gemalt werden. Um keinen Preis. Und schon gar nicht von Henry. Mein Kopf fühlte sich an wie mit Watte gefüllt. Ich wünschte mich weit weg, aber ich durfte nicht weg. Nein, ich musste hier sitzen und konnte es nicht glauben. Warum, warum, warum mussten wir so einen Blödsinn machen?
Mathe war nötig, Fremdsprachen auch. Vielleicht war es auch notwendig, im Leben etwas von Goethe und Schiller und Peter Handke und Max Frisch gelesen zu haben. Und Hamlet.
Aber es war nicht nötig, sich gegenseitig mit dünnen, bröckeligen Kohlestiften zu malen. Nein, das war ganz sicher nicht nötig.
»Mann, deine komische Rüsselnase ist echt kompliziert zu malen«, murmelte Henry in diesem Moment.
Mit gerunzelter Stirn saß er da, mit einem schwarzen Kohlefleck auf der Wange und zerstrubbelten Haaren, den Zeichenblock auf den Knien.
Er schaute mich an.
Ich fühlte nichts, gar nichts. Absolut gar nichts.
»Ich … komme gleich wieder«, murmelte ich schließlich benommen, als ich mich endlich wieder rühren konnte, und schob mich vom Stuhl. Ich schwitzte und fror zur gleichen Zeit. Ich fühlte mich wie krank, wie erschlagen, wie in Trance.
»Okay, bis gleich«, nickte Henry, der nichts bemerkte, und strichelte weiter auf seinem Block, an seiner Zeichnung, herum. Ich vermied es, sie auch nur mit einem Blick zu streifen. Stattdessen stolperte ich mit kleinen, leisen, unauffälligen Schritten mitten durch den lauten Kunstraum und floh, wie damals im Gruselkabinett, auf die Toilette.
»Wo warst du denn so lange?«, fragte Henry in der nächsten Stunde.
»Ich war … mir war … ist doch egal«, sagte ich und schaute ihn nicht an.
Mein Gesicht war wie eine Wunde.
Mein Gesicht war eine Wunde nach dieser Stunde im Kunstraum.
Ich war nicht mehr ganz. Ich war verletzt.
»Hab die Skizze trotzdem abgegeben«, sagte Henry achselzuckend. »War ja sowieso schon fast fertig. Deinen Block mit meinem Profil habe ich übrigens auch mit abgegeben.«
»Danke, nett von dir«, sagte ich mit dünner Stimme und setzte mich schnell auf meinen Platz.
Henry war nett. Er ist es auch heute noch. Aber er hatte mich verletzt. Er hatte diesen Satz gesagt. Vielleicht ohne sich etwas dabei zu denken. Aber nie mehr auszulöschen in mir drin.
Der zweite Satz fiel auf Miriams fünfzehntem Geburtstag im letzten Winter. Stefano war auch da. Er hatte Miriam überraschend seinen alten PC geschenkt, weil er sich einen neuen zugelegt hatte. Stefano hat reiche Eltern, er ist immer sehr spendabel.
Wir spielten ein Computerspiel, bei dem man Menschen kreierte und ihnen Haare und Augenfarben und Brillen verpasste, sie anzog, ihnen Häuser baute, ihnen Freunde erfand, die man auch wieder zusammenpuzzelte aus Haarfarben, Hautfarben, Sternzeichen, verschiedenen Charakteren und Vorlieben.
Eine schöne, neue Welt.
Mit ein paar schnellen Mausklicks konnte man sie sich dann als Babys, Kleinkinder, als Jugendliche, als Erwachsene und als graue Greise anschauen.
Ein schnelles Leben.
Man konnte machen, dass sie sich küssten, dass sie miteinander schliefen, sie wurden schwanger, arbeitslos, machten Karriere, stritten sich, aßen, betrogen sich, wurden dick, und zum Schluss starben sie.
Stefano lachte, tippte sich an die Stirn, und klickte sich durch Haarfrisuren, Augen- und Nasen- und Kopfformen.
»Mann, da gibt es nichts, was es nicht gibt«, sagte er kopfschüttelnd. »Eierköpfe, Punkfrisuren, Megatitten, Spitznasen, Schwabbelbäuche … «
Mit einem Mausklick verließ er die Münder, die er sich gerade angeschaut hatte, und kam zu den Kinnen.
»Da, ein markantes Räuber-Hotzenplotz-Kinn und ein Idiotenkinn und ein Kleopatra-Kinn, alles da«, lachte er. »Nur so ein Po-Kinn wie Helenas haben sie nicht im Sortiment. – Pech für dich, Helena … «
Ich starrte auf meine Hände, der Tag versank in einem Strudel aus Schreck und Scham und Entsetzen.
Musik, Chips, Kuchen, Cola, sogar Sekt gab es. Konstantin war ebenfalls da. Und Hülya und Karlotta und noch ein paar andere aus unserer Klasse. Luftschlangen hingen über Regalen, und Miriams Mutter machte vegetarische Pizza, weil Miriam Vegetarierin ist. Aber ich nahm nichts mehr wahr. Ich war ein Lufthauch inmitten eines Sturms, weiter nichts.
Die Nase meines Vaters. Und sein Kinn. Alles andere war auszuhalten: meine Haare, meine blasse Haut, meine regenpfützengrauen Augen.
Aber nicht meine Nase. Nicht mein Kinn.
Ich war hässlich.
Henry und Stefano hatten nur ausgesprochen, was jeder sehen konnte. Was die Wahrheit war.
2
Ich habe zwei Großmütter. Eine gestorbene und eine verschwundene.
Die gestorbene Großmutter ist die Mutter meiner Mutter. Sie hatte Krebs und starb, als Hannah und ich noch ganz klein waren. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an sie erinnern. Es gibt ein Foto in unserem Familienalbum, da sitzt sie in unserem alten Wohnzimmer und hat Hannah und mich auf dem Schoß. Ich bin ungefähr ein Jahr alt und Hannah ist, wie immer, ein Jahr älter. Unsere Großmutter lacht auf diesem Bild und drückt uns fest an sich. Sie hatte dieselben braunen Locken wie meine Mutter und meine Schwester. Und dieselben großen, dunklen, schönen Augen. Und sogar dieselben lächelnden Mundwinkel.
Meine andere Großmutter ist seit vielen, vielen Jahren verschwunden. Ihre Spur verlor sich ganz allmählich.
Hannah und ich haben sie noch nie gesehen, und sie weiß wahrscheinlich nicht einmal, dass es uns überhaupt gibt. Uns, und die neuen Kinder meines Vaters.
»Sie hatte wohl einfach genug vom englischen Kleinstadtmief«, hat mir mein Vater früher einmal erzählt. »Sie ging fort, von einem Tag auf den anderen, als ich zehn Jahre alt war. – Vorher hatte sie sich sehr mit eurem Großvater gestritten. Und am nächsten Tag war sie weg, einfach so, und ließ mich bei ihm zurück. Bald darauf gingen wir nach Deutschland.«
Mein Vater hat mich angesehen. »Ich habe es jahrelang nicht begriffen, dass sie wirklich fort war … Dass sie uns verlassen hatte … Dass sie nicht wiederkommen würde. Ich habe immer auf sie gewartet – jahrelang … «
Er schüttelte den Kopf, und dann erzählte er uns, dass sie zuerst noch ab und zu geschrieben hatte, einmal aus New York und dann aus Melbourne, und einmal war sie auch ganz nah gewesen, und hatte eine Postkarte aus Paris geschickt.
Aber sie kam nie wieder. Und irgendwann waren keine Briefe mehr gekommen.
»Jetzt hat es sie wohl erwischt, die alte Kruke!«, hatte mein Großvater, der Vater meines Vaters, geknurrt. »Jetzt wird sie wohl tot sein … «
In unserem Familienalbum gibt es auch von ihr ein Bild.
Ein scheußliches, schreckliches Bild. Eine große, voluminöse Frau ist darauf zu sehen, eine Frau mit hellen, wirren Haaren, heller Haut, einer Rüsselnase und einem Po-Kinn.
Manchmal möchte ich mich einfach nur in Luft auflösen.
Michelle Pfeiffer ist schön. Und Ingrid Bergman.
Aber nicht nur junge Leute sind schön. Audrey Hepburn war auch, als sie schon alt war, noch wunderschön.
Naomi Campbell ist eine schöne Schwarze. Marilyn Monroe war schön, obwohl sie pummelig war. Und Kate Moss ist schrecklich mager und trotzdem wunderschön.
Miriams Mutter hat das ganze Gesicht voller Sommersprossen. Sogar auf ihren Lippen sind welche. Aber sie ist trotzdem schön. Sie selbst sagt, sie ist gerade deswegen schön.
Und Hülya aus meiner Klasse ist nur etwas über einen Meter fünfzig groß. Aber sie hat ein schönes, ebenmäßiges Gesicht, eine zarte Nase, ein unauffälliges Kinn, große, schwarze, tiefe Augen und die schönsten und längsten Wimpern, die ich je gesehen habe.
Henry ist schon seit zwei Jahren in Hülya verliebt. Jeder weiß das. Und in Miriam ist Ben verliebt, ein Junge aus der Elften.
In mich war noch nie jemand verliebt.
Weil ich hässlich bin. Weil ich ich bin. Weil ich diese Nase und dieses Kinn habe.
Manchmal habe ich Angst, dass ich anfange, mich wirklich zu hassen. Mich und mein Gesicht.
Wir wohnen am Stadtrand. Wenn man unsere Straße hinuntergeht, stößt man auf einen unbefestigten Feldweg, und dieser Feldweg führt zum Kastanienwäldchen. Unser Wald haben Hannah, ich und Stefano früher immer gesagt.
Das Kastanienwäldchen ist auch schön, wunderschön. Abends, im Sommer, kommen immer die Stare. Abend für Abend verdunkeln sie dort für einen Moment den Himmel, wenn sie sich wie ein Regenschauer in die Kastanien hineinstürzen, um dort zu übernachten. Früher sind wir oft in unseren Wald gegangen am Abend, nur um uns dieses Schauspiel anzuschauen. Es sieht so schön aus, dass man die Luft anhalten muss.
3
Schön.
Man kann die Welt einteilen in schön und hässlich. Ich fürchte mich vor beiden Wörtern. Weil sie sich aufeinander beziehen. Weil sie zusammengehören.
Schön ist ein Nachname. Otto Schön.
Hässlich ist kein Nachname. Otto Hässlich gibt es nicht. Zum Glück heiße ich nicht Schön mit Nachnamen.
Libellen sind schön, wenn sie glitzernd durch die Sommerluft trudeln.
Immer, wenn nicht Sommer ist, wünsche ich mir den Sommer herbei.
Unser Deutschlehrer war krank, die ganze Woche schon. Jeden Tag hatten wir eine Freistunde gehabt. Aber am Freitag war es anders – zwei Sachen waren anders.
Es goss in Strömen an diesem Vormittag, als ich zur Schule ging.
The rain beat hard on me and there was a fast rack riding the sky.
Der Regen schlug hart auf mich nieder, und am Himmel flogen die Wolken in Fetzen dahin.
Manchmal denke ich englisch, wenn ich alleine bin, dabei spricht mein Vater fast immer deutsch mit uns – wenn er mal mit uns spricht, meine ich.
Wie gesagt, zwei Dinge waren anders an diesem Regentag.
Zuerst kam Jadis.
»Jadis wird ab heute in eure Klasse gehen«, sagte Frau Nagel, unsere Klassenlehrerin, und schaute sich prüfend um. »Einen Tisch. Wir brauchen einen zusätzlichen Tisch«, murmelte sie. Und dann schickte sie Henry und Stefano zum Hausmeister.
Ich schaute Jadis an. Die anderen schauten Jadis an. Alle Neuen werden immer angeschaut, egal ob sie hübsch, hässlich, dick, dünn, groß, klein, gewöhnlich, besonders sind.
Neue sind Neue, und das alleine macht sie interessant. »Jadis kommt aus Amerika«, sagte Frau Nagel, während wir auf Henry, Stefano und den Tisch warteten. »Von wo genau kommst du, Jadis?«
»Connecticut«, sagte das fremde Mädchen und stellte ihre türkise Tasche ab. »Northfield, in Connecticut. Eine kleine, verschlafene Stadt, in der nicht viel los ist.«
Ich hielt die Luft an.
Das Mädchen aus Connecticut war groß und hatte wunderschöne, helle Augen und ein wunderschönes Gesicht. Dazu war sie schlank, und ihre Hände und ihre Figur, ihr Busen, ihr Bauch, ihr Blick, alles war perfekt.
In dem Moment stolperten Stefano und Henry mit dem zusätzlichen Tisch herein.
»Stellt ihn dort an die Wand«, sagte Frau Nagel und wies auf das Stück Wand neben dem Klassenschrank.
Jadis würde also neben mir sitzen. Ich saß auf meinem Platz neben Miriam, aber am äußersten Rand der Reihe. Stumm schaute ich zu, wie Stefano und Henry den neuen Tisch in die Lücke zwischen meinem Platz und der Wand schoben.
Gleich darauf setzte sich Jadis.
»Hallo«, sagte sie zu mir.
»Hallo«, sagte ich.
Jadis war schön. Sonnenaufgänge waren schön. Fliegende Kraniche waren schön. Schwedische Seen waren schön. Die Insel La Gomera war schön. Rosen waren schön.
Frau Nagel schrieb eine Gleichung an die Tafel, die wir nach x auflösen sollten.
»Schreib einfach mal mit, Jadis«, sagte Frau Nagel. »Du wirst dich schon reinfinden.«
Jadis nickte und zog ein Heft und einen Kuli aus ihrer türkisen Tasche.
Ich schaute verstohlen zu ihr rüber. Wie man sich wohl fühlte, wenn man so aussah?
So wie Jadis wollte ich sein. Genau so. Und das nicht, weil sie die richtigen Klamotten trug, oder weil sie richtig geschminkt war, sondern einfach, weil sie war, wie sie war. Weil sie schön war.
Das Leben war schön – wenn man so aussah wie Jadis.
Kurz darauf klingelte es, und statt einer Freistunde hatten wir heute eine Vertretung für unseren kranken Deutschlehrer, einen jungen Referendar.
»Wie findest du sie?«, flüsterte Miriam und deutete auf das Mädchen aus Amerika an meiner linken Seite.
Ich zuckte mit den Achseln.
»Karlotta findet, sie sieht aus wie eine typische amerikanische Barbie«, fügte Miriam leise hinzu.
Ich schwieg, dafür redete der Vertretungsreferendar. »He, ihr seid ja eine große Klasse«, sagte er und blätterte in unserem Klassenbuch. »Sechsunddreißig Schüler – nein, sogar siebenundreißig … «
Die Siebenunddreißigste war Jadis.
»Na, wie dem auch sei«, fuhr er fort. »Wir machen ein kleines Spiel: Buchstabiert eure Namen mit Wörtern, die zu euch passen. Ihr könnt Eigenschaften aufschreiben, die ihr habt oder gerne hättet, Dinge, die euch beschäftigen, die euch durch den Kopf gehen. Alles ist erlaubt.« »Wie heißt du?«, fragte Jadis mich, während sie nach Papier und Stift griff.
Ich sagte ihr meinen Namen und schrieb auf:
H wie Hässlich E wie Einsam L wie Leise E wie Elend N wie Niedergeschlagen A wie Alles Mist!
Nein, nein, nein! So ging es nicht! Eilig zerknüllte ich das Blatt und steckte es ein.
Miriam schrieb. Hülya schrieb. Karlotta, Henry und Konstantin schrieben. Stefano schrieb. Alle anderen schrieben ebenfalls, wenigstens mehr oder weniger. Es herrschte ein ziemlicher Krach im Raum.
Ich schaute auf Jadis’ Blatt und sah aus dem Augenwinkel, dass auch Miriam sich durchlas, was Jadis geschrieben hatte.
JADIS stand da.
J wie Joy A wie A happy day! D wie Dancing in the sunshine I wie Intrepid S wie Sexappeal
»Was heißt intrepid?«, erkundigte sich Miriam.
»Unerschrocken«, übersetzte ich, wie aus der Pistole geschossen, anstelle von Jadis.
»Exakt«, sagte Jadis und lächelte mir zu.
Freude. Ein glücklicher Tag. Tanzen im Sonnenschein. Unerschrockenheit. Sexappeal …
Widerwillig begann ich neu:
H wie Harfe (die spielte ich seit Jahren), E wie Elefant (mein Lieblingstier), L wie Lustig, E wie Eis am Stiel, N wie Natürlich Blond, A wie Alles Super!
So konnte ich es abgeben. Oder vorlesen. Oder riskieren, dass Miriam oder Jadis oder Stefano, der in der Reihe vor uns saß, einen Blick auf meinen Zettel warfen.
»Harfe? Warum hast du Harfe geschrieben? Spielst du Harfe?«, fragte Jadis.
Ich nickte. »He, toll«, sagte sie. »Spielst du mir mal was vor? Hast du Zeit heute Nachmittag? Ich hätte Zeit. Ich kenne keinen, der Harfe spielen kann.«
Sie lächelte mir zum zweiten Mal zu.
Und so kam es, dass Jadis mich besuchte.
Als wir nach Hause gingen, hingen unsere Namenszettel an der langen Wand unseres Klassenraums. Der junge, verrückte Referendar hatte sie in einer langen Reihe dort aufgehängt. »Vielleicht geben sie euch Impulse im Umgang miteinander. Man kennt sich nie gut genug, als dass man sich nicht noch besser kennenlernen könnte«, hatte er gesagt und uns zum Abschied zugenickt.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























