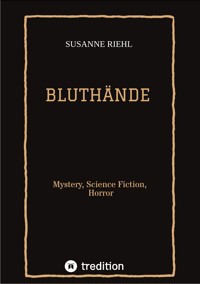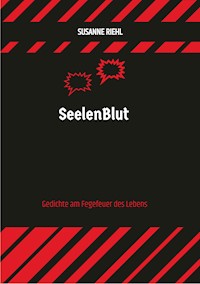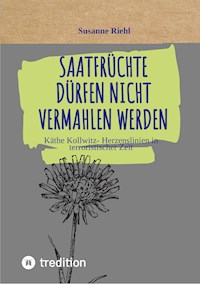
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Putins barbarischer Angriffskrieg auf die friedliche Ukraine wirft für viele Menschen auf recht nagende Weise die Frage nach den Saatfrüchten der menschlichen Existenz wieder auf. Auch eine der berühmtesten deutschen Künstlerinnen, Käthe Kollwitz, sah sich auf qualvolle Weise grausamsten Kriegen gegenüber. In einer Zeit, die durchaus als Zeit von Furcht und Elend beschrieben werden darf, eine "terroristische" Zeit. Doch welche Chancen für das Wachstum der Menschheit liegen in solchen Erfahrungen? Welchen Sinn haben diese kollektiven Herausforderungen für die einzelnen Menschen? Susanne Riehl vermittelt anhand einer fokussierten Lebensskizze der großen Künstlerin "Saatfrüchte dürfen nicht vermahlen werden" hierzu bemerkenswerte Einsichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 33
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Susanne Riehl
Saatfrüchte dürfen nicht vermahlen werden
Käthe Kollwitz- Herzenslinien in terroristischer Zeit
Eine gute Saat braucht Licht, Liebe und Zutrauen
© 2022 Susanne Riehl
Buchsatz von tredition, erstellt mit dem tredition Designer
Verlagslabel:
ISBN Softcover: 978-3-347-66203-2
ISBN Hardcover: 978-3-347-66209-4
ISBN E-Book: 978-3-347-66210-0
ISBN Großschrift: 978-3-347-65991-9
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Ich sitze im Mai 2022 gedanklich in einem dieser bunten Cafes im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg bei einem leckeren kleinen Schwarzen. Ich hatte über Jahre meinen psychotherapeutische Praxis in diesem gerade heute äußerst begehrten Szeneviertel „Kollwitzkietz“ und konnte daher den sehr eigenen Geist dieses historischen Ortes, der so viel an deutscher Geschichte in sich trägt, tagtäglich einatmen. Der imposante Kollwitzplatz bildet den Mittelpunkt des sogenannten „Kollwitzkietzes“, heute einer der angesagtesten Szenebezirke weltweit. Er wurde am 8. Juli erin und Bildhauerin Käthe Kollwitz benannt, die hier einen Großteil ihres Lebens im Haus WeißenburgerStraße Nr. 25 (kriegszerstört, seit 1947 Grundstück Kollwitzstraße Nr. 56a) verbrachte. Ein historisch denkwürdiges Feld der Urbanität, das durch die Barbarität des deutschen Zeitgeistes so arg belastet wurde. Die geneigte Leser*in mag wissen, dass unweit des Kollwitzplatzes, in der Rykestraße, eine der wenigen von den Nazis verschonten Synagogen steht, streng beschützt von den Polizeikräften vor gegenwärtigen faschistischen Destruktionskräften. Ein Paradox der Geschichte: Diese zweitgrößte Synagoge Europas steht ebenfalls am 9. November 1938 im Fadenkreuz der Nationalsozialisten. Der Standort in innerstädtischer Wohnlage sorgt aber dafür, dass das Gotteshaus in der Reichspogromnacht nicht völlig zerstört wird. Die umliegenden Grundstücke sollen nicht in Gefahr geraten. Schließlich wohnten hier hohe Parteifunktionäre! Also zerstören die Nazis das Innere des Gebäudes. Im April 1940 beschlagnahmen die Nationalsozialisten das Gebäude. Danach funktioniert die Wehrmacht das Gebäude als Pferdestall und Lager um. Im Zweiten Weltkrieg entkommt die Synagoge dem Bombenhagel, der am Gebäude keine nachhaltigen Beschädigungen hinterlässt.
Vor der Offensive auf Berlin gelingt es den sowjetischen Truppen, die Verbindung zwischen Königsberg und Pillau zu unterbrechen und am 8. April in Königsberg einzudringen. Da Lebensmittel und Munition aufgebraucht sind, kapituliert General Otto Lasch. Hitler lässt ihn wegen Feigheit zum Tode verurteilen und seine Familie in Sippenhaft nehmen. Die Oderfront beginnt am 16. April zu brechen, als die dritte Weißrussische Front zur Offensive auf Berlin ansetzt. Trotz des anhaltenden Widerstandes ist der innere Berliner Verteidigungsring am 22. April erreicht und die Stadt drei Tage später fest eingeschlossen. Die Fortdauer der Verteidigung in Berlin wird trotz ihrer offensichtlichen Sinnlosigkeit seit der Einschließung von „fliegenden Standgerichten“ der SS erzwungen, die jeden Soldaten, Volkssturmmann und Hitlerjungen, den sie Deserteur oder Verräter ansehen, erhängen.
An diesem 22. April 1945, wenige Tage vor Ende von tirbt im Alter von 77 Jahren in Moritzburg bei Dresden die wohl bis heute berühmteste deutsche Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz. Auf der Seite liegend, mit gefalteten Händen, aufgebahrt in einem rotweißen Magnolienmeer in der Moritzburger Friedhofskappe. Eine bescheidende kleine alte Frau, der die Aufgaben und Leiden ihres langen Lebens deutliche Spuren ins Gesicht gegerbt hatten. Eine Seele, die man im wahrsten Sinne des klassischen Wortes als schöne Seele bezeichnen darf.
Ihre Arbeit der in Königsberg geborenen Künstlerin ist geprägt vom deutschen Expressionismus und von ihrem ausgeprägten sozialen Engagement. Mit eindringlichem realistischen Duktus schilderte sie vor allem in ihren Radierzyklen „Ein Weberaufstand“ 1887/98, deren Motiv sie Gerhart Hauptmanns Drama entnahm, sieben Radierungen zum „Bauernkrieg“ und den Holzschnittzyklen „Der Krieg“ 1922/23 sowie in einer schier endlosen Fülle von Lithografien, Radierungen und Einzelblättern die Ausprägungen menschlicher Existenz in Not, Leiden und Unterdrückung vor allem im Großstadtproletariat. Es ist der menschliche, bisweilen sehr verzweifelte Blick einer Sozialistin. In ihrem Spätwerk konzentrierte sich die große Künstlerin, eine Persönlichkeit mit tiefer weiblicher Intuition, vor allem auf das Thema Mutter und Kind.