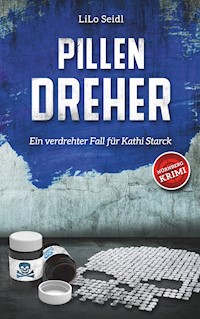3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tommy Bergers Großvater, ein polnischer Zwangsarbeiter, starb im März 1945 im überfüllten Konzentrationslager Flossenbürg. Katastrophale hygienische Verhältnisse boten Fleckfieber und Tuberkulose fruchtbaren Boden. Gewalt, Ignoranz und Versagen der Ärzte forderten allein in diesem Monat über 1300 Todesopfer. Besessen von Vergeltung geht Tommy auf Spurensuche. Sie führen ihn zu einem Häftlingsarzt, der 1987 Suizid beging. Ein spätes Schuldeingeständnis? Der asthmakranke Starpianist Marc Rosen wird von Rechtsradikalen mit antisemitischen Sprüchen wüst beschimpft und niedergeschlagen. In einer TV-Sendung zeigt er sich dennoch genervt von der Erinnerungskultur an die NS-Zeit. Das lang verschollene Tagebuch seines Großvaters zwingt ihn, sich mit dem verhassten Thema auseinanderzusetzen. Qualvolle Erinnerungen an das Lager Flossenbürg offenbaren ein lang gehütetes Familiengeheimnis. Der Schlüssel zu Marcs Kindheitstrauma? Er beauftragt die Journalistin Lisa Fleming, das Tagebuch aufzuarbeiten. Ein bekanntes Magazin wird prägnante Teile daraus veröffentlichen. Enthusiastisch erzählt Lisa Tommy von diesem lukrativen Job. Er reagiert unerwartet gereizt. Die kontroverse Diskussion endet im Streit und der Mann, den sie liebt, schlägt zu. Was versetzt Tommy in Rage?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Gewidmet allen Häftlingen
des Konzentrationslagers Flossenbürg.
Niemals vergessen.
Anmerkungen der Autorin
Mit Ausnahme der historischen Ereignisse im und um das Konzentrationslager Flossenbürg, ist die Handlung in dieser Geschichte fiktiv. Einige Teile basieren auf wahren Begebenheiten, gestützt durch Berichte von Zeitzeugen. Alle Hauptfiguren sind frei erfunden, etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen nicht beabsichtigt. Davon ausgenommen sind die im Anhang unter „Personen I. bis V.“ genannten und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Marken- und Künstlernamen, Warenzeichen, Zitate und Titel werden in diesem Buch ebenfalls in einem fiktiven Zusammenhang verwendet. Es erhebt keinen Anspruch auf Faktizität, obgleich real existierende Behörden, Einrichtungen, Unternehmen und Handlungsorte genannt, sowie wahre historische Ereignisse und realistische Abläufe thematisiert wurden.
Das Ende des Lagers
ist noch lange nicht
das Ende des Sterbens.
Jorge Semprun
Inhaltsverzeichnis
Wilhelm
Tommy
Marc
Tommy
Martin
Helene
Tommy
Lisa
Marc
Die Munchner Sieben
Lisa
Marc
Offenbarung
Wilhelm
Marc
Lisa
Flossenburg
Lisa
Tommy
Lisa
Tommy
Lisa
Tommy
Klaus
Auge um Auge
Lisa
Leserbriefe
Wilhelm
Factx
Krakau
Viktor
Factx
Lisa
Marc
Anhang
Danksagungen und Nachworte
Anmerkungen
Glossar
Personen
Quellen
Die Autorin
Lilos Bucher
Starnberg, 7. August 1987
Er schraubte den Füller zu und legte ihn neben das Tagebuch, die letzte Seite noch aufgeschlagen. Mit beiden Händen nahm er es hoch. Er blies die Tinte trocken und las Franz von Assisis Worte noch einmal leise. »Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Weges.« Sachte klappte er es zu und strich über den fein geprägten schwarzen Einband. Seine Hand zitterte. Er ballte sie zur Faust. »Nein, du bist kein Feigling!«
»Opa, wo bist du?«, hörte er eine helle Jungenstimme im Treppenhaus. »Ich gehe jetzt mit Wurzel in den Garten!«
»Ich komme gleich nach unten!«, rief Wilhelm.
Das Bellen des Hundes und die übermütigen Schritte seines Enkelsohnes entfernten sich. Wilhelm stand auf, öffnete eine der verglasten Türen des Bücherschranks und schob das Tagebuch hinter zwei dicke Fachbücher mit dem Titel ›Verletzungen der oberen und unteren Extremitäten, Band I und II‹. Er ordnete die Bücher, bis sie wieder exakt in einer Linie standen, schloss ab und verließ sein Arbeitszimmer.
Am Ende des Flurs warf die Nachmittagssonne das Doppelkreuz des Rundbogenfensters als verzerrten Schatten auf den hellen Dielenboden, einem Galgen gleich. Wilhelm konnte seinen Blick nicht abwenden, die Erinnerung an den Abend des 24. Dezembers 1944 kehrte zurück: Es schneite. Inmitten Tausender anderer Häftlinge dicht gedrängt, stand er auf dem Appellplatz im Lager Flossenbürg, den Blick auf die sechs erhängten Kameraden am Galgen gerichtet.
»Nein!« Wilhelm schlug den Kopf gegen die Wand, sein Herz pochte, schnell und dumpf. Das Blut in seinen Adern schien zu kochen. Er zitterte am ganzen Körper. Tränen traten in seine Augen, perlten die Wangen hinab und benetzten seine Lippen. Er schmeckte das Salz. »Nein, nicht jetzt! Der Kleine wartet auf mich!« Mit dem Hemdsärmel wischte er die Tränen weg. Als er aufsah, wirkte der Schatten länger als vorhin, der Galgen schien in die Höhe zu wachsen. Er endete an der schmalen Stiege, die hinauf zum Trockenboden führte. Die Tür öffnete sich mit bedrohlichem Knarren. Dutzende ausgemergelte, vom Tod gezeichnete Gesichter, starrten ihn an. Ihre Körper nur noch Schatten ihrer selbst. Qualvoll schreiend griffen ihre Hände nach Wilhelm. Sie verwandelten sich zu scharfen Klauen, die sich in sein Fleisch bohrten. Mit vereinten Kräften hielten ihn die Schatten fest. Es gelang ihm, sich loszureißen. Er wollte fliehen, doch mit Füßen, schwer wie Blei kam er nicht von der Stelle. Ein bedrohliches Rattern näherte sich. Eine Lore erfasste ihn und rollte mit ihm in die Tiefe, in das Maul eines riesigen Ofens. Flammen lechzten nach seinem Körper, dichter Rauch nahm ihm die Luft zum Atmen. Dunkelheit hüllte ihn ein.
Münchner Tag, 24. Mai 2019
Seine Hände umklammerten die gepolsterten Lehnen des Sessels. So kompensierte er die Anspannung, während er seinen Boss, Chefredakteur Harry Schuler, beim Lesen der halbseitigen Zusammenfassung seines Manuskripts beobachtete.
»Verbrechen Liebe, hm…« Am Ende sah Harry auf, die Lippen gekräuselt. »Kein Happy End für Helene und Viktor?«
»Nein, es war eben ihr Schicksal. Muss es immer ein Happy End geben?«
Harry gab Tommy den Entwurf zurück. »Ich glaube, ein polnischer Zwangsarbeiter im KZ interessiert unsere Leserschaft nicht.«
»Woher willst du das wissen?« Tommys Züge zeigten eine Mischung aus Unverständnis und Verärgerung.
»War Viktor Jude?«
»Nein, katholisch.«
Harry blies Luft aus.
»Was denn?«, knurrte Tommy. »Die Juden sind nicht die Einzigen, die unter den Nazis litten und das Recht auf Erinnerung gepachtet haben. – Das heißt nicht, dass ich Juden hasse. Ich bin weder Antisemit noch Rassist.«
»Weiß ich, Tommy. Aber bei deinem Thema Verbrechen Liebe, da …«, druckste Harry herum. »Bei so einer Story erwarten unsere Leser Drama plus Romance.«
»Es ist eine spannende Story. Meine Großmutter wurde von ihren Eltern verstoßen und musste noch mal von vorn beginnen, während des Krieges und mit einem kleinen Kind. Und es gelang ihr. Großvater war zwei Jahre in Flossenbürg. Im letzten Kriegsjahr ging es dort katastrophal zu: mehrfache Überbelegung der Wohnbaracken und es herrschten haarsträubende hygienische Bedingungen. Krankheiten wie Ruhr und Tuberkulose grassierten, außerdem zwei Fleckfieber-Epidemien. Ist dir das nicht genug Romance und Drama?«
Harry ächzte leise. »Flossenbürg, wo liegt das überhaupt?«
»In der Oberpfalz, etwa sechs Kilometer von der Grenze zu Tschechien entfernt.«
»Jot-We-De.« Harry rümpfte die Nase. »Niemandsland.«
»Zugegeben, damals war es wirklich weit weg vom Geschehen«, sagte Tommy. »Aber das und die zahlreichen Granitvorkommen waren ausschlaggebend für die Nazis, dort ein Arbeitslager zu errichten. Hitlers Monumentalbau-Wahn fraß den Stein förmlich auf. Flossenbürg war das viertgrößte Konzentrationslager im Reich und eines der berüchtigtsten. Anfangs für Kriminelle, Asoziale und alle Menschen, die der völkischen NS-Ideologie nicht entsprachen: politisch Andersdenkende, Minderheiten, Sinti und Roma, Landstreicher, Behinderte, Zeugen Jehovas, Homosexuelle und Zwangsarbeiter wie mein Großvater. Später kamen alliierte Kriegsgefangene hinzu. Ab Sommer 1944 wurde es zu einem der Auffang- und Durchschleusungslager für die KZs im Osten des Reiches, die kriegsbedingt geräumt worden waren. Bis Januar 1945 deportierte man fast 20.000 jüdische Häftlinge nach Flossenbürg. Frauen und Männer unter 30 Jahren stufte man als arbeitstauglich ein und schickte sie in verschiedene Außenlager weiter. Von insgesamt 100.000 Häftlingen im Hauptlager Flossenbürg und seinen 90 Außenkommandos kamen 30.000 um. Sie wurden totgeprügelt, mussten sich zu Tode schuften, sind verhungert oder an vermeidbaren Krankheiten gestorben. Canaris und Bonhoeffer wurden wenige Wochen vor Kriegsende in Flossenbürg hingerichtet. Soll ich weitererzählen?«
»Danke, das reicht mir.« Harry winkte ab. »Wenn schon kein Happy End, wo ist der aktuelle Aufhänger? Gibt es irgendwelche Gedenktage?«
»Am 23. April war der 74. Jahrestag der Befreiung.«
»Jetzt kommst du damit, heute ist der 24. Mai! Warum hast du mich nicht schon im März darauf angesprochen?«
»Im März ist mein Vater gestorben«, erinnerte Tommy pikiert. »Ich musste mich mit Klaus um den Nachlass kümmern.«
Harry zog den Kopf ein. »Sorry, hatte ich vergessen.«
Pietätloser Arsch!
Tommy rollte mit den Augen. »Außerdem habe ich noch recherchiert. Ein Vorschlag: Wir könnten meine Story als Prolog zum Kriegsende vor 74 Jahren bringen. Was hältst du davon?«
Harry wägte ab. »Drei Teile, je eine Seite, wie rechtfertigst du das?«
»Lies bitte alles.« Tommy schob seinem Boss den Entwurf wieder über den Tisch. »Jede einzelne ist es wert.«
Halbherzig blätterte er die Seiten durch und wischte schließlich mit dem Handrücken achtlos über das Deckblatt. »Da fehlt was, es springt nicht ins Auge.«
»So ein Blödsinn.«
»Du erwähntest vorhin Homosexuelle, recherchiere da weiter, vielleicht gräbst du was Interessantes aus. Ein jüdischer Zwangsarbeiter, schwul, verliebt, ermordet!« Harry fuchtelte theatralisch mit beiden Händen. »Das wäre ein Thema! So was gefällt unseren Lesern.«
»Eine reißerische Aufmache passt nicht zu so einer sensiblen Materie.«
»Alles andere verkauft sich nicht.«
»Du hast nur die Kohle im Kopf!«
»Ich muss nach oben verantworten, wenn der Umsatz nicht stimmt! Außerdem, wer bezahlt dein Gehalt?«
Das ist eine billige Ausrede!
Tommy schluckte diesen Gedanken und das Knäuel Wut hinunter. »Ich habe null Bock über vergaste schwule Juden zu schreiben.« Kaum ausgesprochen, hätte er sich am liebsten auf die Zunge gebissen. »Sorry, ist mir rausgerutscht.«
Harry winkte großzügig ab. »Schon gut, bleibt unter uns.«
»Ich will an die vielen nicht-jüdischen Opfer des NS-Regimes erinnern und Flossenbürg bekannter machen.« Tommys Blick wurde fordernd. »Und, wirst du es dir nochmal überlegen?«
Harry lehnte sich zurück und legte die Hände verschränkt auf seinen Wohlstandsbauch. »Was kannst du am besten, Tommy?«, fragte er und antwortete gleich selbst. »Über Sport berichten und schreiben, da bist du meine Nummer eins. Konzentriere dich darauf und überlass den Historienkram der Magazin-Konkurrenz. Wir sind eine Tageszeitung, deine Story passt da nicht rein.«
Ernüchtert sah Tommy ein, jede weitere Diskussion mit Harry wäre zwecklos. »Wie du meinst.«
»Kopf hoch, morgen Abend holen unsere Jungs den Pokal.« Harry trommelte mit beiden Fäusten auf die Tischplatte. »Ich erwarte eine Hammer-Reportage von dir. Danach genieß dein Wochenende, wir sehen uns am Montag in aller Frische.«
Das Stichwort für Tommy, aufzustehen und an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Andere hinauszukomplimentieren, beherrschte Harry perfekt.
München – Königsplatz, 25. Mai 2019
Vier große Scheinwerfer schwenkten nach oben und bannten gleißend helle Strahlen in den Himmel dieser lauen Mainacht. Überwältigt, mit beiden Händen auf dem Herzen, verbeugte er sich vor dem frenetisch applaudierenden Publikum. Annähernd 14.000 Menschen feierten ihn mit Standing Ovations. Der Starpianist genoss den Beifall einige Minuten allein, dann holte er seine Mitstreiter auf die Bühne: Rocksängerin Merah King, Bariton Juri Nasic, Gitarrist Sandro Breuer und das Quartett Paul Wostock.
Marc griff zum Mikrofon. »Vielen Dank, wir lieben euch!« Er verteilte Handküsse. »Die Hälfte des heutigen Konzert-Erlöses wird an die Hilfsorganisation ZEBRA e.V. gespendet. Seit über zehn Jahren kümmert sie sich um Gewaltopfer. Auch in deren Namen sagen wir herzlichen Dank. Am 21. Juni ist Scheckübergabe, nach dem Konzert im Gasteig.«
»Bravo!«, riefen die Zuschauerinnen und Zuschauer mehrmals und applaudierten erneut. Sieg-Gebrüll aufgestachelter, teilweise angetrunkener Fans des 1. FC Bayern mischte sich darunter. Von der Luisenstraße kommend, näherten sich etwa dreißig junge Männer, mit Flaschen- und Dosenbier im Gepäck. Sie überwanden einen Teil der Absperrungen und drängten vor die Bühne. Die dort postierten Security-Mitarbeiter standen dem grölenden Haufen machtlos gegenüber.
Marc, das Mikrofon noch in der Hand, gab sein Bestes, um sie zu beruhigen. »Hey, Leute! So wie ihr feiert, haben die Bayern den Pokal gewonnen.«
»Jaaaaaa! Drei Null!«
»Gratuliere!«
»Drei Null, drei null – Siiieeeg!«, riefen die die Fußball-Fans im Chor und prosteten ihm zu. »Meister, Meister, Meister! Double, Double, Double!« Einige warfen Stühle um und verschafften sich Platz. Sie formten einen Moshpit und tanzten Pogo. Weitere Security-Leute eilten vor die Bühne, um für Ordnung zu sorgen.
»Bitte Leute, seid vernünftig!«, appellierte Marc.
Sein Wunsch verhallte, die Menge stachelte sich gegenseitig auf. Einer der Angetrunkenen beschüttete Konzertbesucher mit Bier und beschimpfte sie mit Kraftausdrücken. Das ließen sich diese nicht gefallen, es kam zu verbalen Auseinandersetzungen. Dann sprachen die Fäuste.
»Leute, bitte hört auf mit dem Scheiß!«, forderte Marc eindringlicher. Plötzlich verspürte er innere Unruhe, sein Brustkorb schnürte sich ein. Er bekam kaum Luft, sein Herz raste. Keuchend sah er nach oben, ein Engel mit ausgebreiteten Flügeln schwebte in gleißendem Licht, wie bei jedem dieser Anfälle.
Das Licht.
Der Engel.
Die Dunkelheit.
Marc wurde schummrig, er torkelte.
Manager Ben erkannte die Notlage und lotste ihn in den Backstage-Bereich.
»Ruft die Sanis und einen Arzt!«, rief einer der Roadies.
»Nicht nötig!« Ben brachte Marc hinter die Abschirmwände und platzierte ihn auf einen der Stühle.
Mit zitternden Fingern holte Marc das Asthmaspray aus der Hosentasche und inhalierte zwei Stöße. Nach mehrmaligem tiefem Durchatmen entspannte er sich.
»Wieder alles gut?«, fragte Ben besorgt.
Marc nickte hastig. »Ja-ja.« Er lehnte sich zurück.
»Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt.«
»So ein Scheiß-Stress wegen dieser Fußballidioten!«
Tour-Managerin Stephanie lugte durch den Spalt zwischen den Wänden. »Darf ich?« Sie wusste, wie unangenehm Marc diese Anfälle in der Öffentlichkeit waren und fragte nach, um sich keine Abfuhr einzuhandeln.
Er winkte sie zu sich.
»Wie gehts dir?«
»Bin fast wieder okay. Bringt mich bitte so schnell wie möglich hier weg.«
»Ich lasse den Wagen holen«, sagte Ben.
»Deshalb bin ich hier«, erklärte Stephanie. »Alex steht mit dem Van am Parkplatz beim Lenbachhaus. Security und Polizei haben die Zuschauer bis zur zehnten Reihe von den Fußballfans separiert und kanalisieren sie hintenrum, zum U-Bahnhof. Ich befürchte, Alex kommt nicht bis zum Bühneneingang durch.«
»So ein Scheiß!«, knurrte Marc.
»Dann laufen wir eben«, meinte Ben achselzuckend. »Das sind keine hundert Meter.«
Marc rümpfte die Nase. »Laufen? Echt jetzt?«
Du bist manchmal so eine Sissi!
Ben verkniff sich, den Kommentar laut zu wiederholen. Er kannte Marc seit vierzehn Jahren und stand ihm die Starallüren zu. In seinem Managerleben hatte er schon zickigere Schützlinge kennengelernt. »Willst du hier warten, bis alle Leute weg sind?«
»Nein.«
»Na also. Außerdem, wer ist hier 1,90?« Ben klopfte ihm auf die Schulter. »Du hast den vollen Überblick und kannst uns den Weg bahnen.«
München – Schwabing, 26. Mai 2019
Gähnend und die Arme nach oben streckend, schlurfte er in die Küche. »ʽMorgen.«
»Moin, moin.« Süffisant grinsend sah Lisa vom Frühstückstisch auf. »Na, ein bisschen spät geworden gestern Abend?«
»Frag nicht.« Er trat zu ihr. »Klaus hat mich irgendwann nach Mitternacht hier abgeladen.«
»Irgendwann nach Mitternacht? Zum Glück habe ich in meinem Appartement geschlafen. Wenn ich hier eingezogen bin, darfst du nach so einer Aktion mit dem Sofa vorliebnehmen.« Lisas Augen blitzten.
»Puuuuh!« Verlegen kratzte sich Tommy am Kopf.
Lisa trank einen Schluck Milchkaffee und leckte den Schaum genießerisch von den Lippen. »Setz dich, die Weckerl sind noch warm und der O-Saft frisch gepresst.«
Tommy lächelte. Er liebte es, wenn Lisa als gebürtige Hamburgerin Weckerl mit bayerischem Zungenschlag aussprach, anstelle Hörnchen mit gedehntem ›ö‹. »Du bist mein Sonnenschein.« Tommy küsste sie auf die Stirn.
»Igitt! Eine Fahne hast du auch!« Gekünstelt wedelte sie mit einer Hand vor ihrer Nase. »Eine große Wolke verdunkelt gerade deinen Sonnenschein. Wie viel hast du getrunken?«
Tommy zog eine Schnute. »Drei Maß oder so.«
»Und nach drei hast du mit Zählen aufgehört.«
»Ich hatte mir jede verdient. Am Ende des Spiels habe ich brav den Bericht getippt und abgeliefert, damit mein Boss nicht meckert. Danach bin ich mit Klaus und den Kumpels in die Sportbar zum Feiern.«
»Das kann ja heiter werden, wenn die neue Bundesligasaison beginnt, alle vierzehn Tage ein Heimspiel und schlimmstenfalls gewinnen die Bayern jedes Mal.«
Lisas gespieltes Entsetzen ließ Tommy grinsen. »Könnte durchaus vorkommen.«
»Ich glaube, ich überlege es mir nochmal, bei dir einzuziehen.«
»Ich werde mich bessern.« Er setzte seinen berüchtigten Welpenblick auf, niemand konnte ihm da widersprechen oder einen Wunsch abschlagen. »Piraten-Ehrenwort.«
»Ich werde mir erlauben, dich bei Eidbruch daran zu erinnern«, erwiderte Lisa mit gespielter Überheblichkeit. »Als passionierte Seglerin beherrsche ich das Kielholen.«
»Aye, aye, Käpt’n.« Tommy zeigte alle Zähne. »Gibs mir Landratte nur.« Er setzte sich Lisa gegenüber und trank den Orangensaft in einem Zug leer. »Katerkiller Nummer eins, jetzt die Zwei.« Er tunkte das Hörnchen in den Milchkaffee und biss ein Viertel davon ab. »Mmmhhh!«
Lisa schüttelte den Kopf. »Gierschlund.«
»Wennf fo gut fmeckt, darf man daf«, nuschelte Tommy mit halbvollem Mund.
Schmunzelnd widmete sich Lisa wieder dem e-paper der Süddeutschen auf ihrem Tablet.
»Waf freibt die werte Konkurrenz heute Fönef?«
»Dein Fußball macht heute überall Schlagzeilen.«
»Mein Fußball?«
»Ja, keine rühmlichen Schlagzeilen. Eine Horde Bayern-Fans hat sich gestern Abend nicht gerade mit Ruhm bekleckert.«
»Wo war das, in Berlin?«
»Nein, hier auf dem Königsplatz, nach dem Open-Air-Konzert von Marc Rosen. Es war der Auftakt zu seiner Europatournee.« Lisa schob Tommy das Tablet hin. »Der Titel passt wie die Faust aufs Auge: ›Schlussakkord mit fahlem Beigeschmack‹.«
»Schlussakkord mit fahl… « Unerwartet lösten Krümel des Hörnchens einen heftigen Hustenreiz aus. Tommy spülte mit einem großen Schluck Kaffee nach.
»Alles okay? Soll ich dir auf den Rücken klopfen?«
»Nein, danke. Alles gut.« Er räusperte sich, zoomte den Artikel mit Daumen und Zeigefinger größer und las ihn für sich.
Schlussakkord mit fahlem Beigeschmack
München. Samstagabend genossen Starpianist Marc Rosen und sein Ensemble den Applaus ihres begeisterten Publikums. Mit Standing Ovations feierte es das Ende des Auftaktkonzerts seiner Europatournee auf dem Königsplatz. Zur selben Zeit zogen Dutzende, zum Teil stark alkoholisierte, Fans des 1. FC Bayern vor die Bühne. Die Männer hatten zuvor in einem nahegelegenen Biergarten das DFB-Pokal-Endspiel im Public-Viewing verfolgt und störten mit Sieg-Gebrüll die Abmoderation. Rosen gelang es nicht, die Hitzköpfe zur Vernunft zu bringen. Ein heftiger Hustenanfall veranlasste seinen Manager, ihn in den Backstage-Bereich zu bringen. Vor der Bühne warfen die Fußballfans einen Teil der Bestuhlung um und begossen Zuschauer mit Bier. Der Sicherheitsdienst wurde der Lage nicht Herr. Die verbalen Beschimpfungen arteten in eine Massenschlägerei aus. Ein Großaufgebot der Polizei und ein Unterstützungskommando mussten anrücken. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen und teilweise massiven Angriffen mehrerer Personen gegen die Beamten. Am Ende nahm man sechs Männer im Alter von 17 bis 32 Jahren fest. Es werden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Andernorts feierten die Fans den Pokalsieg friedlich.
»Besoffene Idioten!« Tommy ächzte. »Die sind schuld, wenn alle Bayernfans wieder in einen Topf geworfen werden.«
»Sei froh, dass du mit Klaus woanders gefeiert hast. Kann ich bitte mein Tablet wiederhaben.«
»Klar, den Rest lese ich später.« Tommy gab es ihr zurück.
»Merci.« Nach einem Fingerwisch wechselte Lisa ins Feuilleton und widmete sich dem ersten Artikel.
Den Kaffee leise schlürfend, beobachtete Tommy sie.
Erzähle ich ihr von Harrys Abfuhr am Freitag?
Hm, dann muss ich sie in alles einweihen.
Sie wird wissen wollen, wie ich an die Infos gekommen bin. Nö, ich habe jetzt keine Lust, das zu diskutieren.
Ich will das Frühstück mit ihr genießen.
Ein Frühstück zu zweit kam bei ihnen jobbedingt selten vor, auch nicht an einem Sonntag, wie heute. Als freie Journalistin war Lisa oft unterwegs. Am Abend flog sie im Auftrag des Wochenmagazins FactX für vier Tage nach Johannesburg. Eine Reportage zu den Hintergründen der schweren Ausschreitungen im Township Alexandra. Nach den Feierlichkeiten zum 25. Freedom Day, dem Gedenktag zum Ende der Apartheid, war eine Demonstration gegen die Freilassung des weißen Vergewaltigers einer 14-jährigen Schwarzen eskaliert. Lisa und FactX-Fotograf Wollie Türmer würden vom beliebten Pastor Mogapi von der Methodistenkirche in Alexandra begleitet werden, dennoch blieb bei Tommy ein mulmiges Gefühl – wie jedes Mal, wenn sie an Hotspots recherchierte. Kater hin oder her, ihm war es wichtig, den Tag mit ihr zu verbringen. Durch den Englischen Garten bummeln, im Biergarten zu Mittag essen, später vielleicht ein Eis. Gegen fünf würde er sie zum Flughafen fahren.
Seit dreieinhalb Jahren waren sie ein Paar. Ende Oktober 2015 hatten sie sich bei der Geburtstagsparty seines Arbeitskollegen Sven kennengelernt, einer von Lisas ehemaligen Hamburger Kommilitonen. Sie wohnte damals vorübergehend bei ihm. Im Sommer war sie nach München gekommen, um über die Flüchtlingskrise zu berichten. Sie erlag dem Charme der Stadt und mietete ein möbliertes Einzimmerappartement im Olympiapark. Als freiberufliche Journalistin reiste sie viel, lebte den halben Monat praktisch aus dem Koffer. Trotz der knapp 1.000 Euro teuren Miete, hatte sie sich bis jetzt das Appartement geleistet – auch als Rückzugsort. Dort störten herumliegende Unterlagen keinen. Sie konnte ihr kreatives Chaos ausleben, das sie zum Schreiben brauchte.
Tommy liebte seine Hamburger Deern von ganzem Herzen, ans Heiraten dachte er noch nicht. Sein fünf Jahre älterer Bruder Klaus, Kriminalhauptkommissar im Morddezernat bei der Münchner Kripo, neckte ihn seit Monaten: ›Sobald du magische Vier vorn stehen hast, tust du es nie‹. Klaus hatte gleich nach dem Studium an der Polizeihochschule seine Jugendliebe Britta geheiratet, heute Dozentin an einer Wirtschaftsakademie. Ihre Zwillingssöhne Lukas und Moritz machten gerade Abitur.
Mit Ausnahme der Jahre 2005 bis 2011 bei Mia in Berlin, hatte Tommy immer allein gelebt. Mit den Abschlüssen in Informatik und Kommunikationswissenschaften in der Tasche war er damals für einen Redakteursjob bei einem Computermagazin in die Hauptstadt gezogen. Im Januar 2012 lockte ihn ein Projekt des Münchner Tags zurück in die Heimat: Ein neuer Online-Auftritt und die Einführung des e-Papers. Danach wechselte Tommy ins Sportressort und konnte Beruf und sein Hobby Fußball vereinen.
Klaus’ Bemerkung im Hinterkopf, hatte Tommy kurz nach seinem Vierzigsten im Februar Lisa gefragt, ob sie zu ihm ziehen wollte und sie ja gesagt. Seine 90 Quadratmeter große Eigentumswohnung mit Dachterrasse in Schwabing lag nur wenige Gehminuten vom Englischen Garten entfernt. An der Ecke gab es eine Ladesäule für Elektroautos, praktisch für Lisas Mini Cooper E, zwei Straßen weiter einen U-Bahnhof. Die Aussicht auf den kleinen Park mit den vielen Bäumen nebenan war unbezahlbar. Tommy hatte das kleinste Zimmer seiner Wohnung bisher als Abstellkammer benutzt, zwölf Quadratmeter verschenkter Platz. Frisch tapeziert und mit Laminat ausgelegt, war es ein schnuckeliges Homeoffice für Lisa geworden. Nach ihrer Rückkehr aus Südafrika stand der Umzug an. Tommy freute sich auf das gemeinsame Leben unter einem Dach.
Zusammenziehen ist wie ankommen.
Das geht auch ohne Trauschein.
»Ich gehe jetzt Duschen und Zähne putzen.«
»Danach darfst du dir einen richtigen Kuss abholen«, stellte Lisa in Aussicht.
Tommy zog eine Schnute. »Ein Vorschlag, ich putze die Zähne und wir duschen gemeinsam.«
Voller Erwartung legte Lisa das Tablet zur Seite. Tommy nahm ihre Hände, stand gemeinsam mit ihr auf und führte sie ins Badezimmer.
***
Montag, 27. Mai 2019
Tommy holte die Post aus dem Briefkasten. »Heute nur ein Brief?« Das Kuvert, hellgraues Recyclingpapier, ließ auf eine Behörde als Absender schließen. »Vom Standesamt in Starnberg!«, entzifferte er den Absender im Klarsichtfenster. »Endlich!« Er riss ihn auf, faltete das Schreiben hastig auseinander und las es durch. Zufrieden steckte er es zurück und fuhr in den vierten Stock. Er schloss die Wohnungstür ab und legte die Kette vor. Auf dem Weg zum Arbeitszimmer warf er einen Blick auf die Uhr und wählte Klaus’ Mobilfunk-Nummer, erreichte aber nur die Voicebox.
Er hinterließ eine Nachricht. »Hallo Bruderherz, heute war der ersehnte Brief aus Starnberg in der Post. Gute Nachrichten. Melde dich, bin schon zu Hause. Servus.« Smartphone und Brief legte er neben die PC-Tastatur und holte einen Schlüssel aus der Schreibtischschublade. Damit öffnete er den Aktenschrank, wo er mehrere A4-Ordner aufbewahrte – beschriftet mit Dachauer Flossenbürg-Prozesse, Recherche Memorial Archives, Recherche NS-Zeit Allgemein und Viktor/KL Flossenbürg 1943 bis 1945. Seit dem 10. März beschäftigten Tommy und Klaus sich intensiv damit. An diesem Tag hatte ihr Vater beide zu sich in die Klinik bestellt und auf dem Sterbebett ein lang gehütetes Familiengeheimnis offenbart. Das Schicksal der Bergers war eng mit dem oberpfälzischen Konzentrationslager verbunden.
Tommy seufzte. Er sah sich mit Klaus am Bett ihres Vaters stehen, entsetzt, wie eine Krankheit einen Menschen in kurzer Zeit derart zeichnen konnte: fahle Haut, eingefallene Wangen, leere Augen – das Gesicht des Todes blickte ihnen entgegen.
Klinikum München – Onkologie, 10. März 2019
Viel zu lange hatte Martin Berger den Tumor in seinem Kopf ignoriert, die tobenden Schmerzen einer Migräne zugeschrieben und mit Schmerztabletten betäubt. Vor keinem hatte er sich etwas anmerken lassen, weder vor seinen Söhnen und der Familie noch vor Freunden und Bekannten. Seine Frau Christine hatte er bereits im November 2011 im Kampf gegen den Krebs verloren. Dem pensionierten Bundeswehr-Oberstleutnant war es stets schwergefallen, Schwäche zu zeigen – so definierte er Krankheit generell. Seit seinem Zusammenbruch am 4. März sah sich der 76-Jährige mit der Diagnose inoperabler Gehirntumor konfrontiert.
Nervös rieb Martin mit dem Daumen den Puls-Clip am linken Zeigefinger. Den IV-Zugang auf dem Handrücken, den Schlauch zum Infusionsbeutel und das leise, sonore Piepsen des Vitaldatenmonitors, die einzige Geräuschquelle in seinem Einzelzimmer, nahm er kaum noch wahr.
Martins Blick wanderte zu Tommy und Klaus, die auf Stühlen neben dem Bett saßen. »Danke, dass ihr zusammen hergekommen seid. Ich wollte euch den Sonntag nicht vermiesen, was ich euch erzählen muss, werde ich wahrscheinlich nur einmal schaffen.«
»Sag doch nicht sowas.«
»Lass gut sein, Klaus. Ich weiß es.« Martin holte Luft. »Ihr wisst ja, dass Otto nicht mein leiblicher Vater war.«
»Das war Viktor, er ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Er und Großmutter waren nicht verheiratet, 1943 galten uneheliche Kinder als Makel, auf dem Land sowieso. Deshalb ist sie von diesem Oberpfälzer Dorf weggezogen und hat in Grünwald neu angefangen.«
Tommy nickte. »Und als Otto Helene 1948 heiratete, adoptierte er dich.«
»Das ist nur ein Teil der Geschichte«, gestand Martin zähneknirschend.
Tommy und Klaus’ Augen blieben auf ihrem Vater haften, nach dem Motto: Was kommt jetzt?
Martin holte Luft. »Viktor ist nicht im Krieg gefallen, er ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit im KZ Flossenbürg umgekommen.«
Unisono klappten die Kinnladen seiner Söhne herunter.
Schweigen.
Klaus fand als Erster wieder Worte. »Im Konzentrationslager Flossenbürg?«
»Dort verliert sich seine Spur. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Otto mich geliebt hat wie seinen eigenen Sohn. Für mich war er mein Vater, ein guter und liebevoller Vater. Ich blieb ein Einzelkind, weil er wegen einer Kriegsverletzung keine mehr zeugen konnte. Meine Mutter hat mir erst kurz vor ihrem Tod die ganze Wahrheit erzählt. Viktor hieß mit Nachnamen Sobietzki. Er stammte aus Krakau und studierte Physik, bevor man ihn als Zwangsarbeiter nach Bayern verschleppte. Anfang Juli 1942 kam er auf den Hof von Helenes Familie in Waldau. Die beiden verliebten sich, in den Augen des NS-Regimes galt das als Verbrechen. Es duldete keine Beziehungen zwischen deutschen Frauen und Zwangsarbeitern aus besetzten Gebieten. Die Diskriminierungen verfolgten Hitlers Ziel von einem reinen arischen Volkskörper. In Viktors Fall regelten das die sogenannten Polen-Erlasse, harte Rassegesetze. Als slawisches Volk galten Polen als minderwertig. Bei Verstoß drohte die Einweisung in ein Lager, in schweren Fällen der Tod durch den Strang. Am 2. Mai 1943 wurden Helene und Viktor vom Vorarbeiter in der Scheune beim Küssen erwischt und verraten. Viktor kam ins Konzentrationslager Flossenbürg, und musste im nahegelegenen Granitsteinbruch Sklavenarbeit unter unvorstellbaren, menschenunwürdigen Bedingungen verrichten. Helene erfuhr Demütigung als Polendirne, ihr wurde das Kopfhaar geschoren. Ihr Vater sah das Ansehen der Familie befleckt und jagte sie vom Hof. Nichtsahnend von ihrer Schwangerschaft, kehrte sie ihrer Heimat den Rücken. In Grünwald nahmen die Inhaber des Stadelwirts sie auf, damals die Familie Sedelmayer. Im November kam ich zur Welt.«
»Und Viktor?«, fragte Tommy. »Was genau ist mit ihm passiert?«
»Das weiß ich nicht. Ich muss gestehen, ich habe nicht danach gesucht. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Ich bedaure das heute. Vermutlich starb er im März 1945 in Flossenbürg, entweder an Fleckfieber oder Tuberkulose. Seinen letzten Brief an Helene schrieb er jedenfalls aus dem Krankenrevier. Das Lager war damals hoffnungslos überfüllt. Helene hinterließ mir eine Bandkassette, darauf erzählt sie ihren Lebensweg in der neuen Heimat. Hört sie euch an.« Martin atmete tief durch, der Fels auf seiner Brust wog etwas leichter. Dennoch traten Tränen in seine Augen und liefen die Wangen hinab. Mit zitternden Fingern wischte er sie weg und erkannte Hilflosigkeit in den Gesichtern seiner Söhne. Bisher hatten sie ihn ganze dreimal weinen sehen: Im März 2006, als Otto starb, zwei Jahre darauf, als Helene ihm folgte und bei Christines Tod.
In Martins Brust schlugen zwei Herzen, das des gestählten, pflichtbewussten Berufssoldaten, keine Gefühle offen zeigend, und das des liebevollen Familienmenschen, fürsorglich, verständnisvoll, zärtlich, humorvoll und treu – ein Zwiespalt, der ihn sein ganzes Leben begleitete. »Jetzt ist alles raus und ich kann in Frieden gehen«, sagte er schließlich.
»Was redest du, Papa!«, versuchte Tommy es zu beschönigen und nahm seine Hand.
So genannt zu werden, rührte Martin sehr. »Das ist lieb gemeint, aber es ist wie es ist. Die Geschichte war ein Schock für mich, ich konnte sie nicht mal eurer Mutter erzählen. Ein polnischer Zwangsarbeiter als Vater passte nicht in meine Welt, deshalb habe ich geschwiegen. Ich schäme mich dafür, da war ich kein gutes Vorbild.«
»Das ist nicht wahr«, widersprach Klaus. »Manchmal findet man einfach nicht die richtigen Worte.«
»Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen«, bedauerte Martin. »Außer Helenes Bandkassette gibt es noch drei Briefe, von Viktor aus dem Lager. Ihr findet alles im Schranktresor in meinem Arbeitszimmer, die Kombination lautet 1-5-1-9-7-1, unser Hochzeitsdatum.« Martin richtete sich unter großer Anstrengung auf und nahm die Hände seiner Söhne. »Bitte versprecht mir, Viktors Schicksal zu erforschen, bis alles ans Tageslicht gekommen ist. Wendet euch an die Gedenkstätte in Flossenbürg, dort liegen mittlerweile viele verschollen geglaubte Unterlagen vor. Fahrt hin, besucht die Ausstellung.«
»Versprochen«, antworteten Tommy und Klaus wie aus einem Mund.
»Helenes Band könnt ihr über meine Anlage anhören, die hat noch ein Kassettendeck.«
»Ich kopiere es ins MP3-Format«, schlug Tommy vor. »Auch als Sicherheitskopie, falls es Bandsalat gibt.«
Heute ist der 28. Dezember 1988, die Feiertage sind vorüber und auch bald das Jahr. Es waren schöne Weihnachten, mit milden Temperaturen bis zu neun Grad, ohne Schnee, dafür mit viel Regen. Das Wetter kann man leider nicht ändern. Die ganze Familie kam zusammen, allein das zählt. Ich muss mich korrigieren, nicht die ganze Familie. Einer fehlte seit über vier Jahrzehnten, dein richtiger Vater, mein lieber Martin. Er hieß Viktor Sobietzki und stammte aus Krakau. Am 2. Mai 1943 habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Als wir getrennt wurden, wusste ich noch nichts von meiner Schwangerschaft. 64 Jahre alt musste ich werden, um mein Herz zu erleichtern.
Otto weiß über das Meiste Bescheid. Er überlässt es mir, dich einzuweihen – was ich hiermit tue. Ich zeichne es auf für den Fall, wenn ich nicht mehr bin und es bis dahin nicht übers Herz gebracht habe, dir alles zu erzählen. Ich gestehe, zurzeit scheue ich die Konfrontation, sie würde mich zu viel Kraft kosten. Ich bespreche dieses Band, weil es leichter ist als das Schreiben. Gerade heute, bei dem nasskalten Wetter, zwickt mich meine Arthrose in Fingern und Händen.
Ich habe Viktor nie vergessen, ich wurde immer wieder an ihn erinnert. Du, Martin, und deine beiden Buben haben dieselben Augen: braun, warm, freundlich. Vom ersten Tag an haben sie mich in den Bann gezogen. Am 2. Juli 1942 kam er zu uns auf den Hof. Er war 20 und ich 18. Damals hätte ich Arbeitsdienst für die Wehrmacht oder bei einer Behörde leisten müssen, wie alle jungen Frauen meines Jahrgangs. Der Vater hatte seine Beziehungen spielen lassen und es verhindert. Er sagte, er bräuchte seine einzige Tochter auf dem Hof. Ihm fehlte die linke Hand, ein Arbeitsunfall an der Säge im Winter 1936. Ich konnte den Dienst daheim verrichten, half der Mutter im Haushalt und auf dem Hof. Zehn Schweine, sechs Milchkühe, eine Schar Hühner und acht Kaninchen mussten versorgt werden. Dazu kam die Arbeit auf dem Feld, sieben Tagwerk bewirtschafteten wir. Als Selbstversorger brauchten wir während des Krieges nicht zu hungern. Bezugscheine benötigten wir nur für Stoffe, Kleidung, Seife, Zucker und Zichorienkaffee. Unser Getreide brachten wir zum Mahlen nach Roggenstein, bezahlt wurde mit Eiern und Kartoffeln. Neben der Landwirtschaft betrieb der Vater ein Sägewerk, wo das Holz der Waldbesitzer in der Umgebung verarbeitet wurde.
Seit Kriegsbeginn waren regelmäßig wehrdiensttaugliche Männer eingezogen worden, im Frühjahr 1942 unsere drei Knechte. Unser Vorarbeiter, Fritz Landgraf hieß er, konnte bleiben. Er war damals Mitte fünfzig, wie der Vater, außerdem auf einem Ohr fast taub. Wie viele Landwirtschafts- und Handwerksbetriebe hatte der Vater auf dem Amt Fremdarbeiter angefordert, so nannte man sie im beschönigten Behördendeutsch. Sie wurden in besetzten Gebieten zwangsrekrutiert. Für alle Städte und Gemeinden dort galten Quoten, die strikt erfüllt werden mussten. Auch Viktors Kameraden, Jan und Krzystof, kamen aus Polen. Bis auf ein paar Brocken verstand keiner deutsch, nach einigen Wochen ging es schon recht gut.
Viktor hatte in Krakau Physik studiert, heimlich. Dazu muss ich etwas ausholen. Die Jagiellionski-Universität war Anfang November 1939, zwei Monate nach der Besetzung Polens, geschlossen worden. Die SS sperrte fast 200 Professoren und Wissenschaftler ins Gefängnis. Einige ließ man kurze Zeit später wieder frei, darunter Kranke oder für die deutschen Besatzer unentbehrliche Spezialisten. Viktors Vater Michal, Physiker und Dozent für Elektrizitätslehre, war einer von ihnen. Die Nazi-Verbrecher wollten von seinem umfangreichen Fachwissen profitieren. Die anderen deportierte man ins KZ Sachsenhausen und nach Dachau. Familienangehörige und Freunde protestierten dagegen und aktivierten europaweit Kollegen, Diplomaten und Politiker. Mit Erfolg, 140 Wissenschaftler kamen wieder auf freien Fuß, die jüdischen Kollegen mussten in den Lagern bleiben. Ihr Schicksal war besiegelt.
Weil die Lehrtätigkeit untersagt war, gründete man in Krakau 1940 eine Universität im Untergrund. Nach dem Notabitur hatte Viktor dort mit dem Physikstudium begonnen, unter eingeschränkten Bedingungen. Zu viel Theorie, zu wenig praktische Versuche in seinen Fachgebieten Elektrodynamik und Optik, was er sehr bedauerte. Am 20. Juni 1942 griff eine SS-Einheit ihn und drei seiner Kommilitonen auf dem Weg zu einer Physik-Vorlesung auf. Am 24. saß er mit Dutzenden anderen im Zug nach Deutschland. Im böhmischen Pilsen mussten sie auf LKW umsteigen. Nach insgesamt acht Tagen Reise kamen sie in Weiden an. Das Arbeitsamt dort wies Viktor, Jan und Krzystof unseren Hof als Einsatzort zu. Fritz holte sie am 2. Juli mit dem Pferdefuhrwerk vom Bahnhof ab.
Viktor hat sein Schicksal hingenommen. Er sagte, er wäre noch jung und könnte sein Studium nach dem Krieg fortführen. Körperliche Arbeit sei schließlich auch zu etwas gut. Er hat immer positiv gedacht, obwohl er seine Familie in Krakau vermisste. Vor der Deportation hatte er sich nicht einmal von ihnen verabschieden können. Wenn das Heimweh ihn zu sehr plagte, erzählte er mir von seinem Vater, seiner Mutter Svetlana und seiner jüngeren Schwester Jana. Er hat heimlich nach Krakau geschrieben – die Briefe brachte ich zur Post – aber nie eine Antwort erhalten. Das hat ihn sehr bekümmert. »Im Krieg ist alles anders«, sagte er. Einmal hat er mir von der Errichtung des jüdischen Ghettos im Süden Krakaus und von den ersten Deportationen in Konzentrationslager erzählt. Als Augenzeuge klang sein Bericht ganz anders als die offiziellen Nachrichten im Rundfunk oder in den Wochenschauen im Vohenstraußer Kino. Ich war entsetzt, diese Leute hatten nichts verbrochen. Wir glauben doch alle an denselben Gott.
Auch die Arbeit lenkte Viktor vom Heimweh ab. Er und seine Kameraden waren fleißig und der Vater mit ihnen zufrieden. Er machte ihnen Zugeständnisse, trotz der Auflagen durch die Polen-Erlasse, mit denen man sie ausgrenzen wollte. Sie mussten einen Aufnäher mit einer gelb-violetten Raute und einem großen P darin gut sichtbar auf der Kleidung tragen, wie die Juden den Stern. Sie durften den zugewiesenen Wohnort nicht verlassen, nicht in die Kirche, in die Wirtschaft, ins Kino oder zum Tanzen gehen. Abends galt für sie generell ein Ausgangsverbot. Der Vater scherte sich nicht darum. »Während der Ernte oder wenn eine Sau Junge kriegt, brauche ich meine Leute zu jeder Tages- und Nachtzeit. Soll nur einer mich bei den Oberen verpfeifen, dem pfeif ich was!«, hatte er gesagt. Einen angesehenen Bürger und ein Parteimitglied wie ihn zu denunzieren, wagte keiner. In die NSDAP war er nur pro forma eingetreten, um sein Sägewerk und den landwirtschaftlichen Betrieb ohne Repressalien führen zu können. Diese drohten jedem Gewerbetreibenden, der sich widersetzte.
Der Vater machte keinen Unterschied bei der Herkunft seiner Arbeiter und sagte: »Behandle sie gut, dann arbeiten sie gut.« Ihre Unterkunft im Gesindehaus war geräumig und sauber, es gab einen Waschraum mit einer Zinkbadewanne und eigener Toilette. Das war nicht überall so. Wir hörten von brutalen Arbeitgebern, die ihre Fremdarbeiter aufs Schlimmste ausbeuteten, und von katastrophalen Lebensbedingungen in primitiven Unterkünften. Von der Sondersteuer auf den geringen Lohn und dem Abzug einer Pauschale für Kost und Logis blieben auch unsere drei Arbeiter nicht verschont, der Vater musste sie abführen. Er kompensierte es mit Annehmlichkeiten. Beim Essen saßen wir an einem Tisch, am Sonntag gingen wir nach der Morgenarbeit gemeinsam in die Kirche, wie eine große Familie.
Durch die Arbeit kamen Viktor und ich uns näher. Er war freundlich und charmant, hat mich nie bedrängt. Dann funkte es, an Weihnachten ʽ42 haben wir uns das erste Mal geküsst und an Silvester zum ersten Mal geliebt, in meiner Kammer. Sie lag im anderen Hausflügel, keiner konnte uns hören. Ging es dort nicht, trafen wir uns meistens im Heuschober über dem Stall. Wir passten immer auf, wir wussten was uns blüht, falls man uns erwischt. Wir haben uns wirklich geliebt und durften es nicht zeigen.
Wenn wir beieinanderlagen, entflohen wir der Realität. Viktor erzählte mir von den Wissenschaften, von Sternen und Planeten und aus den Büchern von Jules Verne. Die Geschichten haben ihn fasziniert, deshalb hatte er Physik studiert. Er konnte so lebendig erzählen, das fesselte mich. Ich nannte ihn Kapitän Nemo, wie aus ›20.000 Meilen unter dem Meer‹, und er mich Prinzessin Aouda, wie ›In 80 Tagen um die Welt‹. Alles was Liebespaare in der Öffentlichkeit tun, war uns verwehrt, kein Händchenhalten, keine Komplimente, kein Herzchen mit unseren Initialen in eine Baumrinde schnitzen. Die Heimlichtuerei war die Hölle. Oft malten wir uns das Leben nach dem Krieg aus, irgendwann musste er ja zu Ende sein. Wir glaubten daran. Frei sein, ein schönes Leben zu zweit führen, lachen, lieben, glücklich sein.
Ich weiß nicht mehr, ob wir an besagtem 2. Mai unvorsichtig gewesen waren oder schon beim Tanz in der Brauereiwirtschaft am Abend davor. Wir hatten uns sehr darauf gefreut. Beim Tanzen durften wir uns in der Öffentlichkeit berühren. Polka tanzten wir am liebsten, es hätte ewig dauern können. Trotzdem sind wir vor Mitternacht getrennt nach Hause gegangen. Am Sonntagmorgen mussten wir früh raus, die Tiere füttern. Später besuchten wir den Gottesdienst, wie immer. Nach dem Mittagessen und Küche aufräumen, sind die Eltern zu den Nachbarn zum Hutzern gegangen. Viktor und ich warteten eine Weile und trafen uns in der Scheune. Auf dem Heuwagen haben wir uns unterhalten und geschmust, zu mehr ist es nicht gekommen.
Vaters Brüller fuhr durch Mark und Glieder. Finster dreinblickend, in Begleitung von Fritz und Dorfpolizist Hofmann, sah er zu uns herauf. Fritz zerrte Viktor herunter und stieß ihn vor Vaters Füße.
»Dir werd ichs zeigen, sich an meiner Tochter zu vergreifen! Da ist man gutmütig, gibt einem Polaken Arbeit und das ist der Dank!« Der Vater verpasste Viktor Ohrfeigen. Die taten ihm weh, das Schimpfwort Polake – der Vater benutzte es zum ersten Mal – stach mitten in Viktors Herz. Das konnte ich sehen. Ich stieg vom Wagen, und bat den Vater, aufzuhören. Als ich mich zwischen ihn und Viktor stellen wollte, stieß er mich rabiat weg. Dann kam die Mutter und fragte was los sei. Fritz erzählte stolz, wie er uns erwischt hatte und jetzt gäbe es die Abreibung. Sie wollte von mir wissen, ob das stimmte. Ich gab es zu und sagte: »Wir haben uns lieb und küssen ist da nichts Schlimmes.«
Der Vater versetzte Viktor mit dem Handstumpf einen Schlag in die Magengrube. Durch die Ledermanschette spürte er selbst wenig. Viktor taumelte, ging zu Boden und krümmte sich vor Schmerzen. Der Vater geriet in Rage, nannte mich Polenliebchen und befahl der Mutter, mich rauszubringen. Sie zog mich am Arm, aber ich konnte mich wieder losreißen. Ich wollte Viktor helfen, den der Vater mit Stiefeltritten traktierte. »Dich ersteche ich mit der Mistgabel!«, drohte er. Ich flehte ihn an, aufzuhören und wollte dazwischengehen. Der Fritz stellte sich mir in den Weg, ich trat gegen sein Schienbein und huschte an ihm vorbei. Dann ging der Vater auf mich los und wollte mich schlagen. Die Mutter stellte sich schützend vor mich und drohte ihm: »Du vergreifst dich nicht an unserem Kind!«
Der Vater befahl Hofmann, er solle Viktor auf der Stelle aufknüpfen. Doch er weigerte sich, das würde seine Kompetenz als Hilfspolizist übersteigen. Dann wollte es der Vater selber tun. Hofmann warnte ihn, das sei Amtsanmaßung, er würde ihn anzeigen. Da gab der Vater nach. Von der Küche aus rief Hofmann Hauptwachtmeister Dirscherl an, den Leiter der Polizeidienststelle in Vohenstrauß. Sie war für Waldau zuständig. Die Mutter hat mich in meine Kammer gesperrt, damit ich dem Verhör nicht lauschen konnte. Das Fenster war zu klein, um hinauszuklettern. Als sie mich holte, war es schon dunkel und Viktor weggebracht worden. Keiner sagte, wohin. Ich fragte nicht, das hätte den Vater noch mehr erzürnt. Keiner sagte irgendetwas, die Ungewissheit, ob man die Wahrheit nicht doch aus Viktor herausgeprügelt hatte, quälte mich. Ein Gentleman wie er würde so etwas nie freiwillig ausplaudern. Bis zu diesem Tag waren wir mehrmals intim gewesen. Ich glaubte, unser Schicksal sei besiegelt. Viktor würde man hinrichten und mich kahlgeschoren ins Frauen-KZ nach Ravensbrück bringen, wie die Nazis es mit den meisten meiner Leidensgenossinnen machten. Tod und KZ schwebten wie dunkle Wolken über mir. Alle meine Träume zerplatzten.
Dirscherl befahl mir, mich auf den Stuhl zu setzen. Der Vater würdigte mich keines Blickes. Die Augen auf den Fußboden gerichtet, legte ich die Hände in den Schoß. Die Mutter löste meine Hochsteckfrisur, meine schönen, dicken Zöpfe fielen auf die Schultern. Als ich das Knirschen der Schere so nah am linken Ohr vernahm, biss ich die Zähne zusammen und schloss die Augen. Ich hörte genau, wie sie die Zöpfe abschnitt. Mir blutete das Herz, seit meiner Kindheit hatte ich das Haar wachsen lassen. Noch lange Zeit danach mochte ich mich nicht mehr im Spiegel ansehen.
Die Augen öffnete ich erst, als Dirscherl »Das ist genug!« sagte. Meine Zöpfe lagen neben meinen Füßen, drumherum Haarbüschel. Ich fuhr mit einer Hand über den Kopf, es waren noch Haare da, raspelkurz. Die Glatze und die öffentliche Demütigung waren mir erspart geblieben. Später hörte ich von anderen Frauenschicksalen. Manche trieb man wie Vieh durch den Ort, ein Schild ›Polendirne‹ oder ›Ich bin aus der Volksgemeinschaft ausgestoßen‹ um den Hals – ein Spießrutenlauf, bei dem sie beschimpft und bespuckt wurden. Andernorts stellte man sie nach der Tortur an den Pranger, um ein Exempel zu statuieren und als Warnung, sich nicht mit Feinden des deutschen Volkes einzulassen. Die deutsche Rasse sollte sich nicht mit anderen, minderwertigen vermischen. Das war Hitlers Arierwahn.
Die Mutter wollte die Zöpfe aufbewahren, doch der Vater befahl ihr, sie mitsamt den Haarbüscheln zu verbrennen. Widerwillig warf sie alles in den Herd. Der typische Horngeruch verbreitete sich in der Küche. Die Mutter band mir ein Kopftuch um. Der Vater legte Hundert Reichsmark auf den Küchentisch. »Nimm das Geld und verschwinde! Und lass dich hier nie wieder blicken!« Die Mutter flehte ihn an, sich nicht zu versündigen, und sein einziges Kind zu verstoßen. Er wollte nichts hören. »Sie geht, sag ich!«, waren seine letzten Worte. Ich habe das Geld genommen und bin weinend hinausgelaufen, die Mutter mir hinterher. Der Vater hielt sie an der Tür zurück, aber sie konnte sich losreißen und mich noch einmal drücken. »Tut mir so leid«, sagte sie leise.
Unser Pfarrer, der Herr Wölfel, hatte Wind von der Sache bekommen. Er stellte den Vater vor der Haustür zur Rede und hielt ihm eine gehörige Standpauke. Er drohte sogar, er bräuchte gar nicht mehr zur Beichte erscheinen, für seine Sünden soll er in der Hölle schmoren. Es half nichts, der Vater blieb stur. Wölfel bot mir Unterschlupf im Pfarrhaus. Am Abend erzählte er mir, Viktor sei ins KZ nach Flossenbürg überstellt worden, wie ich es befürchtet hatte. 1943 ging das direkt, ohne Umweg über die Gestapo. Die Mutter brachte später eine Tasche mit Kleidung, einem Paar Schuhen und Andenken. Mein Spitzentaschentuch von der Firmung war auch dabei, darin eingewickelt mein schöner geschnitzter Hornkamm. Sie hatte die Tasche vor der Haustür abgestellt, geklingelt und war wieder gegangen, bestimmt wegen dem Vater. Ich habe sie nicht mehr gesehen.
Am Montag besorgte mir Pfarrer Wölfel eine Mitfahrgelegenheit. Ein Landwirt aus Erpetshof musste mit dem Fuhrwerk zwei geschlachtete Schweine in die Wehrmachtskaserne nach Weiden liefern. Er hat nicht viel geredet, aber mir Glück gewünscht, als er mich am Bahnhof absetzte. Ich wollte nur weg und nahm den erstbesten Zug, er ging nach Regensburg. Von dort fuhr ich weiter nach München.
Ich war zum ersten Mal dort und ebenfalls zum ersten Mal sah ich mich mit Zerstörung und Trümmern in großem Ausmaß konfrontiert. Die Innenstadt war damals bereits mehrmals Ziel von Luftangriffen der Engländer gewesen, der Zugverkehr vom Hauptbahnhof nur eingeschränkt möglich, nicht alle Gleise konnten befahren werden. Ich kannte mich nicht aus und marschierte los. In der Innenstadt traf ich auf Leute, die mir rieten, lieber nicht hier zu bleiben. Wo sollte ich hin? Am Viktualienmarkt stieg ich kurzerhand in die nächste Tram und landete in Grünwald, am Derbolfinger Platz. Damals gab es ein kleines Wartehäuschen, eine Litfaßsäule, Bäume und die Wendeschleife zurück nach München. Für mich war in Grünwald erstmal Endstation.
Ich bin einigen Leuten zum Marktplatz gefolgt und entdeckte einen Gasthof an der Ecke, den Stadelwirt. Ich hatte Hunger und bestellte eine Suppe, natürlich auf Hochdeutsch. Die Mutter hat immer gepredigt »Wenn man wohin geht, spricht man nach der Schrift«, trotzdem fiel der Wirtin mein Dialekt auf. Das war die Vroni Sedelmayer, die du auch noch gekannt hast, mein lieber Martin. Sie fragte, woher ich käme und was mich allein hierher verschlagen hätte. Mir kamen sofort die Tränen. Sie brachte mich nach hinten, in ihr kleines Büro, stellte mir einen Stuhl hin und sagte »Setz dich und erzähl.«
Wie ein Wasserfall sprudelte es aus mir heraus, endlich ein vernünftiger Mensch, der mir zuhörte. Dann zog ich das Kopftuch herunter. Die Vroni nahm mich in den Arm und sagte, alles würde wieder gut werden und die Haare wieder wachsen. Dann fragte sie, ob ich schwanger von Viktor sei. Damals wusste ich es nicht sicher, meine Tage kamen immer sehr unregelmäßig. Jedenfalls hielt es die Vroni für unchristlich von meinem Vater, sein eigenes Kind zu verstoßen. Andere wären froh, welche zu haben, wie sie und ihr Mann Anton. Ihre Ehe war nicht mit diesem Glück gesegnet gewesen. Die beiden nahmen mich auf. Ich half in der Wirtschaft und im Haushalt. Die Vroni hat mir auch das Kaufmännische beigebracht, Buchführung und Wirtschaftsrechnen.
Ab Juli konnte man es sehen, ich erwartete Viktors Kind. Allein, schwanger, eine Welt brach zusammen. Das Kleine würde ohne seinen Vater aufwachsen müssen. Ich habe viel geweint damals, aber Vroni und Anton haben mir Mut gemacht. »Gemeinsam schaffen wir das«, sagten sie. Sie waren so herzensgute Menschen. Als mein Bauch dicker wurde, brauchte ich nur noch leichte Arbeiten zu verrichten.