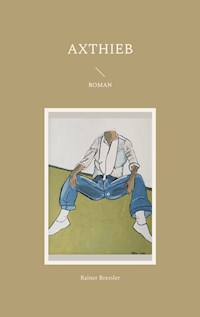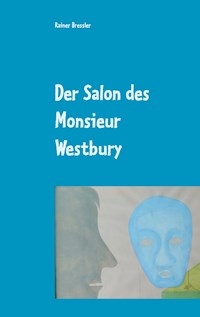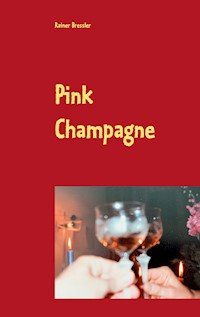Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor geht seinem tatsächlich gelebten und heil überstandenen Hass auf seinen inzwischen verstorbenen Vater auf den Grund. Er bemüht sich, ein möglichst objektives Porträt seines Vaters zu zeichnen. Dieses Mannes, der 1937 aus Deutschland in die Schweiz kommt, die zu seinem Exil wird. Wo er eine Schweizerin heiratet und die Geschichte ihren Lauf nimmt. Im Interesse einer intimen Anschaulichkeit jenseits der biografischen Fakten wird die Geschichte in schonungsloser Offenheit aus den unterschiedlichsten Perspektiven frei erfunden und flüssig erzählt und verdichtet sich zu einem humorvollen Familien- und Gesellschaftsroman, der nicht verschweigt, dass der vermeintliche Hass des Sohnes auf den Vater die verkappte Sehnsucht nach der Liebe des Vaters ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Bressler, Jurist im Ruhestand und Schriftsteller, geboren 1945, ist Schweizer und lebt in Zürich. In den Jahren 1980 bis 1993 profilierte er sich als Hörspielautor, dessen Hörspiele von Radio DRS produziert und ausgestrahlt wurden.
Bisherige Veröffentlichungen:
7 Hörspiele:
Tom Garner und Jamie Lester; Morgenkonzert; Folgen Sie mir, Madame; Aufruhr in Zürich; Nächst der Sonne;
Geliebter / Geliebte; Gaukler der Nacht; Beinahe-Minuten-Krimi
Produziert und ausgestrahlt in den Jahren 1979 bis 1993
Geliebter / Geliebte. 8 Hörspiele, Karpos Verlag, Loznica 2008
Privatzeug 1856 bis 2012. Versuch einer Spurensuche, 5 Bände:
Spur 1 Reisen; Spur 2 Spielen; Spur 3 Schreiben; Spur 4 Dichten; Spur 5 Weben
BoD 2012 bis 2016
Pink Champagne, satirischer Roman, BoD 2020
Inhaltsverzeichnis
EIN JUNGER DEUTSCHER 1937 IN DER SCHWEIZ
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
VATER UND SOHN IM LAUFE VON 40 JAHREN
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
DER SOHN UND DER VERSTORBENE VATER ALS GESPENST
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
EIN JUNGER DEUTSCHER 1937 IN DER SCHWEIZ
1.
Kurz nach Mitternacht bei Mondschein in einer klaren Nacht, wie sie idyllischer nicht sein könnte, schwebt gleichsam lautlos am 19. Oktober 1937 eine elegante Limousine über eine hübsch verschlafene, von hübschen Einfamilienhäuschen gesäumte Durchgangsstrasse durch ein „währschaft“ (solide) bürgerlich anmutendes Aussenquartier der Schweizer Hauptstadt Bern. Chauffeur S. fährt seinen Chef, Professor K., Direktor der „Heil- und Pflegeanstalt“ (Psychiatrische Universitätsklinik) Waldau, vom Hauptbahnhof Bern zurück in die im Volksmund Irrenanstalt genannte Klinik.
K. kehrt mit einem zu später Stunde pünktlich in Bern eingetroffenen Zug vom Besuch eines psychiatrischen Kongresses in Berlin heim. S. muss, falls er seinem Ruf als zuverlässiger Chauffeur gerecht werden und als Chauffeur von K. überleben will, trotz der ungewohnten Arbeitszeit zur Stelle sein.
K.‘s Vortrag hatte seine deutschen Kollegen, wie ihm gegenüber mehrmals betont worden war, zu tiefst beeindruckt. Sie hatten ihn mit Lob überhäuft. Die in jüngster Zeit aufgekommenen Berührungsängste etlicher Schweizer Kollegen über eine Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen kennt K. nicht. Er empfindet diese Zusammenarbeit frohlockend als für ihn höchst einträglich. Dass gewisse hiesige Kollegen über sein Verhalten ihre Nasen rümpfen, stört ihn nicht. So kommen sie ihm im fachlichen Austausch mit Deutschland nicht ins Gehege. Er überlebt im harten beruflichen Konkurrenzkampf glorios. Er profitiert in Deutschland von einer herausragenden Stellung. K. mag die forsche, etwas vollmundige und klar dezidierte Art der Deutschen.
S. bremst die Limousine ab. K. erwacht abrupt aus seinen Gedanken. Richtet sich im Fond der Limousine auf. Schaut aus dem Fonds der Limousine über die Schulter von S. in die durch die Windschutzscheibe ihnen hell entgegenkommende Dunkelheit mit den in dieser Beleuchtung gespenstisch wirkenden Schattenrissen der Stämme und Baumkronen der Allee-Bäume. Im Schritttempo steuert S. das Vehikel von der Durchgangsstrasse in das Park-Areal der Klinik. Die Allee ist die schnurgerade Zufahrt zur Klinik. Zum imposanten Hauptgebäude im neoklassizistischen Stil. Das sich in der Ferne abzeichnet.
Im Park befinden sich neben dem Hauptgebäude, den weiteren Spitalbauten für die Patientinnen und Patienten, den Wirtschaftsgebäuden und Stallungen auch die herrschaftliche Wohnung K.s und seiner Familie, sowie Wohnungen und Zimmer des ärztlichen Personals und weiterer Angestellter der Klinik.
S. stutzt. Im Kegel des Scheinwerferlichts taucht mitten in dem nun hell erleuchteten Teil der Allee auf halbem Weg zum Hauptgebäude ein eng verschlungenes, im grellen Licht klar erkennbares Menschenknäuel auf. Das Knäuel löst sich im Nu aus der Verschmelzung und wird zu einer erschreckt ins Licht starrenden Frau und einem ebenfalls erschreckt ins Licht starrenden Mann. Die beiden huschen sogleich in den Randbereich des Scheinwerferlichts, von der Mitte des Wegs an den Rand bei den Baumstämmen. Geben dem Auto den Weg frei. S. erkennt die beiden. Beide Angestellte der Klinik. Der spontanen Freude über das Mitwissen der Beziehung der beiden nun von ihm ertappten, weicht die ebenso spontane Verunsicherung, ob der Chef die beiden ebenfalls gesehen und erkannt hat. Was für die beiden fatal enden könnte. S. verlangsamt die Fahrt spontan. Wird gleich an den beiden nun links im Dunkeln stehenden Personen vorbeifahren.
„Vèrrèckt, dè cheibè Usländèr mit dèrè tummè Babè, wo uf siin Schmuus inèflügt (Verflixt, der vermaledeite Ausländer und dieses dumme Püppchen, das auf seinen Schmus reinfällt)“, entwischt S. kaum hörbar, jedoch mit klar vernehmbar ironischem Unterton die als Selbstgespräch gespielte, pointiert provozierend platzierte Bemerkung. Er parodiert zur Benennung der beiden die erst kürzlich mit echter Irritation aufgeschnappte abwertende Redewendung des Chefs. Konfrontiert diesen nun schadenfreudig mit dessen in seiner, S.‘s, Erinnerung kleben gebliebenem lockeren Spruch. Doktor B. ist für S., obwohl aus Deutschland stammend, ganz in Ordnung. Die immer fröhliche Krankenschwester Hedy ist zudem eine Sünde wert. S. hätte sie gerne selber angemacht. Er beneidet den Deutschen um dessen Glück bei den Frauen. Die Frauen finden es nun mal schicker, mit einem geschniegelten deutschen Arzt, als mit einem ungehobelten kleinen Schweizer Chauffeur und Mädchen für Alles anzubändeln. Ihn erstaunt, dass die beiden, die am Morgen, im Gegensatz zu anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, immer pünktlich zur Arbeit erscheinen, zu so später Stunde erst vom Feiern in der Stadt heimkehren.
K. ärgert sich über die unverschämt ihn, den Chef, nachäffende und deplatzierte Bemerkung von Chauffeur S.. Was masst dieser S. sich an, eine scherzhaft hingeworfene Bemerkung seines Chefs aus dem Zusammenhang zu reissen und gleichsam als Vorwurf provozierend nachzumachen. K. nimmt die beiden im Lichtkegel aufgeschreckten Gestalten wahr. Erkennt die beiden Missetäter ebenfalls. Ärgert sich über deren Unverschämtheit, sich in aller Öffentlichkeit in flagranti zu zeigen. Wo er, K., der Chef, B., der selbst als lediglich temporärer Praktikant dem ärztlichen Personal zuzurechnen ist, klar ein Techtelmechtel mit einer Krankenschwester der Klinik verboten hatte.
K. hatte B. anlässlich einer geselligen Tanzveranstaltung des Personals in der Klinik vor wenigen Tagen oder Wochen erst dabei ertappt gehabt, wie er die Grenzen des Anstands klar überschritten und grinsend, auf die gebotene Distanz vor aller Augen pfeifend, mit dieser ‚tummè Babè‘, einer Krankenschwester der Klinik, lasziv getanzt hatte. K. hatte B., nicht ohne damit einen kleinen Aufruhr zu erregen, beiseite genommen. Ihm klipp und klar gesagt, dass Techtelmechtel zwischen Ärzten und Krankenschwestern der Klinik strikte verboten sind. Sollte B. als kleiner Praktikant es erneut wagen, gegen dieses Verbot zu verstossen, fliege er in hohem Bogen aus seinem ihm aus reiner Menschenfreundlichkeit gewährten Praktikum an der Klinik raus. Auch als Doktorvater stehe er, K., ihm dann nicht länger zur Verfügung. Dann möge er sehen, wo er bleibe. Gegenüber seinem Chauffeur S. hatte K. sich damals, obwohl dieser den Vorfall damals mitbekommen hatte, lachend gebrüstet, dass er den ‚cheibè Usländèr‘ für sein Rumgemache mit dieser ‚tummè Babè, wo uf siin Schmuus inèflügt‘, ganz schön in den Senkel gestellt habe.
Sollen diese jungen Leute anderswo über die Stränge schlagen. Doch nicht in seiner Klinik, wo Sauberkeit und Anstand zu herrschen haben. Dieser freche Lackaffe scheint es darauf abgesehen zu haben, ihm, K., auf den er als Doktorand noch angewiesen ist, ins Gehege zu kommen. Was denkt dieser kleine Lümmel sich! Solche Taugenichtse, die ‚èm Tüüfel ab èm Charè gheit sind‘ (dem Teufel vom Wagen gefallen sind), haben in seiner Klinik nichts verloren. K. versteht nicht, wie er auf diesen Schnösel aus Deutschland hatte hereinfallen können. K. ist empört. Jetzt schlägt es 13!
K. sinnt schadenfreudig auf Rache. Gleich wird die Limousine an den Beiden, die links in das Dunkle vor die Baumstämme zur Seite getreten sind, vorbeigleiten. K. wendet seinen Kopf nach links. Schiesst seinen Sperberblick durch das Seitenfenster links nach draussen. Und tatsächlich, im Bruchteil einer Sekunde leuchtet die erschreckte Fratze von B., der fassungslos in das Innere der Limousine starrt, auf. K. triumphiert. B. fliegt in hohem Bogen aus der Klinik. Mit einer Abreibung, dass ihm Hören und Sehen vergehen wird.
K.s Freudenexplosion kippt um in einen Schrecken. Er darf sein Gesicht unbedingt nicht verlieren, weder vor B., noch vor S. und nicht vor dem Personal seiner Klinik. Er muss für Alle wahrnehmbar hart durchgreifen und gleichzeitig darf er kein zusätzliches Geschirr zerschlagen. Diplomatie und Fingerspitzengefühl sind gefordert. Er sagt laut und deutlich, gespielt als Selbstgespräch, an die Adresse von S. zur, wie er hofft, weiteren Verbreitung seiner Worte, der saubere B. werde etwas erleben! K. ist sich sicher, dass der Vorfall dank S. als Zeugen im Nu in der Klinik bekannt sein wird. Dann kann K. seinen Ruf als auf Moral und Anstand setzender und Missetäter streng, doch konsequent bestrafender Chef bestätigen. Noch immer ist K. unverständlich, wie er sich von B. so hatte täuschen lassen.
Vor Jahresfrist hatte ihn ein ihm flüchtig von einer Fachkonferenz in Berlin bekannter Kollege angefragt, ob er bereit sei, einen jungen Deutschen mit ärztlichem Staatsexamen aus Breslau als Doktoranden anzunehmen. Dem jungen Mann für die Dauer der Ablegung des Doktorexamens an der Universität Bern und für die Zeit, bis er seine Doktorarbeit geschrieben hat, ein Praktikum an der Universitätsklinik Waldau zu gewähren. K. hatte es geschmeichelt, dass sein Ruf bis nach Deutschland gedrungen war. Ein junger Deutscher ihn sogar als Doktorvater begehrte. Woraus K. schloss, dass es sich bei dem jungen Deutschen um einen aussergewöhnlichen Studenten handeln müsse. Sieben Monate wurden vereinbart. Mai bis und mit November 1937. Und jetzt im Oktober diese schöne Bescherung, seufzt K..
B. hatte sich vorerst als im Grunde patenter Kerl herausgestellt. Von kleinem Körperwuchs, schlank und wendig. Gibt viel auf sein Äusseres. Ist immer korrekt und gut gekleidet. Und gepflegt. Auf den ersten Blick wirkt er wissbegierig, von besten Manieren, äusserst höflich. B. zeigt sich überschwänglich begeistert vom Thema, das K. ihm als Doktorarbeit vorschlägt. „Die Kinder im Wahnsystem der Mutter“. B. hört nicht auf zu betonen, wie sehr ihn just dieses Thema interessiere. Als etwas distanzlos und deplatziert seinem Doktorvater gegenüber wertet K. die anbiedernde Bemerkung B.‘s, wie glücklich er darüber sei, in ihm, K., einen in Fachkreisen berühmten und vielseitig interessierten Mentor gefunden zu haben. „Falls ich es richtig mitbekommen habe, sind Sie, verehrter Herr Professor, insgeheim schriftstellerisch tätig als Autor von Gedichten und Bühnenwerken, genauso wie übrigens auch ich.“ Als geradezu ungehörig findet K. das von B. wenige Tage später ihm, dem Professor und Doktorvater, gegenüber geäusserte Ansinnen, das Thema auf „Die Kinder im Wahnsystem der Eltern“ auszuweiten. So sehr selbst K., der ausgewiesenen Autorität im Fach, einleuchtet, dass der Vorschlag dieses jungen Schnösels durchaus Sinn macht, ist er dennoch pikiert vom unverfrorenen Vorwitz B.‘s, ihm, seinem Doktorvater gegenüber einen solchen Vorschlag zu artikulieren. K.s Bauchgefühl sagt ihm, sich mit diesem jungen Mann einen harten Brocken eingehandelt zu haben. Dieses Gefühl bestärkt sich im Laufe der Tage und Wochen immer mehr. Zwar beeindrucken ihn B.‘s zackiger Schneid und sein zackiges Auftreten, wie es den Hiesigen total abgeht. Gleichzeitig aber kriegt K. mit, wie B. sich in der Gesellschaft des Klinikpersonals als Lebemann und Frauenheld entpuppt, der alle in den Sack steckt und von allen geliebt und bewundert wird. Ein Blender, ein geschniegelter Lackaffe, der seine humanistische Bildung wie ein Plakat vor sich herträgt. Dabei trotz allem Eifer ein Taugenichts und Angeber. K. wird klar, dass B. zwei Gesichter hat. Ein scheinbar ernstes, in seiner übersteigerten Ernsthaftigkeit gleichsam zur Farce werdendes Gesicht, wenn er ihm, K., gegenüber steht. Und ein lachendes Gesicht, wenn er sich von seinem höchsten Vorgesetzten unbeobachtet fühlt. Dann kommt die Geschichte mit dieser Krankenschwester. Und nun der unverschämte Verstoss gegen ein striktes und B. klar zur Kenntnis gebrachtes Verbot.
So neugierig K. auf die Vernetzung B.s in Breslau und Berlin mit deutschen Koryphäen auf dem Gebiet der Psychiatrie ist, hält dieser sich immer bedeckt über seine tatsächlichen Beziehungen. Wimmelt ihn, K., frech grinsend mit ausweichenden Antworten und ironischen Bemerkungen ab. K. muss daraus schliessen, dass es mit der Vernetzung von B. in Fachkreisen nicht weit her sein kann. K. empfindet sein Entgegenkommen, den jungen Mann, als Doktoranden und als Praktikanten in seiner Klinik zu nehmen, als einen Reinfall. Schmeisst K. B. jetzt, wie es sich gehören würde, raus, bevor dieser ihm seine – K. ahnt es bei diesem Taugenichts – mangelhafte und zu kurze Doktorarbeit, die kurz vor dem Abschluss stehen muss, zur Durchsicht und zur Empfehlung zur Abnahme durch die Fakultät endlich überreicht hat, könnte dieser nach seiner Rückkehr nach Deutschland gegen ihn, dem die Beziehungen zu deutschen Kollegen so wichtig sind, hetzen und ihn dort schlechtmachen. Schliesslich weiss K. nicht mit Bestimmtheit, ob B. in Deutschland nicht doch über Beziehungen zu einflussreichen Fachkreisen auf dem Gebiet der Psychiatrie verfügt. Dieses Risiko muss K. unbedingt vermeiden. Die Situation erfordert geschicktes Vorgehen. Falls sich B.s Doktorarbeit wider Erwarten als nicht total mangelhaft erweisen sollte, wird K. sie mit Vorteil mit einer besten Benotung durchwinken. Doch ohne eine gehörige Abreibung für seine freche Provokation und Ungehörigkeit darf B. nicht davonkommen. Ein Tritt in seinen Allerwertesten. Dann dorthin zurückgesandt als Muster ohne Wert, woher er gekommen ist. Der Oberarzt, unter dem B. tätig ist, muss die Abreibung B.s vornehmen! K. wird diesem Oberarzt strikte Anweisung geben.
Diese Gedanken blitzen im Bruchteil einer Sekunde durch K.s Kopf, während sein Blick links aus dem Fenster gerichtet ist, um den Übeltäter und seine Gespielin beim Vorbeifahren für einen kurzen Moment durch das Seitenfenster aus dem Fond der Limousine im Düstern anzuschauen. Tatsächlich, die Birne B.s mit entgeistertem Gesichtsausdruck in den dunkeln Fonds der Limousine starrend saust vorbei. K. hat B. gesehen. Und B. scheint ihn, K., wahrgenommen zu haben!
Hans Günther B. erhascht im dunklen Fond der mit tiefem Brummen an ihm und Hedy vorbeigleitenden Limousine hell herausstechend das Gesicht und den durchdringend bösen Blick von K., der steif wie ein Pappkamerad im Innern der Limousine thront. Hans Günther klappern spontan Zähne und alle Glieder. Der Gedanke, verflixt und zugenäht, nun ist es aus, blitzt Hans Günther mit zünftigem Nachflackern ins Bewusstsein. Er ahnt im Bruchteil dieser Sekunde die Katastrophe. Den sofortigen Rausschmiss. Das Scheitern mit der Doktorarbeit. Die härteste Arbeit während der letzten Monate hier in Bern – alles für die Katz! Ausgeträumt der schöne Traum von beruflichem Erfolg als Arzt in Breslau oder Berlin, von der Heirat mit seiner Uschi in Breslau und vom sehnlichst erwarteten Stammhalter, der zu Ehren Rilkes, des Dichter-Kollegen, Rainer heissen muss. Hans Günther blitzt spontan der Gedanke auf, dass er erst jetzt, im Nachhinein das Verhältnis zwischen ihm und seinem Doktorvater und Chef als seit Beginn ständigen Schattenkampf erkennt, der nun in einen offenen Kampf abgleiten wird.
Eine Hand – eine weibliche Hand – berührt Hans Günther. Wärme durchrieselt seinen zuvor bei der Wahrnehmung von K.s maskenhafter Fratze zum Eisklotz erstarrten Körper. Die Berührung durch die wärmende Hand und die nachfolgende Umarmung, die er nur zu gerne und heiss erwidert, bringen jegliches Eis zum Schmelzen. Die Wonne besiegelt mit einer nicht abbrechenden Folge von heissesten Küssen. Mitten in der Allee, die zum Hauptgebäude der Klinik führt. In dieser so herrlichen Oktobernacht bei Vollmond, am 19. Oktober 1937.
Bei Arbeitsantritt am nächsten Morgen wird Hans Günther als Erstes von K.s Sekretärin unverzüglich zu seinem Oberarzt befohlen. Hans Günther ist schrecklich aufgeregt. Mit seinem Oberarzt versteht er sich zwar bestens, doch wird dieser im Auftrag K.s handeln müssen. Hans Günther befürchtet das Schlimmste. Dass dieser sonst so locker kollegiale Oberarzt diesmal ganz andere Saiten aufziehen muss. Bereits im Korridor vor dem Büro des Oberarztes stösst Hans Günther auf diesen. Nähert sich ihm mit gesenktem Blick. Hoffend, dass der schreckliche Moment bald vorüber sein wird.
Der Oberarzt hält Hans Günther mit Brachialgewalt fest. Schüttelt ihn kräftig. Bis Hans Günther zu ihm aufschaut. Da lässt der Oberarzt Hans Günther los. Wirft sich Hans Günther gegenüber in Positur. Setzt eine strenge, bitterböse Miene auf. Wie Hans Günther sie an ihm noch nie gesehen hat. Hans Günther fleht zum Himmel um eine glimpfliche Landung. Der Oberarzt beginnt mit seiner zur Faust geballten Rechten und dem in die Höhe ragenden, ausgetreckten Zeigefinger vor Hans Günthers Gesicht herumzufuchteln. Stösst dabei mit drohender Stimme aus, „mei mei mei!“ Hans Günther ahnt, dass etwas nicht ganz stimmt. Dass der Oberarzt bei seiner Drohgeste das Lachen unterdrückt. Dass die übertrieben heftige Drohung bloss gespielt ist. Hans Günther ist mit dem Idiom seines Gastlandes und auch konkret mit dem Schweizer Dialekt bereits so vertraut, dass er den Drohgehalt der sonst inhaltslosen Silbenfolge ‚mei mei mei‘ durchaus versteht. Spontan stellt er sich blöd.
„Falls Herr Oberarzt gestatten, wir sind nicht mehr im Wonnemonat Mai. Es ist bereits Oktober!“
Beide brechen in Lachen aus. Mit verstohlenen Blicken nach links und rechts nimmt der Oberarzt wieder eine ernsthafte Haltung an. Hans Günther tut es ihm gleich.
„Du weisst genau, dass es dir als Arzt strengstens verboten ist, mit einer Krankenschwester der Klinik rumzumachen. Noch einmal und du wirst etwas erleben. Der Chef hat mich beauftragt, dir eine tüchtige Abreibung zu verpassen. Du bist gewarnt“, sagt der Oberarzt mit strenger, fester, lauter Stimme, um Hans Günther anschliessend zuzuraunen, „so, jetzt habe ich den Befehl des Chefs ausgeführt und dich in den Senkel gestellt. Lass dich das nächste Mal bitte nicht mehr erwischen. Etwas mehr Diskretion. Obacht, Chef im Anzug! Mime einen geschlagenen Hund.“
Der Oberarzt lässt seinen Blick diskret in die Richtung schnellen, woher Gefahr im Anzug ist.
Hans Günther schnauft kurz durch und geht dann in demütiger Haltung und lächelnd auf K. zu. Mit Bücklingen, um anzudeuten, dass er dem hohen Chef etwas mitteilen möchte.
„Falls sie die leidige Angelegenheit anzusprechen wünschen, schenken Sie sich die Mühe. Der Oberarzt wird Ihnen klar gemacht haben, was Anstand und Ehrgefühl von einem angehenden Arzt erfordern.“
„Herr Professor, sie haben recht wie immer. Ich wollte sie um einen Termin bitten. Ich habe meine Doktorarbeit beendet und möchte sie ihnen abliefern.“
„Lassen sie sich einen Termin von meiner Sekretärin geben. Sonst noch was? Ich bin in Eile.“
Hans Günther schnauft auf. Glück gehabt. Die Sache ist glimpflich abgelaufen. Während er dies bedenkt, blitzt spontan der Gedanke auf: und was geschieht mit Hedy? Voller Schrecken denkt er, dass sie, die Ärmste, den Sanktionen der Oberschwester ausgeliefert ist und sich bestimmt nicht zu wehren weiss. Er schämt sich so sehr, dass er die ärmste Hedy in eine solche Situation gebracht hat. Kurzentschlossen eilt er in die Stadt, um für Hedy eine Dose Konfekt zu kaufen. Unterwegs im Bus kritzelt er mit seinem Pelikan Füller auf ein Papier das Mini-Gedichtchen, das ihm beim Erwachen eingefallen war und in seiner Erinnerung plötzlich wieder da ist, so dass er es aus seinem Gedächtnis niederschreiben kann. ‚O Psychiater, junger / Lass ab vom Liebeshunger / Zur holden Schwesternschaft. / Es könnten sonst wir Alten / Nicht mit Euch Tempo halten, / Drum opfert Euch der Wissenschaft!‘ Hans Günther hofft, dass niemand der Klinik seine kurze Abwesenheit bemerkt. Er ersteht in der Konditorei eine hübsche Dose Konfekt. Klebt darauf den Zettel mit dem selbst verfassten Vers.
Zurück in der Klinik, kaum ist die Luft rein, schleicht Hans Günther sich an einen versteckten Ort, aus dem er Hedy und Hedy ihn erspähen kann. Diskret winkt er sie zu sich. Zu seinem Erstaunen ist Hedy vergnügt. Freut sich riesig über die Schachtel Konfekt. Gibt Hans Günther als Dank einen Klaps auf rechte Wange und wirft gespielt vorwurfsvoll hin, „gemein, du willst dass ich dick werde!“ Dann fallen sie sich spontan in die Arme. Um mit verstohlenen Blicken in die Runde gleich wieder auseinander zu schnellen. Hedy verzieht ihren Mund zu einem Grinsen.
„Der Anschiss der Tante Oberin hat mir klar gemacht, dass ich wegen der Kündigung meiner Stelle in der Waldau kein schlechtes Gewissen zu haben brauche. Mit der Kündigung vor einiger Zeit lag ich goldrichtig. Dass sie versucht hat, mich nochmals fertig zu machen, ist unter aller Sau. Gratuliere mir zu meiner neuen Stelle in der Bircher Benner Klinik in Zürich!“
Hans Günther, soeben noch himmelhoch jauchzend, hauen die ihm wie nebenher von Hedy an den Kopf geworfenen Worte aus den Socken. Er weiss nicht mehr, was er denken soll. Seine Geliebte hatte ihm während Tagen oder Wochen Wichtigstes verschwiegen gehabt.
„Schau nicht so entsetzt drein! Zürich ist nicht ab der Welt. Besuche mich in Zürich.“
Hans Günther grübelt nicht lange. Er raunt Hedy ins Ohr, „jede freie Minute werde ich bei Dir in Zürich sein. Wart’s nur ab!“
Hedy stösst ihn lachend weg.
„Ich muss wieder! Und danke für das Konfekt.“
„Und hoffentlich auch für den so hübsch eigens für dich gedichteten Vers.“
„Ach ja.“
Hans Günther hasst es, von neuen Entwicklungen, die er sich anders vorgestellt hatte, überrollt zu werden. Klar, bezüglich Hedy hatte er keine klaren Vorstellungen gehabt. Mit ihr geniesst er den Augenblick. Doch nun, wo sie nach Zürich ausschert, er es bloss zufällig erfährt, sie ihm diese Veränderung lange Zeit verschwiegen hatte, muss er die bisher zwischen ihnen geherrschte sorglose Vertrautheit hinterfragen. Sein Vertrauen zu Hedy bekommt einen Knick. Zum Glück hat er noch seine Hedy bisher verschwiegene Uschi in Breslau. Die dort auf ihn wartet. Die er nun nicht, wie er befürchtet hatte, vor die vollendete Tatsache einer Trennung stellen muss. Er ist heilsfroh, dass er seinen Doktor bald in der Tasche haben wird und endlich nachhause abhauen kann. Die mündliche Doktorprüfung an der Universität Bern hatte er im Sommer bereits bestanden. Die Praktikantenstelle in der Waldau läuft Ende nächsten Monat aus. In den nächsten Tagen wird er seine fixfertige Doktorarbeit K. abliefern. Bis Ende Jahr ist alles unter Dach und Fach. Und er glücklich zuhause, in den Armen seiner Flamme in Breslau, die er baldmöglichst heiraten und mit der er einen strammen Stammhalter mit Namen Rainer zeugen wird.
Wolfgang F. lädt Hans Günther zur Feier seines Doktorhutes in den Kursaal ein. F. hat es geschafft. Und den ganzen Kleister mit dem Doktorat hinter sich. Im Kursaal wartet eine ungarische Damenkapelle mit flotten Weisen auf.
F. kommt wie Hans Günther aus Breslau. Zuhause hatte Hans Günther ihn nicht gekannt gehabt. F. ist der Sohn von Freunden von Mottl und Vatel, den Eltern von Hans Günther. Er war nach Bern gekommen, um hier seinen Doktor in Pharmazie zu machen. Mottl hatte Hans Günther mitgeteilt, dass der Sohn von Freunden, eben Wolfgang F., ebenfalls in Bern doktoriere, und Hans Günther dessen Anschrift mitgeteilt. Damit sie beide in der Fremde nicht total verloren seien, wäre es doch hübsch, sie würden Umgang pflegen, was die beidseitigen Eltern freuen täte. Hans Günther fühlt sich in Bern keineswegs verloren. Hat seit Beginn seines Bern-Aufenthalts äusserst vergnüglichen Umgang mit den Kollegen der Waldau. Ist aber immer neugierig auf neue Bekanntschaften. F. ist ein pingeliger, korrekter Typ. Von Zeit zu Zeit treffen sie sich in Tanzlokalen, um den hiesigen Wein und die Berner Mädels kennenzulernen.
Hans Günther und F. sitzen zusammen im Kursaal bei Blauburgunder Wein und feurigen Klängen der ungarischen Frauenband.
„Und stellen sie sich vor, B., ich habe bereits die Zusage für eine Stelle in einer Apotheke. In Shanghai. Nächste Woche reise ich nach Marseille und dann dampfe ich ab ins ferne China. Meine Verlobte zuhause hat unabhängig von mir ebenfalls eine Stelle in Shanghai gefunden. Sie wird in wenigen Monaten nachreisen. Bin ich nicht ein Glückspilz?“
Hans Günther gratuliert F. überschwänglich, obwohl er sich bekreuzigen würde, nicht in Deutschland arbeiten und dort seine Zukunft planen zu können. Zudem empfindet er eine Flucht ins Ausland, gerade in solchen Zeiten, als Feigheit. Dennoch hebt er sein Glas und trinkt F. auf eine glückliche Zukunft zu.
„Und wie steht es mit ihrer Doktorarbeit, B.?“
„Nächste Woche habe ich einen Termin bei Professor K., meinem Chef, und werde ihm die vollendete Arbeit in die Hände drücken und auf Jahresende wieder zurück zuhause sein! In den Armen meiner geliebten Uschi, die in Breslau auf mich wartet. Wir werden heiraten, Kinderchen kriegen, gemächliches Leben führen. Ja, ja, F., so sind die Pläne und Lebensentwürfe eben verschieden.“
Hans Günther nimmt wahr, dass F. stutzt. Bestimmt ist er, der konservativ Angepasste, etwas verwirrt, denkt Hans Günther, dass neben Hedy und Anderen nun plötzlich auch von einer Geliebten in Breslau die Rede ist. Zu seiner Erleichterung spricht F. ihn nicht auf seine Vielweiberei an. Was ihn weiter nicht erstaunt. So intim sind er und F. nun doch nicht. F. setzt zu einem Ausruf des Entsetzens an.
„Zurück nachhause, B.? Sind sie nicht ganz bei Sinnen! Die politische Entwicklung dort, unser berufliches Fortkommen dort …“
„Ärzte braucht es, Gott sei Dank, immer! Auch und gerade in unserer Heimat, wo es gilt zu zeigen, dass unser Herz nach wie vor für das Gute Deutschlands, des Landes der Dichter und Denker, unserer Heimat schlägt“, wirft Hans Günther hin und schiebt dann lachend nach, „bis ich heim ins Reich zurückkehre, sind Hitler und die Nationalsozialisten längst Geschichte. Schauen sie mich nicht so entgeistert an. Meine Neugierde und mein Trieb, genau hinzuschauen, weisen mir immer einen Weg aus jedem Schlamassel. Ich hätte sowieso Lust, den Bettel mit der Doktorarbeit hinzuschmeissen und meiner wahren Berufung zu folgen. Mich der Schriftstellerei zu widmen. Doch kann ich das meinem alten Herrn nicht antun. Er will, dass ich einen Doktorhut trage. Ohne Doktortitel tauge ich ihm nichts.“
Pünktlich wie eine perfekt tickende Uhr trifft Hans Günther zwei Minuten vor der vereinbarten Zeit zur Besprechung in Professor K.s Sekretariat ein. K. lässt Hans Günther zehn Minuten warten. Strahlend, mit einem Bückling, überreicht Hans Günther K. das Typoskript seiner Doktorarbeit. K. nimmt das dicke Papierbündel entgegen. Bewegt es hin und her. Betrachtet es. Verzieht seine Miene.
„Fein, ihre Doktorarbeit. Danke. Der Umfang ist gewaltig, beinahe zu gewaltig.“
Hans Günther horcht auf. K.s üblich herablassender Tonfall, hat heute einen spöttisch abwertenden Unterton. Hans Günther ahnt, dass dem ehrwürdigen Herrn von und zu K. etwas nicht passt. Hans Günther hatte sich in letzter Zeit mit etlichen Dissertationen herumgeschlagen. Auch solchen die genau so umfangreich sind wie seine. Oder gar noch umfangreicher.
„Falls Sie, Herr Professor, gestatten, das Thema, das sie mir vorgeschlagen hatten und in das ich mich mit vollem Interesse hineinarbeitete, birgt so Vieles in sich.“
„Bis ich mich da durchgekämpft haben werde! Es wird dauern, B.. Vor Jahresende werden sie keinen Bericht von mir erwarten dürfen. In einem Monat läuft ihre Praktikumsstelle hier an der Klinik aus. Geniessen sie unbeschwert die Freizeit, die ich ihnen beschere. So, nun habe ich wieder zu tun.“
Hans Günther schluckt leer. Das für ihn so wichtige Gespräch mit K. hatte er sich anders vorgestellt. Er ist konsterniert. Und er wundert sich, wie rasch er aus der Höhle des Löwen hinauskomplimentiert wird. Dann wird er halt gleich im November nachhause zurückkehren und später zur Entgegennahme des Doktordiploms noch einmal in Bern antanzen. Hedy wird er vergessen, mit einer Träne im Knopfloch. Zuhause wird er seine Liebe zu Uschi auffrischen. Uschi als Mutter seines Stammhalters Rainer ist auch total okay. Zuhause kann er sich in Ruhe umsehen, welche Tore und Türen sich ihm mit Doktorhut in beruflicher Hinsicht öffnen werden. Wenn alle Stricke reissen, wird er sich eben, sehr zum Entsetzen von Mottl und Vatel, doch zu seiner grössten Genugtuung ganz der Schriftstellerei und dem Geistesleben widmen. Hans Günther teilt seinen Eltern mit, dass er anfangs Dezember nachhause zurückkehren und dann auf Jahresende oder im nächsten Jahr nochmals kurz nach Bern wird abdampfen müssen, um das Doktordiplom in Empfang zu nehmen.
Den Abschied von Hedy aus Bern und das abrupte Ende ihrer ach so feinen Beziehung feiern Hans Günther und Hedy mit Champagner und mit Tanz in der Bar des Bellevue Palace. Hans Günther ärgert sich, dass er für diesen so gediegenen Anlass seinen Abendanzug nicht in seinem Gepäck von zuhause mitgebracht hatte. Er schämt sich in dieser eleganten Atmosphäre für seinen Knickerbocker-Anzug. Hedy sagt, pfeif drauf, komm, komm, tanze schon! Sie feiern ausgelassen. Hans Günther ist selig und geniesst den Augenblick.
Mottl und Vatel beschwören Hans Günther schriftlich, es bloss nicht zu wagen, ohne Doktorhut in seinem Gepäck zuhause aufzukreuzen. Sie bombardieren in tagtäglich mit Postkarten und Briefen. Hans Günther stutzt. Es ist sonst nicht die Art von Mottl und Vatel, ihn so sehr zu bedrängen. Da muss etwas dahinterstecken, das sie nicht sagen wollen – oder können / dürfen. Die Briefzensur! In einem Nachsatz fügen sie hinzu, dass die Devisenstelle Deutschlands Geldüberweisungen an ihn in die Schweiz nach Auslaufen der unbezahlten Praktikantenstelle an der Universitätsklinik nicht mehr bewillige. Hans Günther stockt der Atem. Er ist sich sicher, dass Mottl und Vatel nicht grundlos diese Alarmzeichen aussenden.
Hans Günther sieht sich dem Zwang der Situation ausgeliefert. Er muss wohl oder übel in Bern, in der Schweiz ausharren, bis das Doktorat erledigt ist. Seine Eltern können ihn nicht weiter finanziell unterstützen. Nun muss er selber schauen, wie er die mindestens zwei Monate in der Schweiz finanziell überstehen wird. Er könnte sich seine Haare einzeln ausreissen, dass er mit den monatlichen Überweisungen der Eltern, die höher sind als ein regulärer Assistentenlohn, nicht sorgsamer gewirtschaftet, alles verprasst hat. Unversehens wird er aus seiner komfortablen Situation hinauskatapultiert.
Um eine Lösung seiner momentanen Probleme ist Hans Günther nicht verlegen. Schliesslich weiss er, was er will. Und er ist bereit, darum zu kämpfen. Inzwischen hat er mitbekommen, dass Psychiatrische Kliniken in der Schweiz eher Schwierigkeiten haben, junge Schweizer Ärzte als Assistenzärzte zu finden. Er wird in eine Lücke springen. Dabei erst noch ein ordentliches Einkommen erringen. Einem allfälligen künftigen Arbeitgeber braucht er nicht auf die Nase zu binden, dass er in der Schweiz bloss ausharrt, bis sein Doktor unter Dach und Fach ist. Er macht sich schlau über alle psychiatrischen Kliniken in der Schweiz. Schreibt alle an. Sendet ihnen seine Bewerbungsunterlagen. Es hagelt Absagen um Absagen. Ende November, wo seine Praktikantenstelle ausläuft, naht. Hans Günther wirft lachend in die Runde der Kollegen aus der Waldau, wenn alle Stricke reissen, haue er ab nach Paris, gebe sich als weissrussischer Adliger aus und nehme eine Stelle als Chauffeur an.
Endlich, endlich eine Aufforderung, sich persönlich vorzustellen. Beim Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden. Wenn nicht alle Stricke reissen, klappt es diesmal, echt! Hans Günther setzt sich ins Bild über Königsfelden: herzogliche Klostergründung auf dem Areal einer römischen Garnisonsstadt, wechselhafte Geschichte, bis hin zur Irrenanstalt.
Es klappt! Hans Günther bekommt eine regulär bezahlte Assistentenstelle. Lässt beim Direktor von Königsfelden kein Sterbenswörtchen fallen, dass er gleich nach Erhalt seines Doktordiploms von der Universität Bern wieder nach Breslau abhauen wird. Antritt in Königsfelden am 1. Dezember 1937. Königsfelden liegt zwischen Bern und Zürich. Näher bei Zürich. So löst regulärer Arbeitslohn die versiegende finanzielle Unterstützung durch Mottl und Vatel nahtlos ab. Hans Günther ist für den Moment gerettet. Schmunzelt bei der Vorstellung, dass Mottl schreiben wird, hast wieder einmal mehr Glück als Verstand gehabt. Bist eben ein Sonntagskind. Harrt er halt noch kurz in der Schweiz aus. Wird sich mit Hedy so oft als möglich in Zürich vergnügen. Und sich mit ihr über alles Unangenehme hinwegtrösten. Doch bald, bald geht’s heim ins Reich!
2.
Edwin F. hört das Klopfen an seine Bürotüre. Vergewissert sich mit einem Blick auf seine Armbanduhr, dass halb Zwölf ist. Ruft herein und weiss, dass die Türe sich gleich öffnen und der Briefträger Paul O. ihm die eingehende Mittagspost der Klinik überreichen wird. Edwin F. hofft, dass Paul O. diesmal nicht wie bei der Morgenpost vom erstmals als Pförtner diensthabenden jungen Pfleger beim Pförtnerhaus am Eingangstor des Parks von Königsfelden wegen seiner Berechtigung zum Betreten des Klinikareals aufgehalten worden ist. Als der Briefträger von Windisch in seiner schicken Uniform benötigt Paul O. keine weitere Berechtigung. Das sollte auch der junge Schnösel von Pförtner-Pfleger kapieren.
Paul O. legt Edwin F. einen Stapel Briefe auf den Schreibtisch und meint lachend, der junge Pfleger beim Pförtnerdienst habe dazugelernt. Diesmal habe er ihn, Paul O. mit seinem Fahrrad von der Zürcherstrasse her auf den Vorplatz vor dem Eingangstor einbiegen sehen. Sei sogleich losgerannt, um das Tor zu öffnen, so dass er, Paul O. nicht einmal mit dem Fahrrad habe anhalten, geschweige denn absteigen brauchen. Er als Briefträger habe keine Zeit zum Vertrödeln. Er brauche unbedingt freie Fahrt in das für Normalsterbliche verbotene allerheiligste Königsfelden. Und der junge Pförtner-Pfleger habe rasch dazugelernt. Hut ab!
„Apropos, Edi, kennst du diesen Doktor Hans Günther B.? Er bekommt oft, anscheinend Privatkorrespondenz, Briefe aus dem Ausland. Aus Deutschland, aus Venezuela, aus Kolumbien, aus Australien, aus Rhodesien, aus England, aus Kanada, aus USA. Mit tollen Briefmarken. Kann man ihn nicht fragen, ob er allenfalls bereit ist, diese tollen Briefmarken, oder einzelne der Briefmarken …?“
Edwin F. winkt ab. Er sehe zwar diesen Doktor beinahe täglich, wenn er ihm seine Post ins Büro bringe. Doch einen Doktor etwas so Persönliches zu fragen, nun, komme für ihn als einfachen Bürolisten der Verwaltung von Königsfelden nicht in Frage. Hingegen habe er von jemandem gehört, dass dieser Doktor oft nach Baden zur Briefmarkenbörse des Briefmarkenvereins gehe. Also sei er bestimmt einem Briefmarkentausch nicht abgeneigt. Paul soll es doch mal dort versuchen. Ob er, Paul, denn auch ausländische Briefmarken sammle? Er, Edi, sammle bloss Schweizer Briefmarken, vor allem möchte er alle Serien der Pro Juventute und der Pro Patria Briefmarken komplett haben.
Nachdem Paul O. weg ist, sieht Edwin F. den Stapel von Briefen durch und ordnet sie nach Briefempfängern, denen er dann sogleich die für sie bestimmten Briefe überbringen wird. Die meisten Briefe sind für die Ärzte der Klinik und auch für deren Familien, die auf dem Areal der Klinik wohnen. Wenige für die Verwaltung der Klinik. Wenige für weitere Angestellte der Klinik, die auf dem Areal wohnen. Einzelne Briefe für die Patienten und Patientinnen der Klinik. Edwin F. stutzt. Eine Postkarte, mit ungelenker Schrift beschrieben, ist adressiert ‚An den werthen Bürolisten Edwin F.‘. Edwin F. kennt sogleich die Schrift seiner Mutter. Sie schreibt, dass der Ätti (Vater) mit ihm etwas Wichtiges zu besprechen habe. Er müsse am Sonntag zum Mittagessen nachhause nach Teufenthal zu Besuch kommen. Es gebe Hackbraten, Härdöpfelstock (Kartoffelbrei) und Rüebli (Karotten).
Edwin F. hofft inständig, dass es am Sonntag nicht Katzen hagle. Das Wetter trocken bleibe. Er hat keinen Regenschutz fürs Velofahren. Er hat Glück. Am Sonntag scheint die Sonne. Die Fahrt dauert zwei Stunden. Just aufs Mittagessen schafft er es nach Teufenthal ins väterliche Haus. Der Ätti ist erstaunt, dass plötzlich der Älteste in der Stube steht. Er weiss nicht, was er Dringendes mit ihm zu besprechen haben soll. Die Mutter jedoch erklärt Edwin, sie habe eine Überraschung für ihn. Strahlend erzählt sie, dass auf der Gemeindekanzlei Unterkulm die Stelle eines Bürolisten, eines Gehilfen des Gemeindeschreibers, zu besetzen sei. Als sie sich schüchtern erkundigt habe, ob ihr Edi allenfalls eine Chance hätte, diese Stelle zu bekommen, habe der Gemeindeschreiber ihr höchst erfreut geantwortet, „euer Edi wäre die ideale Besetzung“.
„Da staunst du, wie? Jetzt hast du endlich eine gute Stelle. Auf den 1. November. Was sagst du nun!“