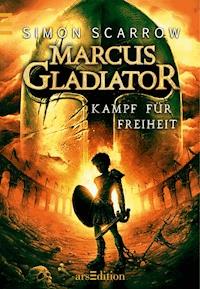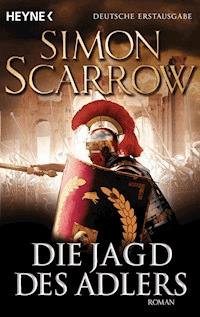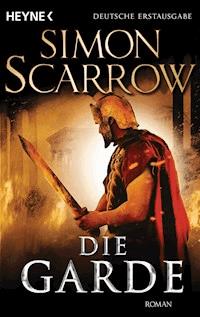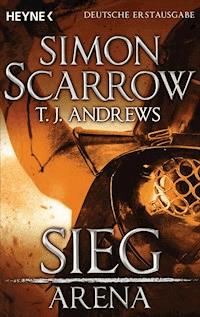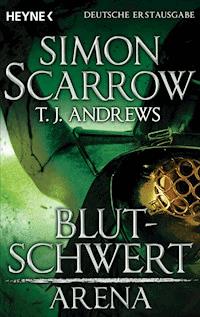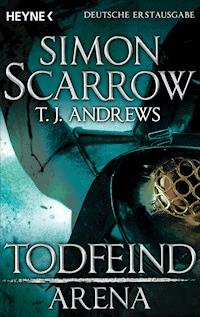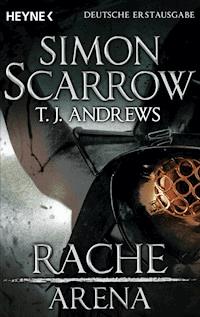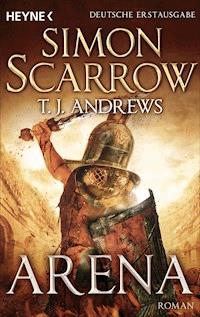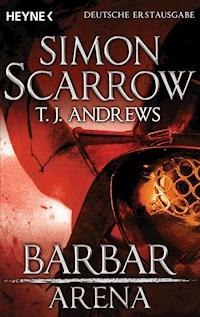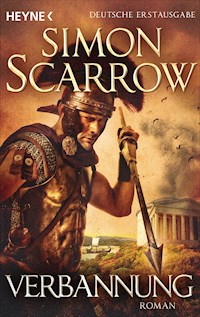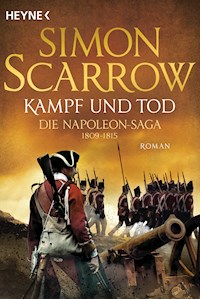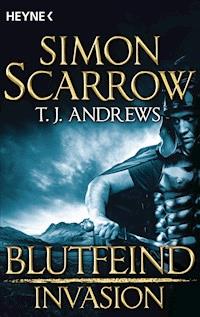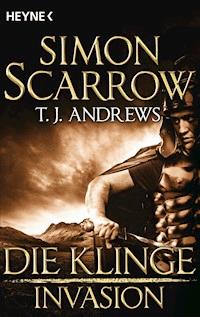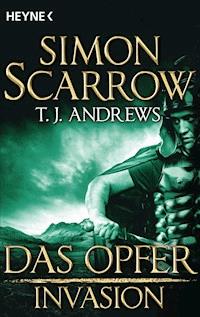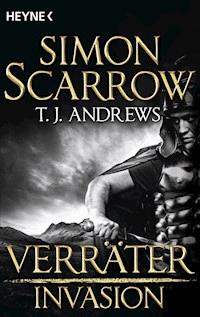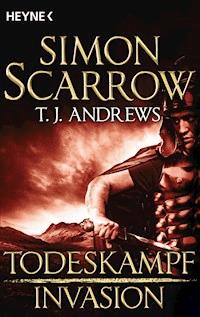9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Napoleon-Saga
- Sprache: Deutsch
Korsika 1769: Unter dramatischen Umständen erblickt ein Junge das Licht der Welt, der schon bald das Schicksal Europas erschüttern wird: Napoleon Bonaparte. Im gleichen Jahr wird im fernen Dublin Arthur Wellesley geboren. Die Wege dieser beiden außergewöhnlichen Männer werden sich immer wieder kreuzen. Mit eisernem Willen arbeitet Napoleon sich empor. Als junger Offizier führt er einen blutigen Vorstoß gegen die britischen Armeen, die die Revolution niederschlagen wollen. Im Kampf der beiden Imperien treten Napoleon und Wellesley zum ersten Mal gegeneinander an …
Band 1 der großen Napoleon-Saga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 925
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
DAS BUCH
Korsika 1769: Unter dramatischen Umständen erblickt ein Junge das Licht der Welt, der schon bald das Schicksal Europas erschüttern wird: Napoleon Bonaparte. Im gleichen Jahr wird im fernen Dublin Arthur Wellesley geboren. Die Wege dieser beiden außergewöhnlichen Männer werden sich immer wieder kreuzen. Mit eisernem Willen arbeitet Napoleon sich empor. Als junger Offizier führt er einen blutigen Vorstoß gegen die britischen Armeen, die die Revolution niederschlagen wollen. Im Kampf der beiden Imperien treten Napoleon und Wellesley zum ersten Mal gegeneinander an …
Band 1 der großen Napoleon-Saga
DER AUTOR
Simon Scarrow wurde in Nigeria geboren und wuchs in England auf. Nach seinem Studium arbeitete er viele Jahre als Dozent für Geschichte an der Universität von Norfolk, bevor er mit dem Schreiben begann. Mittlerweile zählt er zu den wichtigsten Autoren historischer Romane. Mit seiner großen Rom-Serie und der vierbändigen Napoleon-Saga feiert Scarrow internationale Bestsellererfolge.
Simon Scarrow
SCHLACHT UND BLUT
DIE NAPOLEON SAGA1769–1795
Roman
Aus dem Englischen von Fred Kinzel
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Für Onkel John Cox, dem alle, die ihn kennen, Respekt und Zuneigung entgegenbringen
Namen, Daten und Maßeinheiten
Viele Leserinnen und Leser werden wissen, dass der Duke of Wellington zuvor Arthur Wellesley hieß. Noch früher lautete dessen Familienname Wesley. Dieser wurde in das häufigere Wellesley abgeändert, nachdem Arthurs älterer Bruder den Familientitel geerbt hatte. Arthur begann die neue Version erst nach seiner Ankunft in Indien zu benutzen, ein Ereignis, das im nächsten Buch der Serie behandelt wird.
Um die Leserschaft nicht zu verwirren, wird für beide Seiten der Geschichte das englische Maßsystem benutzt.
Was Daten angeht, habe ich den Revolutionskalender ignoriert, da die meisten Franzosen nur ein Lippenbekenntnis zu ihm ablegten und weiter den herkömmlichen Kalender gebrauchten.
1
Irland 1769
Nach einem letzten Blick in das schwach beleuchtete Zimmer zog sich die Hebamme zurück und schloss die Tür hinter sich. Sie drehte sich zu der Gestalt am anderen Ende des Flurs um. Armer Mann, dachte sie und trocknete sich die kräftigen Hände an ihrer Schürze ab. Es gab keinen leichten Weg, ihm die schlechte Nachricht zu überbringen. Das Kind würde die Nacht nicht überstehen. Daran bestand für sie kein Zweifel, nachdem sie so vielen Kindern auf die Welt geholfen hatte, dass sie sich gar nicht mehr an alle erinnerte. Der Junge war mindestens einen Monat zu früh gekommen und hatte nur einen Funken Leben in sich gehabt, als ihn die Herrin kurz nach Mitternacht schließlich mit einem durchdringenden Schmerzensschrei aus ihrem Schoß gepresst hatte. Das Ergebnis war ein teigiges, schmales Ding gewesen, das auch dann noch zitterte, als die Hebamme es nach dem Durchtrennen der Nabelschnur gesäubert und in eine frische Kinderdecke gehüllt der Mutter präsentiert hatte. Die Herrin hatte das Kind an die Brust gedrückt, erleichtert, dass die endlos langen Wehen vorbei waren.
So hatte die Hebamme sie zurückgelassen. Sollte sie einige sorglose Stunden genießen, bevor die Natur ihren Lauf nahm und das Wunder der Geburt in eine Tragödie verwandelte.
Ihr Rocksaum raschelte über die Bodendielen, als sie zu dem wartenden Mann eilte. Sie machte rasch einen Knicks vor ihm, ehe sie Bericht erstattete.
»Es tut mir leid, Herr.«
»Es tut dir leid?« Er warf einen Blick an der Hebamme vorbei zur Tür am Ende des Gangs. »Was ist geschehen? Ist Anne wohlauf?«
»Es geht ihr gut, Herr, oh ja.«
»Und das Kind? Ist es da?«
Die Hebamme nickte. »Ein Junge, Herr.«
Für einen Moment lächelte Garrett Wesley vor Stolz und Erleichterung, ehe ihm die ersten Worte der Hebamme wieder einfielen. »Was stimmt dann nicht?«
»Der Herrin geht es recht gut. Aber der Knabe ist in schlechter Verfassung. Ich bitte um Verzeihung, Herr, aber ich glaube nicht, dass er bis morgen früh durchhält. Und selbst wenn, wird es nur eine Frage von Tagen sein, bis er vor seinen Schöpfer tritt. Es tut mir so leid, Herr!«
Garrett schüttelte den Kopf. »Wie kannst du dir so sicher sein?«
Die Hebamme holte tief Luft und schluckte ihren Ärger über die Zweifel an ihrem Urteilsvermögen hinunter. »Ich kenne die Zeichen, Herr. Er atmet nicht richtig, und seine Haut fühlt sich kalt und klamm an. Das arme Wurm hat nicht die Kraft zum Leben.«
»Man muss doch etwas für ihn tun können. Lass einen Arzt kommen.«
Die Hebamme schüttelte den Kopf. »Es gibt keinen im Dorf. Und auch nicht in der Umgebung.«
Garrett sah sie an und überlegte fieberhaft. In Dublin würden sie die ärztliche Hilfe finden, die sein Sohn brauchte. Wenn sie sofort aufbrachen, konnten sie ihr Haus in der Merrion Street vor Einbruch der Dämmerung erreichen und sofort nach dem besten Arzt schicken. Garrett nickte für sich. Die Entscheidung war gefallen. Er packte die Hebamme am Arm.
»Geh in den Stall hinunter und sag meinem Kutscher, er soll die Pferde einspannen und sich so schnell wie möglich zur Abreise bereit machen.«
»Ihr reist ab?« Sie sah ihn aus großen Augen an. »Doch wohl kaum, Sir. Die Herrin ist noch sehr schwach und braucht Schlaf.«
»Sie kann auf dem Weg nach Dublin in der Kutsche schlafen.«
»Dublin? Aber, Herr, das ist …« Die Hebamme versuchte, sich mit gefurchter Stirn eine Entfernung vorzustellen, die größer als alles war, was sie in ihrem Leben je zurückgelegt hatte. »Das ist eine zu lange Reise für Eure Herrin. In ihrem Zustand. Sie braucht Ruhe, jawohl.«
»Sie wird es durchstehen. Es ist der Junge, um den ich mir Sorgen mache. Du kannst nichts mehr für ihn tun. Geh jetzt und sag meinem Kutscher, er soll einspannen.«
Die Hebamme schwieg und zuckte nur mit den Achseln. Wenn der junge Herr das Leben seiner Frau eines schwächlichen Kindes wegen aufs Spiel setzen wollte, eines Kindes, das ohnehin sterben würde, war das seine Entscheidung. Und er würde mit den Folgen leben müssen.
Sie machte abermals einen Knicks, huschte zur Treppe und stieg unter lautem Stiefeltrampeln nach unten. Garrett warf ihr einen letzten verächtlichen Blick nach, ehe er kehrtmachte und zu dem Zimmer eilte, in dem seine Frau lag. Vor der Tür hielt er einen Moment inne, besorgt um ihre Gesundheit auf der bevorstehenden schweren Reise. Er war sich auch jetzt noch nicht sicher, ob er richtig handelte. Vielleicht hatte die Hebamme doch recht, und der Junge würde sterben, bevor sie einen Arzt erreichten, der kunstfertig genug war, ihn zu retten. Dann hätte Anne die Strapaze einer holprigen Kutschfahrt über die ausgefurchte Straße nach Dublin umsonst durchlitten. Schlimmer noch, es könnte ihrer eigenen Gesundheit gefährlich zusetzen. Ein sicherer Todesfall, wenn sie hierblieben. Zwei mögliche Todesfälle, wenn sie nach Dublin aufbrachen. Eine Gewissheit gegen eine Möglichkeit. So betrachtet, entschied Garrett, dass sie das Risiko eingehen mussten. Er drückte die eiserne Klinke nach unten und stieß die Tür auf.
Das beste Zimmer des Gasthofs war eine beengte Angelegenheit mit kalten, verputzten Wänden. Es gab eine Kommode, eine Waschgelegenheit und ein großes Bett, über dem ein schlichtes Kreuz hing. Auf einer Seite des Betts stand ein Tisch mit einem Kerzenhalter aus Zinn darauf. Drei halb herabgebrannte Kerzen flackerten leicht im Luftzug von der Bewegung der Tür. Anne regte sich unter den Decken und öffnete die Augen.
»Mein Liebster«, murmelte sie. »Wir haben einen Sohn, seht.«
Sie richtete sich etwas auf dem Kissen auf und wies mit einem Kopfnicken auf das Bündel in der Beuge ihres anderen Arms.
»Ich weiß.« Garrett zwang sich, das Lächeln zu erwidern. »Die Hebamme hat es mir gesagt.«
Er trat ans Bett, ging neben seiner Frau in die Knie und nahm ihre freie Hand in seine beiden Hände.
»Wo ist sie?«
»Sie sagt dem Kutscher Bescheid, dass er einspannen soll.«
»Einspannen?« Annes Blick ging rasch zu den Fensterläden, aber kein Lichtschein war an ihren Rändern zu sehen. »Es ist noch dunkel. Außerdem, Liebster, bin ich müde. Sehr, sehr müde. Ich muss ruhen. Wir können es uns doch sicher erlauben, einen Tag hierzubleiben.«
»Nein. Das Kind braucht einen Arzt.«
»Einen Arzt?« Anne sah verwirrt aus. Sie entzog ihre Hand dem Griff ihres Mannes und schlug vorsichtig eine Falte des weichen Leinenstoffs zurück, in den der Säugling gewickelt war. Im warmen Schein der Kerzen sah Garrett die verquollenen Züge des Neugeborenen; die Augen waren geschlossen, die Lippen ruhig. Nur an den sich rhythmisch blähenden, winzigen Nasenlöchern ließ sich erkennen, dass es lebte. Anne strich mit einem Finger über die runzlige Stirn. »Wieso einen Arzt?«
»Er ist schwach und muss so schnell wie möglich angemessen versorgt werden. Nur in Dublin können wir sicher sein, dass er bekommt, was er braucht.«
Anne legte die Stirn in Falten. »Aber das ist eine Tagesreise von hier. Wenigstens.«
»Genau aus diesem Grund habe ich befohlen, die Kutsche vorbereiten zu lassen. Wir müssen unverzüglich aufbrechen.«
»Aber Garrett …«
»Still!« Er drückte ihr den Zeigefinger sanft auf die Lippen. »Ihr dürft Euch nicht verausgaben. Ruht, meine Liebe. Schont Eure Kräfte.«
Er stand auf. Hinter den Läden war Betriebsamkeit im Kutschhof zu vernehmen; einer der Knechte fluchte, als das Tor in seinen rostigen Angeln quietschte. Garrett wies mit einem Kopfnicken zum Fenster. »Ich muss gehen. Da unten wird eine starke Hand nötig sein, damit wir schnell genug von hier wegkommen.«
In dem mit Kopfstein gepflasterten Hof brannten zwei Laternen in Halterungen an der Wand des Wagenschuppens. Das Tor stand offen, und im Gebäude schirrten verschwommene Gestalten die Pferde an.
»Beeilt euch!«, rief Garrett, als er den Hof überquerte. »Wir müssen sofort aufbrechen.«
»Aber es ist noch Nacht, Herr.« Ein Mann tauchte aus der Unterkunft der Dienerschaft auf, er schlüpfte gerade in seinen Mantel. Garrett verwarf den Protest seines Kutschers mit einer knappen Handbewegung.
»Wir brechen auf, sobald meine Frau angekleidet und reisefertig ist, O’Shea. Sorgt dafür, dass unser Gepäck aufgeladen wird. Und jetzt schafft die Pferde raus und spannt sie vor die Kutsche.«
»Jawohl, Herr. Wie Ihr wünscht.« Der Kutscher senkte den Kopf und marschierte in den Stall. »Vorwärts, Burschen! Bewegt euch, ihr Faulenzer!«
Garretts Blick ging rasch zum Fenster seiner Frau hinauf, und es gab ihm einen Stich, weil er nicht an ihrer Seite war. Dann schaute er stirnrunzelnd zum Stall zurück. »Auf, Männer! An die Arbeit!«
2
Die Kutsche rumpelte in der letzten Stunde der Dunkelheit aus dem Hof. Nachdem sie auf die grob gepflasterte Dorfstraße gebogen war, durchbrach das Rattern der mit Eisen beschlagenen Räder die Stille der Nacht. Die dunkle Masse der dicht gedrängten Häuser links und rechts der Straße wurde für jeweils kurze Zeit von den beiden Laternen an der Kutsche beleuchtet. Im Wageninnern gab eine einzelne Lampe Licht, die an der Trennwand hinter dem Kutschbock befestigt war. Garrett hatte den Arm um seine Frau gelegt und blickte auf die reglose Gestalt seines Sohns in ihrem Schoß hinab. Es stimmte, was die Hebamme gesagt hatte. Das Kind sah kraftlos und schlaff aus. Anne warf einen Blick zu ihrem Mann und deutete seine besorgte Miene richtig.
»Die Hebamme hat mir vor unserer Abreise alles erzählt. Ich weiß, dass seine Aussichten, zu überleben, gering sind. Wir müssen auf den Herrn vertrauen.«
»Ja«, sagte Garrett und nickte.
Die Kutsche fuhr aus dem Dorf, und das Rattern des Kopfsteinpflasters ging in das leisere Rumpeln der unbefestigten Landstraße über, die sich in Richtung Dublin schlängelte. Garrett zog den Vorhang der kleinen Kutschentür zurück und schob das Fenster auf.
»O’Shea!«
»Herr?«
»Warum fahren wir nicht schneller?«
»Es ist dunkel, Herr. Ich kann den Weg vor uns kaum erkennen. Wenn wir schneller fahren, könnten wir von der Straße abkommen, oder die Kutsche könnte umkippen. Bald bricht der Morgen an. Sobald es hell ist, machen wir sicher Zeit gut.«
»Nun denn.« Garrett runzelte die Stirn und schob das Fenster zu, ehe er in den gepolsterten Sitz zurücksank. Seine Frau ergriff seine Hand und drückte sie sanft.
»O’Shea ist ein guter Mann, Liebster. Er weiß, dass er sich beeilen muss.«
»Ja.« Garrett sah sie an. »Und Ihr? Wie geht es Euch?«
»Recht gut. Ich war nur noch niemals so müde.«
Garrett presste die Lippen aufeinander. »Ich hätte Euch im Gasthof ruhen lassen sollen.«
»Was? Und unseren Sohn allein nach Dublin bringen?«
Er zuckte mit den Achseln, und Anne lachte leise. »Mein Guter, Ihr mögt ein vorzüglicher Ehemann sein, aber es gibt Dinge, die nur eine Mutter tun kann. Ich muss bei dem Jungen bleiben.«
»Hat er die Brust genommen?«
Anne nickte. »Ein wenig. Kurz bevor wir den Gasthof verlassen haben. Aber nicht genug. Ich glaube, er hat nicht die Kraft dazu.« Sie legte den kleinen Finger an die Lippen des Säuglings und kitzelte sie sanft, um eine Reaktion hervorzurufen, aber das Kind kräuselte die Nase und wandte das Gesicht ab. »Mir scheint, er hat nur wenig Überlebenswillen.«
»Armer Kerl«, sagte Garrett. »Armer Henry.« Er spürte, wie seine Frau erstarrte, als er den Namen aussprach. »Was ist?«
»Nennt ihn nicht so.« Sie drehte den Kopf zum Fenster.
»Aber das ist der Name, auf den wir uns geeinigt haben.«
»Ja. Aber er wird vielleicht … nicht überleben. Ich habe den Namen für einen Sohn reserviert, der stark sein würde. Wenn er stirbt, könnte ich den Namen nicht für ein weiteres Kind nehmen. Ich könnte es nicht.«
»Ich verstehe.« Garrett drückte sanft ihre Schulter. »Aber kein christliches Kind sollte namenlos sterben.«
»Nein …« Anne sah auf das winzige Gesicht hinab. Sie fühlte sich hilflos in dem Wissen, dass vielleicht nur wenige Stunden verbleiben würden, bis der Junge in die nächste Welt hinüberwechselte, nachdem er in dieser kaum einen Atemzug getan hatte. Die Trauer würde in einem enormen Missverhältnis zur Dauer seines Säuglingslebens stehen. Dem kränklichen Ding einen Namen zuzuteilen, würde alles nur schlimmer machen, und sie scheute vor der Aufgabe zurück.
»Anne …« Garrett sah sie immer noch an. »Er braucht einen Namen.«
»Später. Dafür wird später Zeit sein.«
»Und wenn nicht?«
»Wir müssen auf Gott vertrauen, dass Zeit sein wird.«
Garrett schüttelte den Kopf. Das war typisch für sie. Anne hasste es, wenn das Leben ihr Schwierigkeiten in den Weg legte. Er holte tief Luft. »Ich will, dass er einen Namen trägt. Nicht Henry, von mir aus«, räumte er ein. »Aber wir müssen uns jetzt auf einen einigen, solange er noch lebt.«
Anne zuckte zusammen und schaute aus dem Fenster, aber alles, was sie sah, war ihr eigenes, ruckelndes Bild, und hinter ihr spiegelten sich ihr Mann und ihr Kind.
»Anne …«
»Also gut«, sagte sie gereizt. »Da Ihr darauf besteht. Wir werden ihm einen Namen geben. Wofür immer das gut sein soll. Wie wollen wir ihn nennen?«
Garrett sah auf den Jungen hinab, er staunte über seine tiefen Gefühle für den Säugling und fürchtete zugleich das Verdikt der Hebamme. Wenn man bedachte, dass Anne ihn so viele Monate in ihrem Leib getragen, seine ersten Bewegungen gespürt hatte, dass sie gewusst hatte, sie trug ein Leben in sich … Als sie Garrett von der schrecklichen Ruhe in ihrem Bauch erzählt hatte, waren sie in kopfloser Angst nach Dublin geeilt, nur um zu erleben, dass unterwegs die Geburt einsetzte. Als das Kind dann lebend zur Welt kam, war Garretts Herz voller Freude gewesen, eine Freude, welche die Hebamme mit ihrer Erklärung, das Kind sei zu schwach, um zu überleben, wieder zunichtemachte. Er kämpfte gegen den Schmerz an, der in ihm aufwallte.
»Garrett?« Anne hob den Kopf und sah ihm in die Augen. »Ach, Garrett, es tut mir so leid. Ich bin keine große Hilfe, nicht wahr?«
»Ich … es geht schon. Einen Moment nur.«
Er richtete sich auf, drückte sie an sich und spürte ihre Anspannung trotz der Stöße der Kutsche auf der holprigen Landstraße. Draußen färbte das erste Morgenlicht die Hügel im Osten grau, und der Kutscher ließ die Peitsche über dem Kopf der Pferde knallen, um sie zur Eile anzutreiben.
Anne zwang sich zur Konzentration. Ein Name musste her – rasch. »Arthur.«
Garrett lächelte sie an und sah erneut auf ihren Sohn hinab.
»Arthur«, wiederholte er. »Nach dem König. Der kleine Arthur.« Er strich über die seidige Stirn des Säuglings. »Ein schöner Name. Eines Tages wirst du so ritterlich und mutig wie dein Namenspatron sein.«
»Ja«, sagte Anne. »Genau, was ich sagen wollte.«
Mit grauem Nieselregen brach der Morgen über der irischen Landschaft an, und die tief ausgefahrene Spur wurde bald schlammig und ließ die Wagenräder einsinken. Mittags legten sie kurz in einer kleinen Stadt Halt ein, um den Pferden eine Pause zu gönnen und eine Erfrischung zu sich zu nehmen. Anne blieb mit dem Kind in der Kutsche und versuchte erneut, ihm die Brust zu geben. Wie zuvor schmatzte Arthur mit den Lippen, als er die dargebotene Brustwarze erfühlte, aber nach nur kurzem, krampfartigem Saugen wandte er das Gesicht ab, würgte und sabberte und wollte nicht weitertrinken.
Als das Licht verblasste und die Kutsche wieder von Dunkelheit eingehüllt wurde, bog die Landstraße um einen Hügel, und in der Ferne sah Garrett Hunderte von Lampen in den Fenstern der Hauptstadt funkeln. Einmal mehr musste O’Shea die Geschwindigkeit drosseln, da er Mühe hatte, den Weg zu erkennen. Und so kam es, dass die Kutsche erst zwei Stunden nach Anbruch der Nacht in die Stadt einfuhr und über die gepflasterten Straßen zum Haus in der Merrion Street ratterte.
Garrett half seiner Frau und dem Kind vorsichtig aus der Kutsche und brachte sie ins Haus. Dann gab er Befehl, dass unverzüglich ein Feuer im Salon angezündet und warmes Essen für ihn und Anne zubereitet werden sollte. Schließlich schickte er Diener um eine Amme und zu Dr. Kilkenny, dem angesehensten Arzt in der Stadt.
Dieser wurde in den Salon geführt, als Anne und Garrett gerade ihre Fleischbrühe zu Ende löffelten. Garrett sprang auf und ergriff die behandschuhten Hände des Doktors.
»Danke, dass Ihr so schnell gekommen seid.«
»Ja, nun, man sagte mir, es sei dringend.« Der Atem des Arztes roch nach Wein. »Und wo ist nun mein Patient, Wesley? Die junge Dame hier?«
»Nein.« Anne wies zu der Wiege, die nahe beim Kamin stand. »Unser Sohn Arthur. Er ist letzte Nacht zur Welt gekommen. Kaum hatte die Hebamme ihn gesehen, erklärte sie, er sei in schlechter Verfassung, und wir müssten uns auf das Schlimmste gefasst machen.«
»Pah!« Der Doktor schüttelte den Kopf. »Was weiß eine Frau von Medizin, eine irische Frau noch dazu? Man sollte ihnen gar nicht erlauben, in medizinischen Fragen eine Meinung kundzutun. Ihre Aufgabe ist es einzig, die Kinder zur Welt zu bringen. Nun, was ist los mit dem Jungen?«
»Er nimmt die Brust nicht an.«
»Wie? Gar nicht?«
»Nur ein paar Schlucke. Dann würgt er und trinkt nicht mehr.«
»Hm.« Dr. Kilkenny stellte seine Tasche neben der Wiege ab, schälte sich aus seinem Mantel und gab ihn Garrett, bevor er sich über das Neugeborene beugte und vorsichtig die Decken zurückschlug, in die es gewickelt war. Er rümpfte die Nase, als ihm ein nur zu vertrauter Geruch entgegenstieg. »Zumindest ist mit seiner Verdauung alles in Ordnung.«
»Ich lasse seine Windel wechseln.«
»Sogleich, erst dann, wenn ich ihn untersucht habe.«
Anne und Garrett beobachteten ängstlich und schweigend, wie der Arzt im schwankenden Schein des Kerzenhalters den winzigen Körper ihres Kindes untersuchte. Ein leiser Schrei drang aus der Wiege, als der Doktor leicht auf den Bauch des Knaben drückte, und Anne sprang besorgt auf. Dr. Kilkenny warf einen Blick über die Schulter. »Bewahrt nur die Ruhe, gute Frau. Das ist vollkommen normal.«
Garrett griff nach Annes Händen und hielt sie fest, bis der Arzt seine Untersuchung beendet hatte und sich aufrichtete.
Garrett sah ihn an. »Nun?«
»Kann sein, dass er überlebt.«
»Kann sein …«, flüsterte Anne. »Ich dachte, Ihr könntet uns helfen.«
»Gute Frau, die Möglichkeiten eines Arztes, seinen Patienten zu helfen, sind begrenzt. Euer Junge ist schwach. Ich habe viele Kinder wie ihn gesehen. Manche gehen sehr schnell verloren. Andere halten Tage oder sogar Wochen durch, ehe sie doch erliegen. Manche überleben.«
»Aber was kann man für ihn tun?«
»Haltet ihn warm. Versucht, ihm so oft wie möglich die Brust zu geben. Ihr müsst ihn außerdem mit einer Salbe einreiben, die ich Euch dalassen werde. Einmal morgens und einmal abends. Es ist ein Stimulans und kann sehr wohl den Unterschied zwischen Tod und Leben ausmachen. Das Kind wird vielleicht weinen, wenn Ihr die Salbe auftragt, aber Ihr dürft seine Tränen nicht beachten und müsst die Behandlung fortsetzen. Verstanden?«
»Ja.«
»Und jetzt meinen Mantel, bitte. Ich lasse die Rechnung morgen Vormittag schicken. Ich wünsche eine gute Nacht.«
Sobald der Arzt gegangen war, sank Garrett in einen Sessel neben der Wiege und sah hilflos auf das Kleinkind. Arthur schlug für einen Moment die Augen auf, aber sein restlicher Körper wirkte so schlaff und leblos wie zuvor. Garrett betrachtete ihn noch eine Weile, dann rieb er sich die müden Augen.
»Ihr solltet zu Bett gehen«, sagte Anne leise. »Ihr seid erschöpft und braucht Schlaf. Ihr müsst stark sein in den kommenden Tagen. Ich werde Eure Unterstützung brauchen. Und er auch.«
»Er heißt Arthur.«
»Ja, ich weiß. Nun geht zu Bett. Ich bleibe hier bei ihm.«
»Wie Ihr meint.«
Als Garrett den Raum verließ, blickte seine Frau auf das Kind hinunter und fuhr sich müde mit der Hand über die Stirn.
Am nächsten Tag versuchte Anne weiter, dem Kind die Brust zu geben, aber es trank nur wenig von ihrer Milch und verkümmerte vor den Augen seiner Eltern immer mehr. Erst ließ die Anwendung der Salbe den Säugling aufheulen, aber Anne entdeckte bald, dass er umgehend den Trost ihrer Brust suchte, wenn sie ihn mit dem leicht nach Alkohol riechenden Mittel einstrich.
Anne und Garrett hielten seine Geburt sorgsam geheim, da sie keine endlosen Besuche von besorgten Freunden und Verwandten bekommen wollten. Sie schickten nicht einmal eine Nachricht zu ihrem Landsitz in Dangan, um ihre anderen Kinder von dem jüngsten Bruder in Kenntnis zu setzen.
Dann, am vierten Tag nach der Geburt, stürzte Anne aufgeregt ins Arbeitszimmer ihres Mannes, um ihm mitzuteilen, dass Arthur endlich richtig trank. Und da er sich weiter stillen ließ, nahm er langsam zu, bekam Farbe und begann zu strampeln und sich zu winden, wie es sich für Säuglinge gehörte. Bis endlich klar war, dass er überleben würde. Erst dann, am 1. Mai, drei Wochen nach seiner Geburt, gaben seine Eltern die Ankunft von Arthur Wesley, dem dritten Sohn des Earl of Mornington, in den Zeitungen Dublins bekannt.
3
Korsika, 1769
Erzdiakon Luciano hatte gerade mit dem Segen begonnen, als Letizias Fruchtblase platzte. Sie war im prallen Schein der Sonne gestanden, die durch die hohen Bogenfenster hinter dem Altar des Doms von Ajaccio einfiel. Es war ein sengend heißer Augusttag, ihr war warm, und es juckte unter den dunklen Falten ihrer besten Gewänder, die sie nur zur Messe trug. Letizia spürte ein Rinnsal von Schweiß unter ihren Armen, kühl genug, um sie schaudern zu lassen. Und wie als Reaktion darauf strampelte das Kind kräftig in ihrem mächtig angeschwollenen Leib.
Letizia lächelte. Was für ein Unterschied zu ihrem ersten Kind. Giuseppe war so still in ihrem Schoß gelegen, dass sie schon eine weitere Totgeburt befürchtet hatte. Doch inzwischen war er ein prächtiger, gesunder Junge. Fügsam wie ein Lamm. Nicht wie dieses andere Kind, das nun in ihr war und es scheinbar nicht erwarten konnte, in die Welt zu platzen. Vielleicht lag es an den Umständen seiner Empfängnis und dem Leben, das sie und Carlo während ihrer Schwangerschaft führen mussten. Mehr als ein Jahr lang hatten sie gegen die Franzosen gekämpft. Lange Monate, in denen sie über die zerklüfteten Berge und durch die versteckten Täler Korsikas gezogen waren und Hinterhalte für die französischen Patrouillen gelegt oder einen ihrer Außenposten angegriffen und deren Besatzung getötet hatten, um danach ins Inselinnere zu fliehen, bevor die unvermeidliche Infanteriekolonne eintraf, um Jagd auf sie zu machen. Monate, die sie in Höhlen verborgen in der Gesellschaft des ungehobelten Haufens von Kleinbauern verbrachten, die Carlo befehligte. Patrioten, gejagt wie Tiere.
In einer solchen Höhle war das Kind empfangen worden. An einem bitterkalten Winterabend kurz vor Weihnachten, als sie und Carlo auf einem Bett aus Kiefernzweigen lagen, in dünne, schmutzige Decken gehüllt. Ringsum hatten ihre Gefolgsleute weitergeschlafen oder zumindest so getan, als sich ihr Anführer und seine junge Frau leise unter den Laken bewegten. Sie hatten keine Scham dabei empfunden. Nicht im Angesicht der Tatsache, dass der folgende Tag einem von ihnen oder beiden den Tod bringen konnte und Giuseppe als Waise im Haus seiner Großeltern zurückbleiben würde.
Sie hatten den ganzen Winter hindurch gegen die Eindringlinge gekämpft, bis in das erste Frühjahrserwachen hinein, und die ganze Zeit hatte Letizia das Leben in sich wachsen gefühlt. Nach den Anfangserfolgen des Aufstands waren sich Carlo und die anderen Patrioten ihres Sieges so sicher gewesen, dass General Paoli seinen Kleinkrieg der endlosen Scharmützel aufgab und seine Truppen in die Schlacht bei Ponte Nuovo führte. Dort waren sie von den geordneten Reihen und geballten Salven der Berufssoldaten vernichtend geschlagen worden. Hunderte von Männern, niedergemäht, weil ihre Leidenschaft für die korsische Unabhängigkeit sie nicht vor den Flintenkugeln aus Blei schützte, die durch ihre Reihen schwirrten. Eine Vergeudung vorzüglicher Männer, fand Letizia. Paoli hatte ihr Leben für nichts verschleudert. Nach Ponte Nuovo wurden die überlebenden Patrioten in die Berge getrieben, wo sie blieben, bis Paoli von der Insel floh und die triumphierenden Franzosen den von ihrem General verlassenen Männern eine Amnestie anboten.
Letizia war zu diesem Zeitpunkt im siebten Monat gewesen, und Carlo, der um ihre Gesundheit fürchtete und absolut nicht bereit war, noch länger wie ein Wilder zu leben, hatte die Offerte des Feindes angenommen. Keine Woche später waren sie in ihr Haus in Ajaccio zurückgekehrt. Der Kampf war vorbei. Korsika, das so lange im Besitz Genuas gewesen war, hatte kurz von der Unabhängigkeit gekostet und gehörte nun zu Frankreich. Und so würde das Kind in ihr als Franzose zur Welt kommen.
Ohne Vorwarnung spürte Letizia einen Schwall Flüssigkeit zwischen ihren Schenkeln und stieß vor Überraschung einen leisen Schrei aus, ehe sie verwirrt und voller Angst die Hand vor den Mund schlug.
Carlo wandte sofort den Kopf zu ihr. »Letizia?«
Sie sah ihn aus großen Augen an. »Ich muss gehen.«
Ringsum sahen Leute mit missbilligendem Gesichtsausdruck in ihre Richtung. Carlo bemühte sich, nicht auf sie zu achten. »Gehen?«
»Das Kind«, flüsterte sie. »Es kommt. Jetzt.«
Carlo nickte, legte einen Arm um die schmalen Schultern seiner Frau und führte sie nach einer raschen Verbeugung vor dem riesigen goldenen Kreuz auf dem Altar über den Mittelgang zum Portal des Doms. Letizia biss die Zähne zusammen und watschelte leicht auf dem Weg zur Tür. Draußen im gleißenden Sonnenschein rief Carlo zu den Trägern einer Sänfte, die in der Nähe warteten. Erst rührten sie sich nicht, doch dann setzten sie sich in Bewegung, als sie sahen, dass die Frau Schmerzen litt. Carlo half ihr in die Sänfte und beschrieb mit knappen Worten den Weg zu ihrem Haus. Die Träger hoben die Sänfte vom Boden und liefen los. Carlo trabte neben ihnen her und warf ängstliche Blicke zu seiner Frau, die auf die Zähne biss und sich an den Fensterrahmen klammerte. Die Träger ächzten unter ihrer Last und fingen bald zu keuchen an, während ihre Schritte durch die engen Straßen Ajaccios mit ihren von der Sonne ausgebleichten Häusern hallten.
Ein schriller Schrei ließ Carlo entsetzt in das schmerzverzerrte Gesicht seiner Frau blicken.
»Letizia«, keuchte er und zwang sich, zu lächeln. »Es ist nicht mehr weit, meine Liebe.«
Letizia senkte den Kopf und stöhnte. »Es kommt!«
»Schneller!« rief Carlo den Trägern zu. »Schneller, um Himmels willen!«
Die Sänfte schwankte um eine Ecke, und dort vor ihnen stand das Haus, ein großes, schlichtes Gebäude mit drei Stockwerken.
»Da!«, rief Carlo und zeigte darauf. »Das ist es!«
Die Träger setzten die Sänfte hart ab, was deren Passagierin zu einem weiteren Aufschrei veranlasste, und Carlo verfluchte sie, während er bereits die klapprige Tür aufriss und seine Frau heraushob. Er warf den Trägern ein paar Münzen zu, tastete in der Uhrtasche seines Wamses nach dem Schlüssel und steckte ihn in das eiserne Schloss. Dann stieß er die Tür auf.
Die Luft im Haus war kühl und muffig. Letizia keuchte in kurzen Stößen und sah sich verzweifelt in dem dunklen Hausinnern um.
»Dort.« Sie wies mit einem Kopfnicken auf einen niedrigen, abgenutzten Diwan in der Ecke. »Hilf mir, mich hinzulegen.«
Sobald Letizia an die Armlehne des Diwans gestützt lag, griff sie nach dem Saum ihrer Röcke. Dann hielt sie inne und sah ihren Mann an. In seinem Gesicht standen Angst und heftige Unruhe, und sie wusste, er würde dem, was nun kam, nicht gewachsen sein. Er war nur bei einer ihrer Niederkünfte Zeuge gewesen, einem totgeborenen Kind, und hatte in hilflosen Qualen auf das blasse, leblose Bündel blutigen Fleisches gestarrt. Sie würde diese Sache ohne ihn erledigen. Sie würde es ohne jede Hilfe tun. Das Haus war leer. Alle waren in der Messe.
»Geh!« Letizia nickte in Richtung Tür. »Hol Dr. Franzetti.«
Nach nur kurzem Zögern wandte sich Carlo zur Tür. Er zog sie hinter sich zu, und Letizia hörte seine Stiefel durch die Straße hallen, als er Hilfe holen ging. Dann verflog jeder Gedanke an Carlo, als die Muskeln in ihrem Bauch hart wie Eisen wurden und ein sengender Schmerz ihren Körper erfasste. Sie zischte durch die zusammengebissenen Zähne, dann öffnete sie den Mund zu einem lautlosen Schrei, während der Schmerz eine Ewigkeit anzuhalten schien, ehe er schließlich nachließ und seinen Griff langsam lockerte. Sie schnappte keuchend nach Luft und fühlte ein schreckliches Ziehen in ihrer Leiste. Ihre Hände rafften die Rocksäume zusammen und schoben sie nach oben über die straff gespannte, glatte Haut ihres Bauchs.
Eine weitere Kontraktion erfasste Letizia. Sie schrie laut auf, und auf dem Höhepunkt spannte sie ihre Bauchmuskeln und zwang das Kind mit einer übermenschlichen Anstrengung aus ihrem Schoß. Einen Moment lang geschah nichts, nur Schmerz in endlosen Wellen, und Letizia mobilisierte ihre letzte Kraftreserve und presste.
Mit einem Geräusch wie ein nasses Rauschen verschwand das Spannungsgefühl, und sie hatte den Eindruck, hohl zu sein. Euphorie erfasste sie, als sie zwischen ihre Beine griff und die Finger sanft um den klebrigen Körper schloss, der dort lag. Er zuckte bei ihrer Berührung, und unter Tränen der Erleichterung und Freude hob Letizia das Kind mit seiner teigig-grauen Nabelschnur an ihre Brust.
Ein Junge.
Er öffnete den Mund ein wenig, und auf seinen Lippen wuchs eine Speichelblase, größer und größer, bis sie platzte. Winzige Finger zuckten und ballten sich zu kleinen Fäusten, während Letizia eilig die Riemen löste, die den Oberteil ihres Kleides zusammenhielten. Ihre Brüste waren weit über die normale Größe hinaus angeschwollen, und sie wölbte eine Hand um ihr blasses Fleisch und bot dem Jungen die Brustwarze an. Sofort spitzte er die Lippen und schmatzte, ehe sie sich um die Brustwarze schlossen. Letizia lächelte.
»Kluger Junge.«
Als Carlo und Dr. Franzetti wenig später herbeigeeilt kamen, lächelte Letizia ihnen entgegen. »Er ist wohlauf. Schau, Carlo, ein hübscher, gesunder Junge.«
Ihr Mann nickte, während der Arzt zur Liege eilte und seine Tasche daneben abstellte. Er untersuchte das Neugeborene rasch und nickte befriedigt, ehe er seiner Tasche eine Stahlklammer entnahm und sie vorsichtig unmittelbar am Bauch an der Nabelschnur befestigte. Dann zog er eine Schere hervor und durchschnitt die sehnigen Fasern der Schnur. Als alles erledigt war, richtete sich Dr. Franzetti auf und sah auf das Kind, seine Mutter und seinen Vater hinab. Carlo betrachtete seinen neugeborenen Sohn freudestrahlend und voller Stolz und hatte den Arm um die Schultern seiner Frau gelegt. Der Säugling wand sich unruhig in Letizias Armbeuge, obwohl er sich an der Muttermilch sattgetrunken hatte.
»Er ist ein lebhafter Bursche«, sagte Dr. Franzetti lächelnd. Sein Lächeln erstarb, als ihm die zwei vorherigen Kinder Letizias einfielen, die nicht lebend zur Welt gekommen waren. »Er ist kräftig und gesund. Er wird jetzt allein zurechtkommen und sollte Euch keinerlei Probleme bereiten. Ich werde gehen.«
Carlo löste den Arm von seiner Frau und stand auf. »Danke, Doktor!«
»Pah, ich habe nicht viel getan. Das war alles Letizia hier. Sie hat die ganze schwere Arbeit erledigt. Eine tapfere Frau habt Ihr, Carlo.«
Carlo warf einen Blick zu ihr und lächelte. »Ich weiß.«
Dr. Franzetti hob seine Tasche auf und wandte sich zum Gehen. An der Tür hielt er inne, drehte sich noch einmal um und sah zu der Frau und ihrem Kind auf dem Diwan.
»Habt Ihr Euch schon für einen Namen entschieden?«
»Ja.« Letizia blickte auf. »Er soll nach meinem Onkel genannt werden.«
»Ah?«
»Nabulione.«
Dr. Franzetti setzte seine Mütze auf und nickte zum Abschied. »Ich komme in einigen Tagen wieder vorbei, um zu sehen, wie es dem Kind geht. Bis dahin einen guten Tag, Carlo, Letizia.« Sein Blick wanderte zu dem lebhaften Säugling, und er lachte leise. »Und natürlich dir, kleiner Nabulione Buonaparte.«
4
In den Jahren, die folgten, konnte Carlo Buonaparte sein Glück kaum fassen. Nicht nur war die Amnestie durch die Regierung in Paris bestätigt worden, er hatte sich auch noch den Posten eines Gerichtsassessors in Ajaccio mit einem Salär von neunhundert Livre gesichert. In keiner Weise ein Vermögen, aber es erlaubte ihm, seine Familie zu ernähren und zu kleiden und das große Haus im Herzen der Stadt, das er geerbt hatte, zu unterhalten. Da bereits ein weiteres Kind unterwegs war, brauchte Carlo das Geld. Der neue Gouverneur von Korsika, der Comte de Marbeuf, hatte Gefallen an dem charmanten jungen Anwalt gefunden und wirkte nun im Rahmen seines Auftrags, die Beziehungen zwischen Frankreich und seiner neu erworbenen Provinz zu festigen, als Carlos Gönner. Marbeuf hatte Carlo nicht nur die Anstellung am Gericht besorgt, er hatte außerdem versprochen, Carlos Gesuch zur Anerkennung des Adelstitels seines Vaters zu unterstützen. Es gab gegenwärtig viele solcher Anträge, da die korsische Aristokratie versuchte, ihr Erbe in das französische System einfließen zu lassen. Doch nun verzögerte sich die Bearbeitung seines Gesuchs, und jedes Mal, wenn Carlo die Angelegenheit gegenüber Marbeuf zur Sprache brachte, tätschelte ihm der alte Mann freundlich die Hand, lächelte schmallippig und versicherte seinem jungen Protegé, alles würde zur rechten Zeit erledigt werden.
Wieso die Verzögerung, fragte sich Carlo. Nur Tage zuvor war der Antrag des Anwalts Emilio Bagnioli anerkannt worden, obwohl er ihn ein gutes halbes Jahr nach Carlo eingereicht hatte. Mit sorgenvollem Herzen kehrte er eines Nachmittags in sein Haus zurück und ging zu der Treppe, die in den ersten Stock führte. Letizias Onkel Luciano, der Erzdiakon von Ajaccio, wohnte im Erdgeschoss. Er verließ das Haus kaum noch, angeblich, weil er zu unsicher auf den Beinen war. Doch die Familie wusste, dass er in Wahrheit nur Angst hatte, sich von der Geldtruhe zu trennen, die er in seinem Zimmer versteckte. Carlo hatte wenig übrig für den mürrischen Alten und nickte nur zum Gruß, als er an dem Erzdiakon, der am Türpfosten lehnte, vorbeiging. Dann eilte er die knarzende Treppe hinauf, betrat die Räume seiner Familie und schloss schnell die Tür hinter sich. Aus der Küche am Ende des Flurs hörte er die Kinder und das Klappern von Geschirr und Besteck, da Letizia den Esstisch deckte.
Letizia blickte mit einem warmen Lächeln auf, das jedoch verschwand, als sie seine verdrossene Miene sah.
»Was hast du, Carlo?«
»Es gibt noch immer nichts Neues wegen meines Gesuchs«, antwortete Carlo und setzte sich an den Tisch.
»Sicher wird es bald behandelt.« Sie trat hinter ihn und streichelte seinen Nacken. »Hab Geduld.«
Er antwortete ihr nicht, sondern wandte seine Aufmerksamkeit den Kindern zu, die ihn – die Augen waren unverkennbar die ihrer Mutter – gespannt ansahen. Und während Giuseppe weiter seinen Vater anstarrte, angelte sein jüngerer Bruder geschickt eine dicke Scheibe Wurst von Giuseppes Teller und legte sie auf seinen. Als Giuseppe den Diebstahl bemerkte, wollte er nach der Wurst greifen, doch Nabulione war zu schnell für ihn und ließ die Faust auf Giuseppes Finger niedersausen. Der Ältere jaulte auf, sprang hoch und stieß seinen Wasserbecher um, sodass sich dessen Inhalt über den Tisch ergoss. Carlo riss der Geduldsfaden, und er schlug mit der Faust auf den Tisch.
»Geht auf euer Zimmer!«, befahl er. »Alle beide!«
»Aber Vater!«, schrie der Jüngere empört. »Es ist Abendessenszeit. Ich bin hungrig!«
»Schweig, Nabulione! Tu, was man dir sagt!«
Letizia setzte die Schüssel in ihren Händen ab und eilte zu ihren Söhnen. »Widersprecht eurem Vater nicht. Geht. Man wird euch holen, wenn wir uns besprochen haben.«
»Aber ich bin hungrig!«, protestierte Nabulione und verschränkte die Arme. Seine Mutter stieß ein wütendes Zischen aus und schlug ihm hart ins Gesicht. »Du tust, was man dir sagt! Jetzt geht!«
Giuseppe war bereits aufgestanden und schlich nervös an seinem Vater vorbei, dann rannte er über den Flur zu dem Zimmer, das sich die Jungen teilten. Sein Bruder war von dem Schlag überrascht worden und hatte zu weinen begonnen, aber dann schluckte er seine Tränen, stieß geräuschvoll seinen Stuhl zurück und stand auf. Er warf beiden Eltern einen trotzigen Blick zu, ehe er auf seinen kurzen Beinen aus dem Raum marschierte. Bevor die Tür hinter ihm geschlossen wurde, hörte er seinen Vater noch sagen: »Eines Tages wird der Bengel ein paar Lektionen lernen müssen …« Danach drang nur noch unverständliches Murmeln aus der Küche.
Nabulione wurde es schnell langweilig, zu lauschen, und er entfernte sich leise. Doch anstatt zu Giuseppe aufs Zimmer zu gehen, schlich er die Treppe hinunter und aus dem Haus. Die Sonne stand tief im Westen und warf lange Schatten in die Straße, und der Junge schlug ebendiese Richtung ein und begab sich auf den Weg zum Hafen von Ajaccio. Mit einer Großspurigkeit, die schlecht zu seiner kleinen, dürren Gestalt passte, schritt er fröhlich vor sich hin pfeifend die gepflasterte Avenue entlang, die Daumen in seine Kniebundhose eingehakt.
Als er auf die Straße kam, die am Hafen entlangführte, hielt Nabulione auf die Gruppe von Fischern zu, die dort über ihren Netzen kauerten und sie sorgfältig nach Schäden untersuchten, ehe sie ihr Fangwerkzeug für den nächsten Morgen zusammenfalteten, wenn sie wieder zum Fischen hinausfuhren. Die Gerüche des Meeres und der verwesenden Fischinnereien drangen mit voller Wucht in die Nase des kleinen Jungen, aber er hatte sich längst an den Gestank gewöhnt und nickte zum Gruß, als er mitten in die Gruppe der Männer marschierte.
»Was gibt es Neues?«, legte er los.
Ein alter Mann namens Pedro blickte auf und ließ ein so gut wie zahnloses Lächeln sehen. »Nabulione! Wieder mal auf der Flucht vor deiner Mutter?«
Der Junge nickte und grinste bis über beide Ohren, als er sich dem Fischer näherte.
Pedro schüttelte den Kopf. »Was war es heute? Nicht im Haushalt mitgeholfen? Kuchen geklaut? Deinen armen Bruder gepiesackt?«
Nabulione grinste nur und ging neben dem Alten in die Hocke.
»Pedro, erzähl mir eine Geschichte.«
»Eine Geschichte? Habe ich dir nicht schon genug Geschichten erzählt?«
»He, Winzling!« Einer der jüngeren Männer blinzelte Nabulione zu. »Ein paar von seinen Geschichten sind sogar wahr!« Der Mann lachte, und die anderen fielen gutmütig ein.
»Solange sie nichts mit der Größe seines Fangs zu tun haben«, fügte jemand an.
»Ruhe!«, rief Pedro. »Ihr dummen Jungen! Was wisst ihr schon?«
»Genug, um dir nicht zu glauben, Alter. Winzling, lass dich von seinen dreisten Lügengeschichten nicht zum Narren halten.«
Nabulione funkelte den Sprecher böse an. »Ich glaube, was ich glauben will. Macht euch bloß nicht lustig über ihn. Sonst werde ich …«
»Sonst wirst du was?« Der Fischer sah ihn überrascht an. »Was wirst du mit mir machen, Winzling? Mich niederschlagen? Willst du es mal versuchen?«
Er stand auf und ging auf den Jungen zu. Nabulione sah mit zusammengekniffenen Augen auf die massige Gestalt, die vom orangeroten Schein der untergehenden Sonne eingerahmt wurde. Der Mann war furchterregend. Eine breite Brust, dicke, sehnige Arme und Beine … und nackte Füße. Der Junge lächelte, als er sich vor dem Fischer aufbaute und die winzigen Fäuste hob. Die anderen Fischer brüllten vor Lachen, und als der Mann in Richtung seiner Freunde grinste, sprang Nabulione vor und stampfte mit dem Schuhabsatz so kräftig er konnte auf die Zehen des Mannes.
»Au!« Der Mann schrie vor Schmerz auf, zog seinen Fuß zurück und hüpfte auf dem anderen Bein. »Du kleines Miststück!«
Nabulione trat vor und stieß mit beiden Händen gegen den Kopf des vornübergebeugt auf einem Bein stehenden Mannes. Der Fischer verlor das Gleichgewicht und fiel rückwärts in einen Korb voller Fische, und der ganze Kai brach ob seines Missgeschicks in schallendes Gelächter aus.
Pedro legte die Hand auf Nabuliones Schulter. »Gut gemacht, Bursche! Du magst klein sein«, er klopfte dem Jungen an die magere Brust, »aber du hast Herz.«
Der andere Fischer mühte sich unterdessen aus dem Korb und bürstete Fischschuppen von Hose und Hemd. »Der kleine Scheißkerl muss wohl eine Lektion verpasst bekommen«, murmelte er.
»Mach dich lieber aus dem Staub.« Pedro gab Nabulione einen Stups, und der Junge sprang über die Netze und lief auf flinken Beinen zum Eingang der nächstgelegenen Gasse, während der Fischer Anstalten machte, ihm nachzusetzen. Er erreichte die Gasse jedoch, ehe sich der Mann aus den Netzen befreit hatte, und bevor er aus dem Blickfeld verschwand, streckte er ihm trotzig die Zunge heraus. Da er sich nicht darauf verlassen wollte, dass der Fischer die Verfolgung aufgegeben hatte, lief Nabulione weiter, bog in eine Seitengasse und tauchte in einiger Entfernung zu den Fischern wieder am Kai auf. Heute Abend würde er nicht mehr dorthin zurückgehen.
Am Ende des Kais befand sich der Eingang zur Zitadelle, wo der Comte de Marbeuf seinen Amtssitz hatte.
Eine Gruppe französischer Soldaten saß im Schatten eines Baums beim Tor. Als sie Nabulione sahen, winkten sie und riefen dem Jungen, der eine Art Maskottchen für sie geworden war, einen Gruß zu. Nabulione lächelte und ging zu ihnen. Er verstand zwar nur wenig Französisch und sprach nur einen korsischen Dialekt des Italienischen, aber einige der Soldaten konnten Italienisch und waren mehr oder weniger in der Lage, ein Gespräch mit ihm zu führen. Er wiederum hatte ein paar Brocken Französisch aufgeschnappt, darunter die Sorte von Flüchen, die Soldaten kleinen Kindern zu ihrer Belustigung gern beibrachten.
Es schien, als hätten sie nach ihm Ausschau gehalten, und sie bedeuteten ihm, auf einem Hocker Platz zu nehmen, während einer der Soldaten in die Zitadelle hineintrat und zu den Baracken lief. Nabulione blickte in die Gesichter der Franzosen und sah, dass sie ihn belustigt und voller Erwartung beobachteten. Einer schnitt dicke Scheiben von einer Wurst ab, und der Junge rief ihm zu und zeigte erst auf die Wurst und dann auf seinen Mund. Der Mann lächelte und gab ihm ein paar Scheiben, zusammen mit einem Stück Brot, das er von einem frisch gebackenen Laib riss. Nabulione murmelte einen Dank und begann, sich das Essen in den Mund zu stopfen. Mit Nägeln beschlagene Stiefel klapperten über das Kopfsteinpflaster, und der Soldat, der in die Kaserne gegangen war, kam zurück und hatte ein Stück Stoff unter einem Arm gefaltet. In der anderen Hand hielt er ein hölzernes Schwert. Er ging vor Nabulione in die Hocke, legte das Spielzeugschwert neben ihn und faltete vorsichtig den Stoff auseinander. Zum Vorschein kamen eine kleine Uniform und ein Dreispitz in Kindergröße. Der Soldat zeigte auf seine eigene Uniform.
»Hier«, sagte er auf Italienisch mit starkem französischem Akzent. »Das Gleiche.«
Nabuliones Augen wurden groß vor Aufregung. Er kaute und schluckte, was er an Essen noch im Mund hatte, und legte den Rest rasch beiseite, dann stand er auf und griff nach dem weißen Uniformrock mit seinen ordentlich genähten blauen Aufschlägen und den blank polierten Messingknöpfen. Er schlüpfte in die Ärmel und überließ dem Soldaten das Zuknöpfen, bevor er einen schmalen Gürtel um seine Taille schnallte. Als er fertig war, begann der Mann ein Paar schwarze Gamaschen zuzuknöpfen, die bis zum Saum des Rocks hinaufreichten. Ein anderer Soldat setzte den Dreispitz vorsichtig auf Nabuliones Kopf, und dann standen sie alle um ihn herum, um das Ergebnis zu begutachten. Der Junge bückte sich um sein Schwert und schob es in den Gürtel, bevor er das Kreuz durchdrückte und ihnen salutierte.
Die Franzosen lachten dröhnend und schlugen ihm liebevoll auf die Schulter.
Einer von denen, die Italienisch sprachen, beugte sich über ihn und sagte: »Jetzt bist du ein richtiger Soldat. Nur den Eid musst du noch ablegen.« Er richtete sich auf und hob seine Rechte. »Monsieur Buonaparte. Bitte hebt Eure Hand.«
Nabulione zögerte für einen Moment. Das waren schließlich Franzosen, und trotz der Freundschaft, die seine Mutter mit dem Gouverneur verband, brachte sie gern finstere Ansichten über die neuen Herrscher Korsikas zum Ausdruck. Aber dann sah Nabulione auf seine wunderschöne Uniform hinunter, und der mit Goldfarbe gestrichene Griff des Schwerts ragte aus seinem Gürtel. Und er schaute in die lächelnden Gesichter der um ihn versammelten Männer hinauf und verspürte ein heftiges Verlangen, zu ihnen zu gehören. Er hob die Hand.
»Bravo!«, rief jemand.
»Jetzt, kleiner Korse, sprich mir nach. Ich schwöre Seiner Allerkatholischsten Majestät König Ludwig ewigen Gehorsam …«
Nabulione plapperte die Worte gedankenlos nach, während er in der Freude schwelgte, ein Soldat zu werden, und an all die Abenteuer dachte, die er vielleicht erleben würde. An die Kriege, in denen er kämpfen würde, und wie er ein Held sein und seine Männer in einem wagemutigen Angriff gegen eine gewaltige Übermacht anführen würde, und wie er unter dem lauten Jubel seiner Freunde und seiner Familie im Triumph heimkehren würde.
»So! Das war’s, junger Mann«, sagte der französische Soldat. »Jetzt bist du einer von uns.«
Doch Nabuliones Gedanken blieben bei seiner Familie. Als er zum Hafen zurückblickte, wurden entlang der Straße und in den Fenstern der Häuser die ersten Lampen angezündet.
»Ich muss gehen«, murmelte er und wies in die Richtung seines Zuhauses.
»Ach?«, lachte der Soldat. »Du desertierst schon?«
Der Junge begann, seine Uniform aufzuknöpfen, aber der Soldat hielt ihn zurück. »Nein. Die Uniform ist für dich. Behalte sie. Und überhaupt bist du jetzt ein Mann des Königs, und wir erwarten, dass du bald wieder zum Dienst erscheinst.«
Nabulione sah ungläubig an sich hinab. »Sie gehört mir? Ich kann sie behalten?«
»Aber natürlich. Und jetzt lauf zu.«
Der Junge sah dem Soldaten in die Augen. »Danke«, sagte er leise, und die kleinen Finger schlossen sich um das Heft des Spielzeugschwerts. »Danke.«
Als er sich der kleinen Gruppe Soldaten näherte, teilten sie sich vor ihm, als wäre er ein General, und als er sich noch einmal umdrehte, rief jemand einen Befehl, und alle nahmen unter breitem Grinsen Habachtstellung ein und salutierten. Nabulione erwiderte den Salut mit ernster Miene, dann machte er kehrt und marschierte nach Hause, und er kam sich groß wie ein Mann vor und großartig wie nur irgendein König.
Hinter ihm widmeten sich die Franzosen wieder ihrer Abendration Wurst, Brot und Wein. Der Soldat, der Nabulione eingekleidet hatte, beobachtete, wie der Junge die Straße entlangstolzierte, und er lächelte zufrieden, ehe er sich zu seinen Kameraden gesellte.
5
Bis Nabulione zu Hause eintraf, war der Abend hereingebrochen, und seine zur Schau gestellte Tapferkeit schwand bei der Aussicht, sich in sein Zimmer schleichen zu müssen, ohne erwischt zu werden. Er wartete einen Moment in der Eingangshalle und lauschte angestrengt nach Geräuschen im Haus. Aus dem Obergeschoss drangen die Stimmen von Nabuliones Eltern zu ihm. Er ging auf Zehenspitzen zur Treppe und schlich nach oben, indem er sich möglichst dicht an der Wand hielt, um das Knarren der Stufen zu vermeiden. Sein Herz hämmerte vor Anspannung, als er oben ankam, durch die Tür zu den Räumen der Familie schlüpfte und sich in dem dunklen Flur auf den Weg zu dem Zimmer machte, das er mit Giuseppe teilte. Er kam nicht weit. Das Spielzeugschwert, das in seinem Gürtel steckte, scharrte plötzlich über eine Sockelleiste.
Ehe der Junge in seinem Zimmer verschwinden konnte, wurde die Tür zur Küche aufgerissen, und ein matter Lichtschein fiel in den Flur.
»Woher um alles in der Welt …«, begann sein Vater, dann setzte er einen Moment aus, da sein Zorn der Überraschung Platz machte. »Was trägst du da an deinem Leib? Komm her, Junge!«
Nabulione näherte sich vorsichtig der Küchentür, hielt inne, um seinen Dreispitz abzunehmen, ehe er eintrat, und hob den Kopf zu seinem Vater, der hoch über ihm aufragte. Seine Mutter saß am Tisch. Sie presste die Lippen zusammen, als sie die Uniform sah.
»Woher hast du das?«
»Es … es war ein Geschenk.«
»Von wem?«
»Von den Soldaten in der Zitadelle.«
Letizia stand auf und stieß den Zeigefinger in Richtung ihres Sohns. »Zieh das aus! Wie kannst du es wagen, so etwas zu tragen?«
Nabulione war bestürzt über das Gift in ihrer Stimme. Er löste eilig den Gürtel und öffnete die Knöpfe, dann schlüpfte er aus den Ärmeln des Mantels und legte ihn auf den Tisch. Die Gamaschen folgten, zusammen mit dem Dreispitz und dem Spielzeugschwert. Die ganze Zeit über sahen ihn seine Eltern an. Zuletzt brach sein Vater das Schweigen.
»Sag mir, dass du nicht in dieser Uniform durch die Stadt gelaufen bist.«
»Das bin ich.«
Carlo verdrehte die Augen und griff sich an die Stirn.
»Hat dich jemand gesehen?«, fauchte Letizia. »Rede! Die Wahrheit, wohlgemerkt.«
Nabulione überlegte. »Es wurde schon dunkel. Ich bin ein paar Leuten begegnet.«
»Haben sie dich erkannt?«
»Ja.«
»Nun«, sagte Letizia in bitterem Ton, »dann wird sich schnell herumsprechen, dass unser Sohn in einer französischen Uniform gesehen wurde. Damit ist es endgültig vorbei mit dem Ansehen, das unsere Familie früher einmal in dieser Stadt genossen hat. Es ist schlimm genug, dass dein Vater bei den Franzosen in Diensten steht, Nabulione. Jetzt marschiert unser Sohn auch noch in einer französischen Uniform in der Stadt umher. Die Paolisten werden den Namen unserer Familie in den Schmutz ziehen.«
Carlo trat an den Tisch und untersuchte die winzige Uniform. »Du übertreibst, Letizia. Das ist Spielzeug, weiter nichts. Eine Verkleidung für Kinder. Sie haben die Uniform nur zum Spaß für ihn gemacht.«
»Sie war ein Geschenk«, meldete sich Nabulione zu Wort. »Sie gehört mir.«
»Still, du kleiner Idiot«, sagte Letizia kalt. »Begreifst du, was du getan hast? Was für Narren du aus uns gemacht hast?«
Der Junge schüttelte den Kopf, bestürzt über ihre Wut.
»Nun, dann versuch es wenigstens zu begreifen, bevor du unseren Ruf noch weiter ruinierst. Weißt du, dass es nach wie vor Gruppen korsischer Patrioten gibt, die da draußen in der Macchia gegen die Franzosen kämpfen? Weißt du, was sie mit allen Kollaborateuren machen, die sie erwischen?«
Nabulione schüttelte den Kopf.
»Sie schneiden ihnen die Kehle durch und lassen sie zur Warnung so liegen, dass andere sie sehen. Willst du, dass uns das passiert?«
»N… nein, Mutter.«
»Schluss jetzt!« Carlo hob die Hand. »Du machst dem Jungen Angst.«
»Gut so! Er soll Angst haben. Seinetwillen ebenso sehr wie unseretwillen.«
»Aber wir sind hier nicht in der Macchia. Wir sind in der Stadt. Die Garnisonstruppen sind hier, um uns zu schützen. Um die Ordnung wiederherzustellen. Die Paolisten sind kaum mehr als Banditen. Ehe das Jahr um ist, werden sie erledigt sein. Die Franzosen gehen nicht mehr weg von hier, und je früher die Leute das akzeptieren, desto besser. Ich habe es akzeptiert.«
Letizia lachte höhnisch. »Glaube bloß nicht, dass ich das nicht bemerkt habe. Glaube nur nicht, es widert mich nicht an, dass wir unser Geburtsrecht als Korsen verkaufen mussten, um die Zukunft unserer Familie zu sichern.«
Nabulione verfolgte ängstlich die Auseinandersetzung zwischen seinen Eltern, und jetzt bekam er kaum noch Luft, als er sich einmischte. »Ich habe nur mit ihnen gespielt, Mutter.«
»Nun, spiel nicht mit ihnen! Nie wieder, verstanden?«
Er nickte.
»Und was das hier angeht …« Sie raffte Uniform und Hut zusammen, »das muss weggeworfen werden.«
»Aber Mutter!«
»Schweig! Es muss verschwinden. Und du darfst von all dem zu niemandem etwas sagen.«
Der Junge kochte innerlich, aber er wusste, er musste gehorchen, wenn er nicht Prügel beziehen wollte, die er lange nicht vergessen würde. Er nickte.
»Jedenfalls«, sagte Carlo in beruhigendem Ton, »rennst du schon zu lange in der Stadt herum. Du bist halb verwildert. Sieh dich an. Dein Haar braucht dringend einen Kamm. Nein, besser einen Schnitt. Und du musst ein wenig Disziplin lernen. Es ist Zeit, dass du mit der Schule beginnst.«
Nabulione sank der Mut. Schule? Das war so schlimm wie ins Gefängnis zu gehen.
»Deine Mutter und ich haben es bereits besprochen. Was dir fehlt, ist eine Erziehung. Ich werde morgen mit Abt Rocco reden, damit er dich und Giuseppe an seiner Schule aufnimmt. Das bedeutet, wir werden weniger Geld übrig haben, aber ich glaube, angesichts der heutigen Ereignisse können wir es uns nicht leisten, euch nicht hinzuschicken.«
6
Irland, 1773
Anne schenkte sich eine frische Tasse Tee ein und sah aus der Tür der Orangerie auf den Rasen hinaus, wo ihre Kinder spielten. Richard und William, die beiden älteren Jungen, kommandierten Anne und Arthur einmal mehr herum, während sie eine Sammlung von Trockengestellen und Laken zu den Umrissen eines Schiffs ordneten. Ein Buch über Piraten hatte die Runde im Kinderzimmer gemacht und war der Reihe nach von jedem Kind verschlungen worden, und in den letzten Wochen des Sommers hatten sie nichts anderes gespielt. Wie immer sagte der stille, inzwischen vierjährige Arthur nicht viel, sondern führte konzentriert und gründlich aus, was man ihm auftrug. Anne beobachtete ihn mit einem ausgeprägten Gefühl von Mitleid. Er hatte empfindsame Gesichtszüge entwickelt; seine Nase war leicht abwärts gebogen, seine Augen waren von einem leuchtenden Hellblau, und das Ganze wurde von langem blondem Haar eingerahmt, das in der leichten Brise wehte.
Anne hob die Tasse zum Mund und trank einen kleinen Schluck. Auf dem Boden neben ihr schlief ihr jüngster Sohn Gerald, der ein Jahr nach Arthur zur Welt gekommen war, und sie erwartete bereits das nächste Kind, das Henry heißen sollte, wenn es sich als ein Junge erwies.
Auf der anderen Seite des Tischs hatte Garrett einen Bogen Notenpapier auf dem Tisch ausgebreitet. Er arbeitete an einer neuen Komposition, und gelegentlich setzte er seine Geige an die Schulter und zupfte an den Saiten, um ein Arrangement auszuprobieren. Nach einer Weile ließ er das Instrument dann wieder sinken, griff nach einem Federkiel und begann, Änderungen in die Notenlinien zu schreiben.
Anne hüstelte. »Garrett, was, denkt Ihr, wird aus ihm werden?«
»Hä?«, brummte ihr Mann und runzelte die Stirn. Er tunkte seine Feder in die Tinte und strich verärgert einige Noten aus.
»Arthur.«
Garrett blickte fragend auf. »Was ist mit ihm?«
»Bitte legt diesen Federkiel beiseite, bevor wir das Gespräch fortsetzen.«
»Was? Oh. Na schön. Wie Ihr wünscht. So.« Er lehnte sich zurück und verschränkte lächelnd die Hände. »Ich bin ganz Ohr.«
»Danke. Ich hätte gern gewusst, was Ihr von Arthur haltet.«
»Was ich von ihm halte?« Garrett sah zu den Kindern hinaus, die im Garten spielten, als hätte er eben erst bemerkt, dass sie da waren. »Ach, er wird sicher gut zurechtkommen.«
»Tatsächlich? Und welche Zukunft könntet Ihr Euch für ihn vorstellen?«
»Ach, ich weiß nicht. Etwas in der Geistlichkeit, würde ich sagen.«
»In der Geistlichkeit?«
»Ja. Schließlich lässt er keinerlei verstandesmäßige Anlagen erkennen. Ganz anders als Richard und William. Selbst der kleine Gerald hier scheint Zahlen und Buchstaben schneller zu begreifen als Arthur. Wir werden natürlich für ihn tun, was wir können, aber ich wage zu behaupten, dass er nie nach Oxford oder Cambridge gehen wird.«
»Nun ja. Sicher nicht.«
In diesem Moment unterbrach ein durchdringender Schrei aus dem Garten ihr Gespräch und ließ sie herumfahren. Arthur war auf die Knie gesunken und hielt sich den Kopf. Ein Holzschwert lag neben ihm auf dem Boden, und William sah seinen jüngeren Bruder wütend an.
»Herrgott nochmal, Arthur, ich habe dich doch kaum berührt. Und überhaupt sagte ich, du sollst dich verteidigen.«
Garrett schüttelte den Kopf und blickte auf seine Musik hinab. Dann schaute er auf, weil er plötzlich eine Idee hatte. »Arthur! Komm hierher, mein Junge.« Als Arthur aus dem Garten ins Haus gewackelt kam, lächelte Garrett. »Ich finde, es ist Zeit, dass du ein Musikinstrument spielen lernst. Und was wäre besser geeignet als die Geige? Komm her, Kind. Ich zeige es dir.«
Anne sah zu, wie ihr Mann dem kleinen Jungen seine ausgewachsene Violine vorsichtig in die Hände legte und jede Saite für ihn benannte. Dan griff er nach dem Bogen und spielte einige Töne. Nach wenigen Minuten hatte Arthur seine Kopfverletzung vergessen, hörte konzentriert zu und saugte jedes Detail über das Instrument auf, das ihm sein Vater mitteilte. Schließlich zog Garrett einen Stuhl heran und hieß den Jungen mit der Geige im Schoß Platz nehmen, und dann sägte Arthur fröhlich drauflos, dass einem das Quietschen und Kratzen das Blut in den Adern gerinnen ließ. Gerald schreckte aus seinem Schlaf auf den Kissen und schaute beunruhigt nach der Quelle des misstönenden Lärms.
Anne lächelte. »Zeit für das Abendessen, würde ich sagen. Lauft schon mal vor, Kinder. Arthur, leg das weg und begib dich auch in die Küche. Dein Vater und ich kommen sofort nach.«
»Ja, Mutter.«
Garrett streckte die Hände nach dem Instrument aus. »Danke. Soll ich dir beibringen, wie man sie richtig spielt?«
Die Augen des Jungen funkelten. »Oh ja, Vater! Das würde mir gefallen.«
Garrett lachte. »Gut. Und eines Tages werden wir zusammen Musik komponieren.«
Arthur lächelte strahlend, dann eilte er um den Tisch herum, um seinem kleinen Bruder aufzuhelfen. Die beiden marschierten mit ungelenken kleinen Schritten in Richtung Küche und hielten sich dabei an den Händen. Beide Eltern blickten ihnen nach, dann sahen sie einander an und lächelten.
»Musiker, denke ich«, sagte Garrett.
»Gott stehe uns bei«, murmelte Anne. »Eure Wohltätigkeitskonzerte werden uns noch ruinieren.«
»Schämt Euch! Wir können es uns leisten. Davon abgesehen, ist es meine christliche Pflicht, Kultur unter den weniger Privilegierten zu verbreiten.«
»Ich würde meinen, Eure erste Christenpflicht hätte dem Wohlergehen Eurer Familie zu gelten.«
»Das tut sie, meine Liebe.« Er sah sie durchdringend an. »Nun, wir haben über den kleinen Arthur gesprochen, und ich glaube im Ernst, er könnte für eine musikalische Laufbahn geeignet sein.«
»Wie wundervoll«, erwiderte Anne mit beißender Ironie.
»Ja, gut … In der Zwischenzeit müssen wir eine Schule für ihn finden. Ich habe bereits eine im Sinn.«
»Ach ja?«
Garrett nickte. »Die Diözesan-Schule in Trim. Ihr kennt sie. St. Mary’s Abbey.«
Anne blickte ihrem Sohn hinterher. »Denkt Ihr, er ist alt genug?«
»Meine Liebe, wenn wir jetzt nicht anfangen, ihn auf das Leben vorzubereiten, wann dann? Wenn er nicht hinter Richard und William zurückfallen soll, müssen wir ihn hart rannehmen.«
»Ihr habt natürlich recht. Es ist nur … Er wirkt so verletzlich. Ich habe Angst um ihn.«
»Er wird schon zurechtkommen«, sagte Garrett in beruhigendem Ton.
7
Korsika, 1775
Ich gehe nicht! Ich gehe nicht!«
Letizia schüttelte den Jungen an den Schultern. »Du wirst gehen, und jetzt Schluss damit! Zieh dich an.«
Draußen ließ das erste Tageslicht die Einzelheiten an den Häusern auf der anderen Straßenseite hervortreten. Letizia führte ihren Sohn zu der Kleidung, die auf seinem Bett ausgelegt war, und deutete darauf. »Auf der Stelle!«
»Nein!«, schrie Nabulione zurück und verschränkte die Arme. »Ich gehe nicht!«
»Du wirst gehen.« Letizia gab ihm eine Ohrfeige. »Du gehst zur Schule, mein Junge, und du ziehst dich an. Du wirst kommen und dein Frühstück essen, und du wirst dich einwandfrei benehmen, wenn du dem Abt vorgestellt wirst. Oder du bekommst die Prügel deines Lebens. Habe ich mich deutlich ausgedrückt?«
Ihr Sohn legte die Stirn in Falten, und seine Augen blitzten vor Trotz. Letizia bekreuzigte sich. »Maria, Mutter Gottes, schenke mir Geduld. Warum kannst du nicht mehr von deinem Bruder haben?« Sie wies mit einem Kopfnicken zu Giuseppe, der sich auf der anderen Seite des Zimmers die Schnürsenkel band. Seine Kleidung war ordentlich und sauber, und sein Haar glänzte frisch gebürstet.
»Von ihm?« Nabulione lachte. »Dass ich nicht lache, Mutter. Warum sollte ich sein wollen wie er? Dieser Waschlappen.«
Letizia schlug ihn wieder, kräftiger diesmal. Auf der Wange des Jungen blieb ein Abdruck ihrer schlanken Finger zurück. »Was fällt dir ein, so von deinem Bruder zu sprechen?« Sie wies erneut auf die Kleidung. »Jetzt zieh dich an. Wenn du nicht fertig bist, bis ich zurückkomme, gibt es heute Abend nichts als trockenes Brot für dich.«
Sie stürmte aus dem Zimmer und wandte sich der Küche zu, wo Lucien – ihr jüngstes Kind – nach mehr Nahrung plärrte.