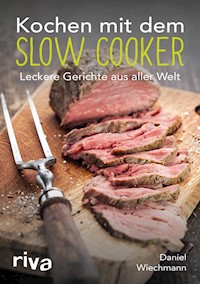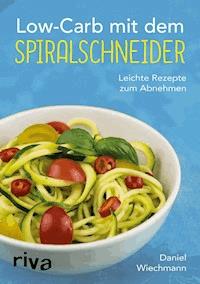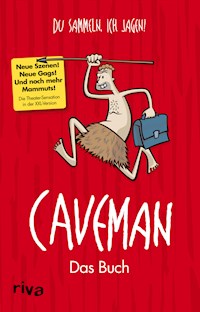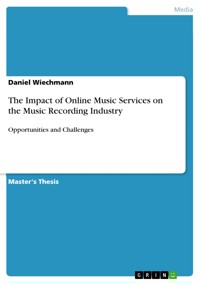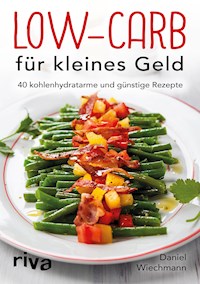2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Was macht ein waschechter Berliner bei den Bajuwaren?
Als die kleine Familie Wiechmann den Umzug in den Süden wagt, ahnt sie noch nicht, dass die Reise von Berlin nach München weit mehr bedeutet als eine neue Wohnung in irgendeiner deutschen Stadt. Denn auf dem Planet Bayern geht es ganz anders zu als im übrigen Deutschland.
Zunächst einmal heißt es, eine bezahlbare Wohnstätte zu ergattern. Unmöglich? Nicht, wenn man einen Spezl hat, der einen Spezl hat, der wiederum einen kennt, der … So geht das Networking auf gut bayerisch, und wer das mit mediterranen Verhältnissen vergleicht, hat nicht ganz Unrecht. Überhaupt fühlt sich vor allem Ehefrau Maria ihrer italienischen Heimat nicht nur geographisch und klimatisch näher. Dumm nur, dass die Menschen in Bayern weder deutsch noch italienisch sprechen, sondern ein rätselhaftes Idiom. Nach und nach lernen die Neu-Bayern die Sitten und Gebräuche der Einheimischen kennen und bald begreifen sie, dass Multikulti in Bayern nur eins bedeutet: Man integriert sich nicht, man wird integriert. Und als schließlich das zweite Kind geboren wird, nun ein echtes Münchner Kindl, sind die Wiechmanns Bayern-Fans geworden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
1. AuflageCopyright © 2013 beim Albrecht Knaus Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-09123-1www.knaus-verlag.de
Inhalt
Vorspiel am Berg
1. Kapitel: In welchem ein Berliner eine folgenschwere Entscheidung über einen Umzug trifft und einem Kind eine Überraschung versprochen wird
2. Kapitel: In welchem Freunde auf merkwürdige Art miteinander trauern und die Ängste eines Mannes durch Frauenlogik geheilt werden
3. Kapitel: In welchem sich die Such- und Fluchgeschichten über den Münchner Wohnungsmarkt leider bewahrheiten und sich eine flüchtige Bekanntschaft als äußerst vorteilhaft erweist
Exkurs: In welchem die Funktionsweise des Spezlwesens näher erläutert wird und der Leser erfährt, wie wichtig es im Leben ist, den richtigen Architekten für den Bau seines Hauses zu finden
4. Kapitel: In welchem Rotwein den Gedankenaustausch zweier Männer enthemmt und so erstaunliche Vorurteile über den Freistaat Bayern zutage treten
5. Kapitel: In welchem die neuen Hausbewohner in München bei einem Berliner für ausgesprochen wirre Träume sorgen
6. Kapitel: In welchem die Bayern ungemein zügig mit dem Assimilationsprozess eines zugereisten Berliners beginnen. Ob der das nun will oder nicht
7. Kapitel: In welchem sich das Kaufen von Fahrkarten in München erst als Hürde, dann jedoch als glänzende Geschäftsidee erweist
8. Kapitel: In welchem die Knochenbiegsamkeit von Kindern, die Nervenstärke von Müttern und die Fremdsprachenfähigkeiten eines Berliners getestet werden
9. Kapitel: In welchem über die Bedeutung von Herkunft diskutiert und festgestellt wird, dass Heimat dort ist, wo man sich aufhängt
10. Kapitel: In welchem die innere Uhr eines Berliners mit dem bayerischen Zeitmanagement vertraut gemacht und richtig eingestellt wird
11. Kapitel: In welchem die Macht der Verführung mehr und mehr das Zepter übernimmt
12. Kapitel: In welchem ein Berliner einen Berg rufen hört und das Gefühl nicht loswird, dass es sich dabei um Beschimpfungen handelt
13. Kapitel: In dem versucht wird, vor dem Tod davonzulaufen und dabei eine möglichst gute Figur zu machen
14. Kapitel: In dem zusammenpasst, was eigentlich nicht zusammengehört, und die bayerische Logik das Gehirn eines Berliners arg strapaziert
15. Kapitel: In welchem ein Berliner die Abgründe der bayerischen Küche entdeckt und dann auch noch in die selbigen hineingestossen wird
16. Kapitel: In welchem eine Frau ein Geheimnis zu ergründen sucht und dabei eine merkwürdige Verwandlung durchlebt
17. Kapitel: In welchem es endlich auf den Berg geht, Erschöpfung mit Weissbierspülungen geheilt werden und ein Berliner das erste Mal im Leben dem Chor der Schnarcher lauschen darf
18. Kapitel: In welchem ein Blick hinter Kulissen der Idylle offenbart, dass selbst die bayerische Welt nicht immer so heil ist, wie sie ausschaut
19. Kapitel: In welchem einem Berliner erklärt wird, warum alle Menschen und insbesondere er Deppen sind und das auch gut so ist
20. Kapitel: In welchem Besuch aus Berlin eintrifft und das schwierige Verhältnis der Bayern zur Revolution erläutert wird
21. Kapitel: In welchem ein Berliner beschliesst, erst wieder nach Hause zu fahren, wenn man in der Spree wieder Fische sehen kann
22. Kapitel: In welchem die Münchner Society auftritt und Adabeis, Champagner und Kirschsaft eine wichtige Rolle spielen
23. Kapitel: In welchem ein Stromausfall zwei Männer zusammenführt und jemand »Oachkatzlschwoaf« sagt
24. Kapitel: In welchem ein Berliner nicht Nein sagen kann, weil er erst gar nicht gefragt wird
25. Kapitel: In welchem ein Berliner auf einer Bierbank schwitzt, anschliessend auf eine Guillotine gelegt wird und kurz darauf auch noch seinen Kopf verliert
26. Kapitel: In welchem sich Völker sehr intensiv miteinander verständigen und am Ende jemand ganz dringend Schnaps braucht
27. Kapitel: In welchem es in einem Iglu beängstigend dunkel und eine Gewissenfrage gestellt wird
28. Kapitel: In welchem ein Berliner mit den Finessen der bayerischen Politik vertraut gemacht und eine Antwort auf die wichtige Frage »Was würde Franz Josef tun?« gefunden wird
29. Kapitel: In welchem die Bibel als das einzig wahre Vornamenbuch gepriesen wird
Nachspiel
Vorspiel am Berg
»Du musst in den Schmerz reinatmen.«
Max klopft mir lachend auf die Schultern. »Dann wird’s besser. Bis nach oben is scho noch a weng.« Oben, das ist der Watzmann. Seit mehr als drei Stunden steigen wir durch die bayerische Berglandschaft. Und seit einer halben Stunde weist mich eine Blase an der rechten Ferse bei jedem Schritt unmissverständlich darauf hin, dass ich derlei Bergtouren nicht gewohnt bin.
»Max … wie soll ich denn … in den Schmerz reinatmen … wenn ich überhaupt keine Luft mehr kriege?«
Mein Herz rattert in meiner Brust wie eine Nähmaschine. Wie ist das möglich? Ich krieche den Berg im Schneckentempo hoch, fühle mich jedoch, als würde ich den verdammten Berg bauen. Seit uns vor einer Stunde eine Gruppe unverschämt fitter Rentner überholt hat, ist meine Motivation ohnehin im Keller.
»Ah geh, du schaugst no ganz guad aus. I seh des scho, wennsd nimma weida koanst.«
In ruhigen Schritten setzt Max seinen Weg fort. Ich folge ihm und versuche, wie mir geheißen, in den Fersenschmerz hinein zu atmen. Wenn man mit Max unterwegs ist, empfiehlt es sich, auf das zu hören, was er einem sagt. Vor allem dann, wenn man auf einem Weg wandert, an dessen linker Seite ein fünfhundert Meter tiefer Abgrund liegt. Ich versuche es mit Kreisatmung, Schnappatmung und sogar mit der Wunderatmung, die ich vor fünf Jahren im Geburtsvorbereitungskurs gemeinsam mit Francesca gelernt habe. Es hilft nichts. Hat ja auch schon damals bei der Geburt nicht geholfen, das Atmen. Nachdem bei ihr die Wehen künstlich eingeleitet werden mussten, und die Kontraktionsschmerzen aufgrund des Medikamentes nicht erst einmal in sanft schwappenden Wellen, sondern von Anfang an in Tsunamistärke daherkamen, hatte Francesca wütend nach einer PDA verlangt. Die hätte ich jetzt auch gerne. Von wegen in den Schmerz reinatmen! Nur, wo kriegt man in dieser Einöde einen fähigen Anästhesisten her?
Mit jedem Schritt werden die Schmerzen an meinen Füßen unangenehmer: Ich hätte es wissen müssen! Was hätte ich schon anderes – außer Schmerzen – von diesem Berg erwarten können? Schließlich war der Watzmann nach einem tyrannischen König benannt, dessen Lieblingsbeschäftigung es zu Lebzeiten gewesen war, sich am Leid anderer zu weiden. Eine halbe Stunde später machen wir am Watzmannhaus Pause. Die Hütte liegt auf 1930 Metern Höhe. Wir haben erst zwei Drittel des für heute geplanten Weges hinter uns.
»Ich kann nicht mehr«, sage ich zu Max, der in aller Seelenruhe sein Wurstbrot kaut.
»Wie? Du kannst nimma?«, fragt er zurück und puhlt ein Stück Sehne zwischen den Zähnen hervor.
Welches meiner Worte hat er nicht verstanden? »Ich kann halt nicht mehr«, wiederhole ich extra deutlich.
»Ja mei … nur weil du nimma kannst, is des doch koa Grund aufzuhörn!«
»Wieso nicht?«
Es kam zwar häufiger vor, dass ich bei Max nicht genau kapierte, was er mir eigentlich sagen wollte, aber daran gewöhnt habe ich mich immer noch nicht.
»Der einzige Grund aufzuhörn is, dass du nimmer weitergehen mogst«, doziert Max.
Wie bitte? »Ja, leck mich doch mal einer am Arsch«, platzt es aus mir heraus. Mit seiner verflixten bayerischen Logik schafft Max es immer wieder, mich zu irritieren.
»Siegst es, geht doch. Genau des is die richtige Einstellung«, freut sich Max. »So, und jetzt isst erst amol an Apfel. Danach hast auch Appetit auf an Brot.«
Max gibt mir einen Apfel. Offenbar vertraut er mir mehr als ich mir selbst. Der Apfel tut die versprochene Wirkung. Der Brechreiz ist weg. Und dank des Brotes, das danach einfach nur gut schmeckt, komme ich wieder zu Kräften. Max kramt ein Blasenpflaster aus einem Rucksack hervor.
»Kleben koanst selba!«
Gott sei Dank können wir die Rucksäcke in der Hütte lassen. Ein paar Kilo weniger, die ich mit mir herumschleppen muss. Missmutig folge ich Max auf dem Weg zum Hocheck, dem ersten der drei Gipfel des Watzmannmassivs. Mittlerweile klopft mein Herz beinahe verzweifelt gegen meine Brust. Wie ein Gefangener gegen die Zellentür, der es nicht mehr aushält in seinem engen, stickigen Kerker. Zwei Stunden später sind wir auf der nördlichen Spitze des Watzmanns angelangt. Glücklich und erschöpft sitze ich auf einem Stein und schnaufe durch. Mein erster Gipfel! An dem mannshohen schwarzen Gipfelkreuz hängt ein goldener Jesus. Max fordert mich auf, mich neben ihn zu stellen, um ein Foto zu machen. Ich schleppe mich hin und versuche zu lachen.
Obwohl die Fernsicht nicht optimal ist, das Panorama um uns herum ist imposant. Der Horizont verliert sich in hunderten Berggipfeln. Unter uns glitzert das Wasser des Königssees. Er scheint eine kleine Unendlichkeit entfernt. Nachdem mein Atem zur Ruhe gekommen ist und auch mein Herz nicht mehr wie wild in meiner Brust pocht, bin ich überwältigt von der majestätischen Stille, die hier oben herrscht. Es heißt, an einem großen Ort kommen einem große Gedanken – die einzigen Gedanken aber, die mir durch den Kopf gehen, lauten: Wie um alles in der Welt komme ich hier wieder lebend runter? Und wieso bin ich überhaupt hierherauf gekommen?
1. Kapitel: In welchem ein Berliner eine folgenschwere Entscheidung über einen Umzug trifft und einem Kind eine Überraschung versprochen wird
Neun Monate zuvor:
»Müssen wir wirklich fahren?«
Es war nicht schwer, die Frage in Oskars großen braunen Augen zu lesen. Es brach mir fast das Herz. Für ihn würde der Umzug am schwersten werden. Drei Wochen lang hatten wir alle gemeinsam beratschlagt, ob ich das Angebot, in München für einen Verlag zu arbeiten, wirklich annehmen sollte. Für Francesca, meine Frau, war die Entscheidung einfach gewesen: Die Entfernung zwischen Berlin und Florenz betrug 1400 Kilometer. München dagegen lag »nur« 800 Kilometer entfernt. Die Aussicht, nur noch 800 Kilometer von »La Mamma« entfernt zu leben, weckte den für sie typischen Tatendrang. Am liebsten hätte sie sofort angefangen, die Kisten zu packen. Der Ruf Münchens als nördlichste Stadt Italiens tat ein Übriges. Oskar fiel es dagegen ungleich schwerer, der Stadt den Rücken zu kehren. Schließlich konnte er, wie einst John F. Kennedy, von sich behaupten: »Ich bin ein Berliner.« Er war hier geboren. Gerade erst hatte er sich in seinem Kindergarten so richtig eingelebt und jede Menge nette und auch jede Menge weniger nette neue Freunde gefunden.
Francesca war also für den Umzug. Oskar dagegen. Die Entscheidung lag also ganz allein bei mir. Meine Stimme würde den Ausschlag geben. Und so wie es aussah, würden wir wohl fahren. Ich war es Francesca schuldig. Neun Jahre hatten wir nun schon zusammen in Berlin gelebt, in der Stadt, in der ich groß geworden und aufgewachsen war. Aber war das überhaupt noch meine Stadt? In der Zeit nach dem Mauerfall hatte sich Berlin rasant entwickelt. Vor allem der Ostteil der Stadt, in dem ich aufgewachsen war, war kaum mehr wiederzuerkennen. Überall wurde gebaut, renoviert, jedenfalls dort, wo es sich lohnte. Ständig gab es etwas Neues zu entdecken. Doch es gab Tage, an denen hatte ich das Gefühl, dass ich mit dem Tempo, in dem sich Berlin veränderte, nicht mehr mithalten konnte; dass mir die Stadt und mein Gefühl für sie einfach mit jedem neuen Gebäude verbaut wurden.
Francesca hatte sich von Anfang an mit dem Leben in Berlin schwergetan. Sie war nach ihrem Studium in Italien für ein halbes Jahr in die Stadt gekommen, um mal etwas anderes zu sehen. Wir lernten uns im Kino kennen. Dabei ist »Kill Bill« wahrscheinlich nicht unbedingt der Film, bei dem ein Mann es sich erträumt, die Liebe seines Lebens zu finden.
Sie war wunderschön, saß in der Reihe links vor mir, und spätestens ab der Szene, in der Uma Thurman Lucy Lius Leibgarde, die Verrückten 88, zerlegt, war ich in sie verliebt. Warum? Weil Francesca weder zur anwesenden Fraktion der männerhassenden Kampflesben noch zur Fraktion der schreckhaften Hühner zählte, die bei jedem Blutspritzer ihre Hände in der Brust ihrer Freunde vergruben oder sich mit unterdrückten Schreckenslauten vom Geschehen auf der Leinwand abwandten, das blutiger war als eine Schlachthof-Doku. Francesca wandte sich keine Sekunde lang ab. Offensichtlich war sie eine Frau, die bereit war, dorthin zu gehen, wo’s richtig wehtut. Zum Beispiel zu mir!
Ich hatte mich nicht getäuscht. Nachdem ihr halbes Berlin-Jahr rum war, zogen wir zusammen. Ein paar Jahre später kam unser Sohn Oskar zur Welt.
Francesca war mit großen Erwartungen nach Berlin gekommen. Doch Berlin war größer. In den letzten Monaten hatte sie mich immer wieder gefragt, ob ich es mir nicht vorstellen könnte, woanders zu leben. Zuerst hatte ich ihr Ansinnen kategorisch ausgeschlossen. Woanders? Woanders klang für mich wie Mülldeponie. Doch je öfter wir uns darüber unterhielten, desto schwächer wurde meine Verteidigung. Wohl auch wegen meines Gefühls, dass Berlin nicht mehr meine Stadt war. Ganz nach Italien zu ziehen, das konnten wir uns beide nicht vorstellen. Ich, weil ich als Redakteur mit der deutschen Sprache mein Geld verdiente und mein Italienisch-Wortschatz zu siebzig Prozent aus Schimpfwörtern bestand. Francesca, weil sie nicht in ein Land zurückkehren wollte, das von einem Clown regiert wird. Da kamen ihr nur noch die Tränen. Nach langen Diskussionen, die zutage förderten, dass Francesca weder die hanseatische Gründlichkeit noch den rheinländischen Frohsinn schätzte und von Stuttgart nicht einmal wissen wollte, wo es genau liegt, einigten wir uns auf die goldene Mitte zwischen Berlin und dem italienischen Stiefel: München. Ich begann Bewerbungen loszuschicken. Und ich bekam Antworten. Viel schneller, als mir lieb war.
Tja, und nun stand ich da, schaute in die Augen eines Vierjährigen und musste ihm etwas schmackhaft machen, von dem ich selbst nicht wusste, was ich davon zu halten hatte. So war es eben, wenn man im 21. Jahrhundert versuchte, ein sensibler Ehemann und Familienvater zu sein.
»Ja, wir müssen wirklich fahren«, sagte ich zu Oskar. »Und ich verspreche dir, in München, das wird ein richtiges Abenteuer werden.«
»Wiesooo?«
»Ganz einfach, München liegt in Bayern. Und die Bayern sind ein sehr eigenartiges Volk mit sehr merkwürdigen Leuten, die lauter verrückte Sachen anstellen.«
Diese Aussicht ließ ein kurzes Lächeln über Oskars Gesicht huschen. Verrückte Sachen gefielen ihm.
»Verrückte Sachen?«, wollte er wissen.
»Das verrate ich dir jetzt noch nicht. Ich will dir ja nicht die Überraschung verderben. Aber ich kann dir sagen: Es wird spek-ta-ku-lär.«
Gott sei Dank gab sich Oskar mit meiner Antwort zufrieden. Ich konnte förmlich sehen, wie er sich anstrengte, sich allerlei Unfug und Chaos vorzustellen. Das machte er immer, wenn ich ihm ein Spektakel versprach. Es war entschieden. Der Umzug war beschlossene Sache. In vier Monaten würden wir den berühmten Weißwurstäquator überqueren und tatsächlich nach München ziehen. Ich fühlte mich erleichtert und angesichts der bevorstehenden Veränderungen erstaunlich gelassen. Schließlich konnte ich damals noch nicht ahnen, dass mein leichtfertig dahingesagtes Versprechen von verrückten Abenteuern und merkwürdigen Leuten sich als die Untertreibung des Jahres erweisen sollte. Der Umzug nach Bayern sollte unser Leben für immer verändern.
2. Kapitel: In welchem Freunde auf merkwürdige Art miteinander trauern und die Ängste eines Mannes durch Frauenlogik geheilt werden
Die Nachricht des bevorstehenden Umzugs hinterließ bei unseren Freunden dieselbe Wirkung wie der Hinweis, man würde an einer ansteckenden Grippe leiden. Mitleidsbekundungen folgten, und wir erlebten bei vielen eine bis dahin ungewohnte Distanz. Immer wieder bekamen wir zu hören, dass es uns dort »unten« bestimmt gefallen und dass das alles bestimmt »nicht so schlimm« werden würde. Obwohl keiner von unseren Freunden jemals in Bayern gelebt hatte. Außer Thomas. Vor mehr als zehn Jahren hatte er mehrere Monate in München verbracht. Damals hatte er einfach so ziemlich überall eine Weile gelebt, ob in Köln, Hamburg oder eben in München. Thomas kannte sich also aus.
»Und du willst wirklich aufs Dorf ziehen?«, fragte er mich, als wir eines Abends bei einer sehr guten Flasche Wein beieinander saßen.
»Ich ziehe doch nicht aufs Dorf. München ist eine Millionenstadt. Übrigens nach Berlin und Hamburg die drittgrößte, die wir in Deutschland haben.«
»Nicht überall, wo eine Million draufsteht, ist auch eine Million drin! Glaube mir, ich war da. München ist winzig. Und die Leute erst, alles selbstverliebte Konformisten. Ich meine, die Bayern haben vierzig Jahre lang nur CSU gewählt. Edmund Stoiber, lass dir das mal bitte auf der Zunge zergehen, ein Mann wie Edmund Stoiber ist da unten ein Volksheld.«
»Thomas, Berlin hat einen Bürgermeister, der Sekt aus Frauenschuhen trinkt!«
»Hat er doch gar nicht! Das ist ein totaler Mythos. Der Wowi hat damals bei der Bambi-Verleihung nur einen Schuh in der einen Hand und eine Flasche Sekt in der anderen gehalten. Fürs Foto. Und selbst wenn, Sekt aus Frauenschuhen zu trinken, ist immer noch besser, als Maßkrüge im Bierzelt zu stemmen. Du wirst schon sehen, München ist ganz anders. Und Bayern sowieso.«
Stirnrunzelnd schnappte sich Thomas die Weinflasche, die noch zu gut einem Drittel voll war, und goss den verbliebenen Inhalt komplett in sein Glas.
»Den brauchst du ja nicht mehr«, sagte er zu mir. »Du trinkst ja jetzt lieber Bier.«
Nun, die Versöhnung zwischen Berlinern und Münchnern würde wohl noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Die Tatsache, dass die Stadt München in bundesdeutschen Umfragen immer wieder eine sehr hohe Lebensqualität zugesprochen bekam und sogar in internationalen Vergleichen dieser Art nicht selten an Nummer eins geführt wurde, tat der ehrlichen und tief empfundenen Abneigung meiner Berliner Freunde gegenüber der heimlichen Hauptstadt Deutschlands und der bayerischen Lebensart keinerlei Abbruch. Im Gegenteil, in den kommenden Wochen wurden wir immer wieder Zeugen, wie sie sich allerlei Mühe gaben, sich alles Bayerische so richtig schön »herzuhassen«. Sie lästerten über süßen Senf, die Großkotzigkeit des FC Bayern, fragten, ob ich jetzt auch Mitglied im Trachtenverein werden wolle und ob sie mir vielleicht eine Tuba zum Abschied schenken sollten, damit ich in Bayern, so wie alle dort, in einer Blaskapelle mitmachen könne. Mit der Zeit nervten mich die Anspielungen, auch wenn Francesca mir zu erklären versuchte, dass sie mich mit ihren Foppereien eigentlich gar nicht verärgern wollten.
»Non ti preoccupare – mach dir keine Gedanken. Die Neckereien sind ihre Art, dir zu sagen, dass sie traurig sind, dass wir weggehen.«
»Aber warum sagen sie dann nicht einfach, dass sie traurig sind?«
»Na, dit sollteste aba selba am besten wissen, wa!«, äffte Francesca den schnoddrigen Berliner Dialekt nach, den sie noch nie hatte ausstehen können. »Du weißt doch ganz genau, dass ihr Berliner Probleme damit habt, eure Gefühle auszudrücken. Stattdessen versteckt ihr euch hinter eurer berühmten Berliner Schnauze.«
»Aber was ist, wenn sie recht haben? Ich bin nun mal ein Berliner. Berliner hassen Bayern. Das ist nun mal so.«
Francesca lachte mich an und sagte: »Wie kannst du etwas hassen, das du nicht kennst?«
Wenn Francesca mit einer Sache recht hatte, dann war das schon schlimm genug. Ihre Fähigkeit, mit einem einzigen Satz ein Problem in Luft aufzulösen, versetzte mich jedoch immer wieder in Staunen.
»Lernst du so was in den Frauenmagazinen, die du immer liest? Manchmal bist du mir ein bisschen unheimlich.«
Tatsächlich war Bayern mir vollkommen fremd. Unsere Urlaube hatten uns meist nach Italien geführt. Oder ans Meer nach Griechenland und in die Türkei. Für den Gedanken, in Bayern Urlaub zu machen, waren wir wahrscheinlich noch nicht alt genug gewesen. Und ehrlich gesagt, hatte mich Bayern auch nie sonderlich interessiert. Alles, was ich über Bayern wusste, stammte entweder aus Büchern oder Fernsehserien à la »Der Bulle von Tölz«. Doch nun würden München und Bayern unser neues Zuhause sein. Wie kann ich etwas hassen, das ich nicht kenne?
Berliner Schnauze hin, Bayernhass her. Meine Freunde hatten es geschafft, dass ich trotz Francescas Zuspruch zweifelte. Plötzlich sah ich unserem Umzug nicht mehr nur mit Erleichterung entgegen. Was, wenn meine Freunde am Ende recht hatten? Was, wenn es tatsächlich ein Fehler war, ausgerechnet nach Bayern zu ziehen? Dass München sehr viel kleiner und sehr viel ruhiger war als Berlin, war mir bei meinen Bewerbungsgesprächen ebenso aufgefallen wie die Tatsache, dass die Menschen dort anders tickten als die Berliner. Und dann war da ja auch noch die Geschichte mit der Wohnungssuche, die ich sorgfältig für mich behalten hatte. Die Lacher, für die dieses Erlebnis bei meinen Freunden garantiert gesorgt hätte, wollte ich mir ersparen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!