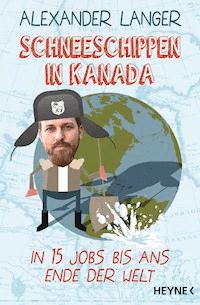
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es fing damit an, dass er mal wieder dringend einen Job brauchte … Alexander Langer, Mitte dreißig, war unter anderem schon Daytrader, Tretbootverleiher, Animateur und Besitzer einer deutschen Bar in Seoul. Seine Jobs führten ihn einmal um die Welt – und in die unmöglichsten Situationen. Wie man beispielsweise Jazzbassist wird, ohne Bass spielen zu können, oder als illegaler Taxifahrer in Montreal durch Improvisationsgeschick der Justiz entwischt, davon erzählt er ebenso witzig wie selbstironisch. Wer braucht schon eine Festanstellung, wenn Jobben so schön sein kann?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Alexander Langer
Schneeschippen in Kanada
In 15 Jobs bis ans Ende der Welt
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Es fing alles damit an, dass er mal wieder dringend einen Job brauchte … Alexander Langer, Mitte dreißig, war unter anderem schon Daytrader, Tretbootverleiher, Animateur und Besitzer einer deutschen Bar in Seoul. Seine Jobs führten ihn einmal um die Welt – und in die unmöglichsten Situationen. So wurde er beispielsweise Jazzbassist, ohne Bass spielen zu können, und konnte als illegaler Taxifahrer in Montreal durch Improvisationsgeschick der Justiz entwischen – U2 sei Dank!
Ehrlich, absurd und urkomisch: Wer braucht schon eine Festanstellung, wenn Jobben so schön sein kann?
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Originalausgabe 12/2016
© 2016 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Sarah Otter
Umschlaggestaltung: yellowfarm GmbH, s. freischem
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-17075-2V001
www.heyne.de
Inhalt
1 Sein eigenes Ding machen
2 Young Money Cash Money Billionaire
3 Schneller, als er fällt
4 Bahama-Beige
5 Gefühl für die Straße
6 Am richtigen Finger riechen
7 Immenhof Vice
8 Ihn halten wie ein Profi
9 Das Konzept Sprache
10 Mark, der Sohn des Hauses
11 Amazon-Alumnus
12 Du weißt nicht, wer Herr Kwang ist
13 Daytrading im Wedding
14 Was dein innerer Sechsjähriger will
1 Sein eigenes Ding machen
Hier ist die Situation: Deine Mutter steht auf der Veranda des Hauses in der offenen Tür. Du bist fünfzehn Jahre alt und siehst sie von der Straße aus, du siehst, dass sie wartet. Sie lehnt nicht einfach nur so am Türrahmen, weil sie mal fünf Minuten frische Luft schnappen will oder sich vielleicht mit der Nachbarin auf der anderen Straßenseite unterhält. Es ist zu spät und zu dunkel im verschlafenen Vorort von Montreal, um sich noch über die Straße hinweg zu unterhalten, es ist schon zu kalt, jetzt im Herbst, um einfach so ohne Zweck und Absicht draußen zu stehen, auch wenn gerade noch ein letzter hellblauer Fitzel Tageslicht hinter eurem Haus schimmert und irgendwo ein letzter Vogel sich selber etwas vortschilpt.
Und du siehst, dass deine Mutter rein gar nichts macht, nur zu dir auf die Straße sieht, die du gerade, after-school-stoned und mit dem schlechten Gewissen desjenigen, der sich nicht vom Abendessen abgemeldet hat, auf dem Skateboard raufschmirgelst.
Das ganze Bild eine verdammte Postkarte, unter der im Zapfino-Font »Warten« steht oder »Abend« oder »Herbstimpression« oder »Später Besuch« oder so etwas in der Art.
Du stehst in der Auffahrt, und deine Mutter sagt dir, dass sie mit dir reden muss.
Es ist nie gut, wenn du fünfzehn Jahre alt bist und deine Mutter mit dir reden muss. Muss, nicht will. Das ist ein riesiger Unterschied. Will wäre schon schlecht genug, aber das hätte allen Erfahrungen nach wenigstens noch Zeit bis zum nächsten Morgen.
Muss ist eine Nummer heftiger. Muss bedeutet, dass deine Mutter eigentlich überhaupt nicht mit dir reden will, es aber Umstände und Zwänge und vielleicht sogar richtige Institutionen gibt, die das Reden erfordern, die auch keinerlei Aufschub dulden. Ich setze das alles langsam in meinem fünfzehnjährigen Kopf zusammen, stelle das Skateboard in der Auffahrt zum Haus unter meinen Fuß, während meine Mutter noch immer vor mir in der offenen Tür auf der Veranda steht und das Redenmüssen-Gesicht macht. Die Erfahrung sagt mir, dass Redenmüssen nur mit der Schule zusammenhängen kann.
Wenn du also ein Fünfzehnjähriger bist, der nicht gerne in die Schule geht und eigentlich Tag für Tag Scheiße baut, wie es in der Fachsprache heißt, dann bist du ziemlich sensibilisiert, was die Laune der nächsten Autoritätspersonen angeht. Regel Nummer eins: Es ist nie gut, wenn deine Mutter ankündigt, mit dir reden zu müssen.
Wir gehen ins Haus. Meine Mutter lässt sich in einen Sitzsack in der Ecke meines Zimmers fallen und macht ein Gesicht, wie ich es von ihr kenne, wenn ich mal wieder etwas angestellt habe: Skateboardunfall. Mit dem Skateboard fremdes Eigentum beschädigt. Mit dem Skateboard auf den Gängen der Schule gefahren.
Sie sagt: »Ich erzähle dir nichts Neues, wenn ich sage, dass unser Geld knapp ist.«
Das tut sie tatsächlich nicht. Das ist ein alter Hut, und er wird oft als Einleitung verwendet, wenn ich mal wieder etwas kaputt gemacht habe, für das meine Mutter aufkommen muss. Ich krame im Gedächtnis, finde aber keine noch nicht besprochenen Ereignisse, für die eine solche Einleitung notwendig wäre.
»Dein Vater schickt auch nur gelegentlich Geld, das weißt du, oder?«
Das weiß ich. Seit ein paar Jahren schickt mein Vater Geld, aber eben nur gelegentlich, nur, wenn er es geschafft hat, irgendwo einen Job zu bekommen und ihn bis zum Zahltag durchzuhalten. Als ich klein war, sind meine Eltern aus Deutschland nach Montreal im kalten Kanada ausgewandert, wo mein Vater als Ingenieur für ein Projekt arbeiten sollte. Meine Mutter fand schnell Arbeit als Kindergärtnerin. Das Projekt meines Vaters fing irgendwie nie richtig an, was auch daran gelegen haben mag, dass der Winter damals außerordentlich kalt und die Firma seltsamerweise ausgerechnet darauf nicht vorbereitet war. Mein Vater hielt es noch ein paar Jahre mit uns aus, dann ging er fort, projektlos und frierend, um sein eigenes Ding zu machen.
Das alles zähle ich im Kopf auf und versuche, es mit Dingen zusammenzupuzzlen, die ich in letzter Zeit verbrochen haben könnte.
Meine Mutter sieht mich erwartungsvoll an. Die Situation wirkt auf eine ungeschickte Art feierlich, und ich sortiere einen Stapel MAD-Hefte auf dem Boden und bereite mich innerlich auf einen Schlag vor. Es war in letzter Zeit ziemlich ruhig, verdächtig ruhig, denn ich hatte die Hausaufgaben meistens rechtzeitig abschreiben können, was mir den größten Ärger ersparte, und weil ich mir im Herbst an einem der sonnigen Tage beim Skateboardfahren im Park zwei Rippen geprellt hatte, war ich einfach noch nicht voll auf der Höhe, um richtig etwas anzustellen. Umso verwirrender, dass ich ganz offenbar doch etwas falsch gemacht haben muss.
Meine Mutter sieht mir tief in die Augen und sagt: »Es tut mir leid, aber du musst dir einen Job suchen.«
Das muss ich für einen Augenblick verarbeiten. Meine Mutter, in Grabesstimmung, steht auf und sagt, dass wir am nächsten Morgen noch einmal darüber reden sollten, dann verabschiedet sie sich und schließt die Tür hinter sich.
Jetzt bin ich wach. Hellwach. Das ist das absolut Beste, was ich in den letzten Jahren von ihr gehört habe. Was für ein Gewinn. Ich bin im Geschäft. Ich bin dabei. Ein Job? Ein Job. Karriere. Raus aus der Schule, vielleicht, mittelfristig.
Ich werde Geld verdienen. Cash. Mein Ding machen. Mein eigenes Ding. Wie mein Vater. Ich werde Sonnenbrille tragen, zu jeder Tageszeit. Ich werde Mitschülerinnen zu McDonald’s ins Drive-in einladen. Okay, Moment, hasple ich mir die Gedanken zurecht, erst kommt das Auto, dann das Drive-in, bis dahin führe ich sie ins Restaurant aus, McNuggets, Cola, Sundae-Eis, aber ja!
Meine Mutter steckt noch einmal den Kopf zur Tür herein und sagt, dass ich darüber aber bitte nicht die Schule vernachlässigen soll. Da kann ich sie beruhigen: Weniger würde sowieso nicht gehen.
In der Nacht liege ich wach und stelle mir vor, richtig Geld zu haben. Zwei Dinge wollen gekauft werden: ein Auto, später. Ein neues Skateboard, jetzt.
Wenn du fünfzehn Jahre alt bist und keine Lust auf Schule hast und dich eigentlich nur draußen herumtreiben willst, dann kannst du dir nichts Besseres vorstellen, als dass viele, viele Dollarscheine direkt in deine Hand wandern. Und von dort gleich in kolossale Luxusgüter wie Nikes oder Starter-Jacken mit großen Team-Logos oder Eishockeytickets oder, oder, oder. Die Möglichkeiten sind vielleicht nicht endlos, aber doch massiv zahlreich – zumindest so zahlreich, dass ich fast die ganze Nacht lang wach liege und rätsele, was genau ich zuerst kaufen soll. Was eine gute Investition wäre.
Beim Frühstück fragt meine Mutter, ob ich es mir überlegt hätte.
Was überlegt?
Sie sagt, das mit dem Job sei eigentlich nur ein Vorschlag gewesen, sie hätte es einfach mal so ansprechen wollen, aber ich schüttele den Kopf, trinke schwachen Instant-Kaffee und knabbere an meinem Croissant – das leichte Frühstück des Achievers. Ich sage: »Warte mal ab. Ich mach das schon.« In meinen Aussagen bin ich vage, dennoch voller Versprechen. Das Vokabular eines zukünftigen CEOs. Viel versprechen, noch mehr liefern.
Ich sehe meine Mutter, wie sie in der sonnigen Küche sitzt und sich freut, dass unsere Lage doch nicht so schlimm ist, wie sie befürchtet hatte. Sie zieht einen Zettel unter dem Kühlschrankmagneten hervor und sagt: »Ich habe dir schon einen Kontakt hergestellt«, aber das bekomme ich gar nicht so richtig mit. Ich male mir irre Situationen aus: zum Beispiel, wie ich mir auf der Arbeit den Finger aus Versehen halb absäbele und den Schnitt von einem Kollegen – angerauchte Zigarette im Mundwinkel und zusammengekniffenen Augen – verarzten lasse, der das Ganze noch viel schlimmer macht – so, dass ich dann eben doch noch ins Krankenhaus muss, dreckverschmiert, stinkend, und die Krankenschwester sieht mich streng an, aber im Grunde ihres Herzens versteht sie, dass ich ein Draufgänger bin, der sich halb verblutet noch hinters Steuer seiner Corvette geklemmt hat, um in die Notaufnahme zu rollen.
»Hörst du mir zu?«, fragt meine Mutter. »Ich habe schon einen Job für dich. Madame Delachaux freut sich auf deinen Anruf.« Sie drückt mir einen Zettel mit einer Nummer in die Hand.
»Soll ich ihr was reparieren?« Ich habe keine Ahnung vom Reparieren, aber mein Vater hat damals seinen Werkzeugkoffer im Haus gelassen, und ich gehe davon aus, dass ich mich an der Rohrzange nicht als Volltrottel erweisen würde.
»Du sollst auf ihre Kinder aufpassen.«
Da ist er, der Schlag, auf den ich gestern Abend schon gewartet habe.
Es gibt Jobs, und es gibt Jobs. Babysitten ist weder das eine noch das andere. Nichts, bei dem man in der Corvette blutend in die Notaufnahme fährt, wie ich annehme. Hoffentlich.
»Du kannst anfangen, wann du willst«, sagt meine Mutter, als sie bereits in der Tür steht, um zur Arbeit zu gehen. »Aber es wäre gut, wenn es bald wäre.«
2 Young Money Cash Money Billionaire
Meine Mutter hat mir gesagt, dass ich mir gar keine Gedanken machen solle. Schließlich hätte ich Kindergärtner-DNS und sei deswegen nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen.
»Ich hätte lieber Rennfahrer- oder Börsenmakler-DNS«, entgegne ich.
»Ist dasselbe«, winkt meine Mutter ab und lächelt wissend. »Bedeutet auch nur, dass man einen kühlen Kopf behält.«
Es hat keinen Sinn, mit ihr zu reden, denke ich, während ich das Haus verlasse, und stapfe durch den Schnee ans Ende der Straße, wo Familie Delachaux ein großes Haus mit Doppelgarage und Säulen neben dem Eingang besitzt.
Madame Delachaux schlägt die Beine übereinander und hustet erst einmal ausgiebig. Dabei hält sie entschuldigend die Hand hoch. »Seit Jahren verbringe ich fast jeden zweiten Tag in der Eishalle, bei Juliens Eishockeyspielen.« Sie hustet erneut und steht auf, um sich ein Glas Wasser zu holen.
Mein erster Arbeitstag, denke ich unvermittelt, während ich Madame Delachaux auf ihrem Weg in die Küche beobachte. Sie sieht aus wie ein kranker Vogel. Dünn, hager, abgekämpft. Sie ist sehr groß, hat lange braune Haare. Sie sieht aus, als hätte sie seit Jahren keine Sonne mehr abbekommen. Wie sie da in die Küche schlenkert, scheint es, als könnte sie mit einem Mal einfach so in der Mitte durchbrechen.
Ich sehe mich ein bisschen um.
In dem großen Haus hängen Fotos über Fotos von ihr, ihrem Mann und den Kindern, auf die ich aufzupassen hätte, in allen Altersstufen. Ausschließlich Porträts vom Fachmann, mit diesem gruseligen Weichzeichnereffekt und dem unbestimmbaren Hintergrund, dessen Farbe ich in hundert Jahren nicht definieren könnte. Porträts einzeln, zu zweit, mal nur die Kinder, mal nur das Ehepaar Delachaux, mal alle zusammen. An den Wänden ist kein freier Platz mehr.
Madame Delachaux kommt zurück und starrt mich gedankenverloren an. Dann ruft sie die Kinder, als wären die ihr gerade wieder eingefallen. »Julien! Catherine! Isabelle!«
Drei Kinder kommen ins Wohnzimmer gerannt. Der Junge ist erst elf, bekomme ich erklärt, aber größer als ich, die Mädchen sind drei und sechs.
Mein erster Arbeitstag.
Madame Delachaux zieht den Mädchen die Winterstiefel an, legt ihnen Schals um, setzt die Mützen auf. Das dauert ziemlich lange und ist sehr langweilig. Ich tröste mich damit, dass ich hier gerade bezahlt werde. Das Babysitting-Taxameter läuft.
Dabei erklärt mir Madame Delachaux, dass ihr Mann als Berater arbeitet und fast nie da ist, dass sie seit drei Jahren – seit der Geburt von Catherine – nicht mehr aus dem Haus gekommen sei. Außer zu Juliens Eishockeyspielen. Und wenn man einmal einen Winter in den Eishallen von Montreal verbracht hat – sie sieht mich dramatisch an, weiß man, was das mit einem anstellt. Sie verdreht die Augen: »Du weißt ja selbst, wie es in so einer Eishalle riecht, und dann die feuchte, schweißnasse Ausrüstung und die Kälte …« Sie schüttelt den Kopf und verschränkt die Arme. »Bis in den Mai geht die Saison«, sagt sie, »bis tief in den Mai. Jedes Jahr.«
Ich stelle mir vor, wie die Frau in ihrem Wintermantel in der Eishalle steht, im permanenten Frost, eine heisere Frau, die sich über Schiedsrichterentscheidungen aufregt, während alle anderen in Shorts und T-Shirts lachend in Eiscafés sitzen. Die Königin eines kristallenen Imperiums, die November-bis-Mai-Gebieterin über Abseits und Zweilinienpass, eine durch einen unausgesprochenen Fluch in Montreals Eishallen Gebannte.
Und dann stehen wir zu viert im Garten. Julien, Catherine, Isabelle und ich. Es ist ein sonniger Novembertag, jede Menge Schnee ist gefallen und würde bis Anfang April liegen bleiben. Man kann eigentlich nicht viel machen außer Eishockey spielen. Ich bin völlig ratlos, was ich mit den drei Kindern anstellen soll. Niemand hat mir gesagt, was ich zu tun habe. Es gibt in diesem völlig leeren Garten auch nichts. Bis auf nackte Bäume. Und eben Schnee.
Die Mädchen fangen an, einen Schneemann zu bauen. Jedenfalls sieht es so aus, wie sie da eine Schneerolle vor sich her schubsen.
Julien baut sich vor mir auf. »Mein Vater hat letztes Jahr zweihunderttausend Dollar verdient. Nach Steuern. Was verdienst du hier?« Er steht mir gegenüber, Auge in Auge, und fragt sich vermutlich gerade, ob er mir eine reinhauen soll. Der Typ ist elf!
Als ich mich umdrehe, sehe ich, wie Madame Delachaux am Fenster sitzt und raucht. Wie ein Gespenst.
Ich könnte Julien zuerst eine reinhauen, was aber schlecht fürs Business wäre. Du kannst noch so viel Kindergärtner-DNS in dir haben, wenn du einen Elfjährigen schlägst, werden sich die Leute meistens als Erstes daran erinnern.
Außerdem, und das ist das andere, ist er sicher stärker als ich.
»Zehntausend Dollar«, sage ich. »Die Stunde.«
Julien sieht mich mit offenem Mund an.
»Deine Mutter will noch was drauflegen, wenn du zu viele Fragen stellst. Dafür muss sie dann bei deiner Eishockeyausrüstung sparen. Macht Sinn, oder?«
Julien bleibt noch ein bisschen in der Mitte des verschneiten Gartens stehen. Dann fängt er an, eine Schneemannkugel zu rollen.
Es entwickelt sich ein eigentlich ganz entspannter Nachmittag.
Madame Delachaux sitzt weiter am Fenster und raucht. Als die Sonne untergeht, ruft sie ihre Kinder herein. Ich gehe am Haus vorbei auf die Veranda, um mein Skateboard zu holen.
Madame Delachaux tritt aus dem Haus und lächelt. »Das hast du gut gemacht«, schnurrt sie, tatsächlich zufrieden mit mir. »Heute werden sie guuuuut schlafen.«
Ehrlich? Das war gut? Das war gut? Ich stand zwei Stunden im Schnee herum und habe nichts getan. Meine größte Leistung an diesem Nachmittag war es, nicht von einem Elfjährigen verprügelt zu werden – und das war gut? Ich kann es nicht fassen.
Die hagere Frau öffnet ihr Portemonnaie und raschelt ein paar Scheine heraus. »Ich rufe dich an. Ich brauche jemanden für Dienstagabend und für Freitagabend«, sagt sie und schließt die Tür hinter sich.
Julien winkt mir vom Fenster aus zu. Ich zeige ihm den Mittelfinger.
Ohne Eile gehe ich nach Hause. An meinem ersten Arbeitstag verstehe ich langsam, dass das Resultat zählt. Am Anfang des Nachmittags hatte Madame Delachaux drei Kinder, und jetzt hat sie immer noch drei Kinder, die außerdem richtig müde sind. Die guuuut schlafen werden, denke ich. Ihr Mann macht was mit Geld, das merkt man. Resultate. Da wird ganz anders gedacht.
Ich zähle mein Geld – zwanzig Dollar. Vor Steuern, sage ich zu mir selbst und frage mich, was das bedeutet. Das ist es also, was meine Mutter Tag für Tag bei der Arbeit macht. Zusehen, dass die Kinder nicht sterben. Langweilig, denke ich und laufe nach Hause.
In der Nacht liegen meine zwanzig easy verdienten Dollar auf meinem Nachttisch. Young Money Cash Money Billionaire. Ich liege daneben im Bett und überlege.
Es ist seltsam, weil das Resultat meines ersten Arbeitstages – zwanzig Dollar! – zwar großartig ist, der Weg dahin sich aber als unglaublich dröge, sogar unangenehm herausgestellt hat.
Es ist seltsam, weil das Gefühl von Cash in der Hand so unfassbar verlockend ist, aber die Person, die es überreicht, dabei stört.
Es ist seltsam, weil ich jetzt zwar Geld habe, aber es offenbar Menschen wie Juliens Vater gibt, die einfach noch viel mehr davon reinholen. Nur wie?
Ich bin mir nicht sicher, ob meine Mutter die beste Ansprechpartnerin für meine Fragen ist. Vielleicht, denke ich, ist Arbeiten wie Skateboardfahren: Du musst ein paarmal vor allen Leuten die Treppe runterfallen und dir die Rippen prellen, bevor du es draufhast. Vielleicht muss ich nur viel mehr ausprobieren, bevor die Schufterei sich richtig bezahlt macht.
Ich höre, wie es Morgen wird und die Räumfahrzeuge durch die Nachbarschaft fahren.
Eines werde ich von meinem ersten Arbeitstag auf jeden Fall mitnehmen: das Gefühl, in cash bezahlt zu werden. Kühle Dollarscheine in der Hand. Das schmirgelnde Gefühl bedruckten Papiers. Das und die triumphale Gewissheit, von einem Job nach Hause zu gehen, von dem ich weiß, dass ich ihn nie wieder machen werde.
3 Schneller, als er fällt
Auf dem Truck steht MSM, auf der Tür zum Büro steht MSM, auf der Winterjacke des Dicken hinter dem Schreibtisch ist auf Herzhöhe MSM gestickt, und nun streckt der Dicke selbst die Hand aus und keucht: »Ich bin Michel St. Michel, Michel St. Michel Junior, um genau zu sein. Setz dich.«
Michel St. Michel Junior räumt vielleicht nur den Schnee aus deiner Einfahrt, aber er hat ein intuitives Verständnis für Corporate Identity.
Gut, zugegeben: Es ist keine Kreativleistung, sich im Winter in Montreal zum Schneeschippen zu melden. 1) Es liegt Schnee, 2) ich kann nichts anderes, 3) ich werde nie wieder babysitten – fertig. Das ist die Liste, die ich neulich während des Matheunterrichts aufgestellt habe, als ich über meinen nächsten Job nachgedacht habe, ein bisschen Karriereplanung neben Algebra.
Doch erst einmal muss Michel St. Michel Junior davon überzeugt werden, dass ich für sein Schaufelunternehmen der richtige Mann bin.
»Wie alt, sagtest du, bist du?«
»Fünfzehn. Bald sechzehn.«
»Bald in drei Jahren? Sorry, Junge«, sagt er, »aber ich habe schon Kräftigere gesehen.«
Ich will ihm gerade von meinen Schaufelerfahrungen erzählen – seit ich denken kann, mache ich im Winter zu Hause den Weg von der Haustür bis zum Wagen frei, Morgen für Morgen –, als Michel St. Michel Junior sich zurücklehnt und eine Ecke oben im Büro anvisiert. »Eigentlich war ich ganz gut für den Winter aufgestellt. Aber dann haben wir ja François verloren …« Seine Stimme versagt, er schüttelt leicht den Kopf. Was soll ich dazu sagen?
MSM besinnt sich aufs Hier und Jetzt und sagt: »Kannst du morgen Früh zum Probearbeiten kommen?«
»Auf jeden Fall.«
»Schön. Dann sehen wir uns morgen um halb fünf. Schaffst du das?«
»Auf jeden Fall«, sage ich, bin aber gar nicht sicher, ob ich meinen Wecker so früh einstellen kann.
Ich bekomme eine dicke Jacke und ein fledderiges, zusammenkopiertes Handbuch, in dem MSM die Feinheiten des Schaufelns erklärt. Vorne drauf steht: »Schneeservice Michel St. Michel – wir schaufeln schneller, als er fällt«.
Im Dezember in Montreal um 4:30 Uhr aufzustehen bedeutet, dass es noch weitere fünf Stunden dunkel sein wird. 4:30 Uhr bedeutet, dass noch allertiefste Nacht ist. Ich laufe durch den Vorort, vorbei an der Tankstelle und dem Supermarkt, stapfe durch den Schnee, bis ich bei Schneeservice Michel St. Michel vor der Tür stehe.
»Hast du dir das Handbuch durchgelesen?«, fragt Junior.
»Von vorne bis hinten«, lüge ich.
MSM zeigt mir die Schaufeln und die Schneefräsen, die in der Garage stehen. Es gibt für alle Situationen unterschiedliche Gerätschaften. Er sagt tatsächlich »Situationen«, hat die Augen dabei weit aufgerissen, als würden sich einem unterwegs Schlangen und Terroristen und dreiköpfige Endgegner in den Weg stellen.
Ich sage: »Es ist ja nur Schnee, den ich wegschaufeln muss, oder?«
MSM sieht mich immer noch mit den großen Augen an. Dann geht er kopfschüttelnd zum Truck, als hätte noch nie jemand etwas so Respektloses zu ihm gesagt.
Irgendwie deprimiert es mich, dass wir erst einmal seine eigene Einfahrt freimachen müssen, bevor es losgehen kann.
Der Dicke legt los. Und wie. Er sagt: »Merk dir das: Wir schaufeln schneller, als er fällt. Sag das mal.«
»Wir schaufeln schneller, als er fällt«, intoniere ich.
MSM scheint zufrieden, denn er schaufelt einfach weiter.
Ich rechne nach: Bis zum Schulbeginn um 8:30 Uhr müssen wir dreißig Auffahrten freigemacht haben – und ich bin jetzt schon erschöpft von dem bisschen Kehren und Schippen in MSMs Einfahrt. Dieser verdammte Schnee ist schwer. Also frage ich: »Kommen eigentlich noch andere Angestellte?«
»Na ja«, sagt MSM leise, »da wir François verloren haben …« Seine Stimme fasert aus, er räuspert sich. »Aber es kommt noch jemand dazu«, sagt er verständnisvoll.
Ich muss einen ziemlich fertigen Eindruck machen.
»Sei froh, dass der Schnee nicht nass ist, sondern puderig. Das hier ist gar nichts«, lacht er, und ich merke, dass die erste Runde definitiv an MSM Junior geht. Nach Punkten. Eigentlich ist es auch fast gleich ein K. o. Denn es ist fünf Uhr am Morgen, und ich bin bereit, mich jetzt schon für den Rest des Tages ins Bett zu legen.
MSM klettert in den Truck, während ich die Schaufeln und Schippen auf die Ladefläche lege und helfe, die Fräse aufzuladen.
Und dann erscheint er. Der Superstar am Schaufelhimmel, der Nachwuchsgott aus dem eigenen Stall: der Sohn von MSM. Michel St. Michel III, steht vorne auf seiner Winterjacke. »Das wird ›der Dritte‹ ausgesprochen«, erklärt mir MSM. Dann nimmt er mich kurz beiseite: Damit alles kurz und knapp, reibungslos und ohne Verwirrung abläuft, soll ich ihn einfach Junior nennen.
»Ihren Sohn?«
»Nein, mich«, sagt Michel St. Michel beziehungsweise Junior, lacht ein zufriedenes Lachen und setzt sich in die Fahrerkabine, um einen ganzen Morgen lang schneller Schnee zu schaufeln, als er fällt.
Der Dritte kommt zu mir herübergelaufen. »Alles klar?«, fragt er, grinst verschlafen und setzt sich die Thermomütze auf, dann steigen wir ein.
Wir schleichen im Schritttempo über die dunkle Straße.
Junior hat auch gleich ein gutes Thema für die ersten Meter unterwegs: seinen Sohn. Der kann nämlich dies, der kann das, nächstes Jahr fährt er zum Jugendhockey runter nach Toronto, in ein spezielles Programm für Begabte, in eine Eishockey-Akademie, in der sie sogar Mathe fördern. »Was es alles gibt«, sagt Junior. Der Dritte sitzt neben mir und starrt auf den Boden.
Wir springen vor einer Einfahrt aus dem Fahrzeug, und ich fange an zu schaufeln – planlos. Es ist zu kalt, um nachzudenken. Außerdem will ich nichts mehr von begabten Kindern hören.
»So nicht«, höre ich Junior aus dem Truck rufen. Er greift sich an den Kopf: »Völlig falsche Schaufel! Handbuch, zweite Seite!« Mir ist das egal, schließlich geht es doch nur darum, Schnee wegzumachen. »Völlig falsche Schaufel für die Situation«, ruft Junior, und ich höre kurz auf, drehe mich um. Ich muss ihm ins Gesicht sehen. Ich muss unbedingt sehen, ob er es ernst meint.
Später sitzt Junior am Steuer des Trucks und lässt die Situation Revue passieren. Analysiert meine Schwächen beim Schaufeln und meine Laufwege, als wäre er der Coach eines Fußballteams. Wir kommen überein, dass ich für den Anfang bei meiner mitgebrachten Kernkompetenz bleiben soll: den Weg vom Haus des Kunden zur Einfahrt freischaufeln, während Junior mit dem Truck samt Räumschaufel fürs Grobe und der Dritte für die Details am Rand zuständig ist. »Wenn du gut bist, kannst du vielleicht auch einmal die Ränder übernehmen«, macht mir Junior mit ruhiger Stimme Mut.
So fahren wir durch den Vorort. Eine um die Uhrzeit zu der Jahreszeit absolut hoffnungslose Welt. Perma-verpenntes Suburbia. Hier passiert rein gar nichts. Die Leute brauchen eine freie Einfahrt, damit sie rechtzeitig zu ihren langweiligen Jobs kommen, die sie brauchen, damit sie sich ihr verschlafenes Leben im verschlafenen Vorort leisten können. Die müde Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Aber hier tut sie es bereits satt und vor dem Fernseher liegend.
Auch der frisch gefallene Schnee hilft nicht dabei, das Bild zu verschönern. Frisch gefallener Schnee ist nicht immer ein Zauber. Er kann sich auch anfühlen wie ein Kissen, das einem ins Gesicht gedrückt wird.
Haus Nummer zwei, es geht weiter. Wir treffen auf eine unvorhergesehene Situation: angefrorener, von der Kälte hartgebackener Schnee. Die Hausbesitzer waren im Urlaub, und MSM ist seit zwei Wochen nicht mehr hier gewesen, deswegen muss er kurz aus dem Truck springen und selbst ein paar Details übernehmen.
Ich sehe vom Hauseingang aus den beiden Michel St. Michels zu, wie sie fast synchron mit den Schaufeln gegen den Schnee wüten. Ein beeindruckendes Bild.
Dabei frage ich mich, wer wohl der erste Michel St. Michel war. Der Stammhalter. Das kann kein Mensch gewesen sein. Ich stelle mir vor, wie sich hoch im unbewohnbaren Norden Kanadas ein Elch und ein Eisbär in einem Tage dauernden Kampf miteinander gepaart haben. Dabei muss der erste MSM entstanden sein, das Original.
Ich schippe meinen Gehweg mit der korrekten Schaufel frei und mache, dass ich in den Truck komme, wo die beiden schon mit dampfendem Kaffee warten. Kaffee. Gute Idee.
»Hier«, sagt Junior. »Den hat meine Frau gekocht.« Er gießt mir was in seine Tasse ein, und ich nippe langsam und rieche den dicken Geruch von ehrlichem, öligem Arbeiterkaffee. Ein verdammter Bauchschuss ist das. Ein Stromschlag aus der Tasse.
»Da ist noch etwas«, sagt Junior und sieht mich prüfend vom Fahrersitz aus an: »Meine Frau, Madame St. Michel, ja? Die heißt mit Vornamen Michelle. Nur dass du das weißt. Wir sind da ein bisschen eigen«, sagt er und schickt mir einen ernsten Blick rüber.
»Alles klar«, sage ich. Mir doch egal. Ich habe diesen wunderbaren Kaffee im Bauch, trage definitiv die falschen Klamotten, weil meine Skiunterwäsche schon jetzt wie nassgeduscht ist, und bin mit zwei unbestimmbar Irren unterwegs, lange vor Sonnenaufgang. Nur noch achtundzwanzig Einfahrten, dann Schule. Namen sind in einem solchen Moment wirklich nicht entscheidend.
An einem Morgen will Junior mit mir reden, was bedeutet, dass ich noch früher da sein muss als sonst. Meine Mutter ist vor dem Fernseher eingeschlafen, und jetzt bekommt sie mit, wie ich schlaftrunken in aller Herrgottsfrühe durch die Wohnung stolpere. Sie gähnt und fragt, wie spät es ist, sieht mich aus einem Auge an. »Die Nummer von Madame Delachaux hast du noch? Ich meine ja nur. Für alle Fälle.«
Bei Junior im Büro riecht es nach Essen, wie immer. Der Mann sitzt an seinem Schreibtisch, wo er Listen von Häusern vor sich liegen hat und Touren zusammenstellt. Außerdem steht dort, mitten auf dem Tisch, ein altes Faxgerät, das er als Kopierer benutzt, weswegen im ganzen Raum verblichene Fetzen gerollten Thermopapiers hängen und für eine besonders traurige Atmosphäre sorgen.
Junior aber ist alles andere als traurig. »Große Neuigkeiten«, sagt er und schaufelt sich Bacon und Rührei in den Mund und spült das Essen mit ein bisschen Michelle-St.-Michel-Spezialkaffee runter. Die großen Neuigkeiten: Der Dritte hat das Angebot bekommen, ab sofort für irgendein Super-Team unten in Toronto zu spielen. Quasi morgen. Junior schaut mir tief in die Augen: »Könntest du dir vorstellen, das Ganze hier in Vollzeit zu machen?«
»Vollzeit?« Ich versuche, mir den Begriff auszumalen. »Also den ganzen Tag?«
»Den ganzen Tag.«
»Statt Schule?«
»Du bist doch schon fast sechzehn, oder? Da habe ich auch aufgehört.« Junior strahlt und breitet die Arme aus, zeigt auf die Thermopapier-Wände. »Und schau her, was aus mir geworden ist: Geschäftsmann!«
Später schaufle ich neben dem Dritten eine Einfahrt frei und sage: »Dein Vater will, dass ich Vollzeit bei euch arbeite.«
Der Dritte stützt sich auf seine Schaufel und guckt in den Haufen Schnee vor sich. Er überlegt, atmet langsam ein und aus, bläst kleine Atemwolken in den Morgen. Dann sagt er: »Mein Vater spinnt«, und schippt weiter.
Ich nicke. Das deckt sich in etwa mit der Einschätzung, zu der ich gekommen bin. Es ist aber immer sehr wertvoll, mal eine andere Meinung zu hören.
»Weißt du, was mein Vater im Sommer macht? Gar nichts. Der ist depressiv. Manchmal muss er in Behandlung. Dann isst er noch mehr, das sind die Nebenwirkungen von den Medikamenten, die er bekommt. Der fühlt sich nur im Winter wohl.«
Wir sehen dabei zu, wie Junior mit dem Truck die Einfahrt freiräumt. Er schaut zu uns herüber, lächelt und gibt uns das Daumen-hoch-Zeichen.
Der Dritte sagt: »Mann. Ich kann es überhaupt nicht erwarten, von hier wegzukommen.«
Ein interessantes Nebenprodukt meiner Arbeit bei Schneeservice Michel St. Michel: Ich finde neue Freunde. Damit meine ich nicht etwa Leute, die ich auf meinen Schaufelausflügen treffe, sondern Menschen aus meiner Klasse in der Schule, die ich schon seit Jahren kenne.
Die Sache ist die, dass meine Mutter und ich gerade das erleben, was sie »eine schwierige Zeit durchmachen« nennt. Die Bank hat meiner Mutter den Wagen weggenommen, und wir suchen eine Wohnung in der Stadt. Ich weiß, dass meine Mutter auf unser Häuschen im Vorort sehr stolz ist, und es tut mir leid, dass ich ihr nicht mehr dabei helfen kann, es zu halten. Sie besorgt stets frische Blumen, und jetzt sollen wir ausziehen, in irgendeine praktisch gelegene Bude an der Auffahrt zum Highway.
Ich mache keine Hausaufgaben mehr, weil ich mich gerade voll und ganz auf meine Karriere bei MSM konzentriere, die mich Ende Januar im tiefsten Winter ziemlich fordert. In der Schule kommen immer mehr Leute auf mich zu und fragen mich, ob ich hier oder da mitmachen will, und laden mich auf Partys ein, auf die ich vorher nicht eingeladen war. Eigentlich bin ich ein zutiefst unspektakulärer Typ, und das Ganze kommt mir mehr als seltsam vor. Ich frage meinen Freund Mark, was das soll.
Mark erklärt mir, dass ich interessant wirke, weil ich wie der Tod aussehe.
»Sehe ich so kaputt aus?«
»Du siehst schlimmer aus als die Jungs, die beim Shopping Center Klebstoff schnüffeln.«
Ich gehe erst mal auf Toilette und blicke lange prüfend in den Spiegel, merke, dass ich aussehe, wie ich mir einen Vierzigjährigen vorstelle. Tiefe Augenränder, unausgeschlafen, die Haare so verwuschelt, als wäre ich gerade aus dem Bett gestiegen. Die Arbeit bei MSM vor der Schule und der Umzug, den ich mit meiner Mutter nach der Schule vorbereiten muss, sind dafür verantwortlich, dass ich kaum noch meine acht Stunden Schlaf bekomme.
»Die denken, du hättest Kontakte zu Dealern«, sagt Mark. »Die denken alle, du könntest an alles rankommen. Außerdem lädst du die ganze Zeit Leute zu Cola und Eis ein. Du hast Cash in der Tasche.«
»Mann, ich schaufle doch nur Schnee. Schneller, als er fällt.«
»Willst du, dass sie das wissen?«
»Bist du verrückt? Auf gar keinen Fall.«
Ich lade die Leute noch öfter ein und versuche, noch kaputter auszusehen, was sich als schwierig herausstellt, mit ein paar extra Tassen von Michelle St. Michels Superkaffee dann aber machbar ist. Als Cristina aus dem Basketballteam mir eines Tages während der großen Pause auf die Jungstoilette folgt, nehme ich das einfach so hin. Warum sich groß wundern oder hinterfragen? Läuft doch alles gut.
Und das alles, weil ich etwas habe, wovon die anderen aus meiner Klasse im Vorort nicht einmal die geringste Vorstellung haben: einen richtig beschissenen Job.
Im März ist dann aber alles vorbei. Im März wird man in Montreal ein kleines bisschen geisteskrank, weil der Winter nicht locker lässt und einfach noch einmal einen Meter Schnee und Klirrkälte schickt, nachdem er bereits einen Sonnenstriptease veranstaltet hat.
Das ist nicht der einzige Grund, warum ich zu Junior ins Büro gehe, um ihm zu sagen, dass ich kündigen muss. Meine Mutter hat von der Schule einen Brief in die neue Wohnung am Stadtrand geschickt bekommen, in dem steht, dass meine Versetzung massiv gefährdet sei. Zudem stand da etwas von Verdacht auf Drogenkonsum, und meine Mutter musste in die Schule gehen und sich anhören, dass Lehrer mich als Dealer verdächtigen, und es dauerte ein paar Tage und einen erfolgreich absolvierten Urintest beim Hausarzt, bis ich meiner Mutter gegenüber den Verdacht ausräumen konnte. Wir kamen überein, dass ich den Job erst einmal aufgeben und mich auf die Versetzung in die zehnte Klasse konzentrieren sollte.
Vergnügt sitzt Junior vor seinem Faxgerät und isst ein Stück Kuchen. Es ist Nachmittag und schon wieder fast dunkel, am Morgen ist frischer Schnee gefallen. In einer Ecke des Büros sitzt ein ledriger Typ, sonnenverbrannt, der mir freundlich zunickt.





























