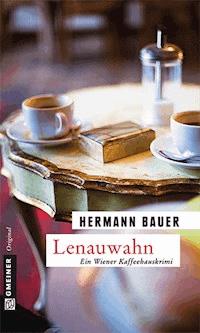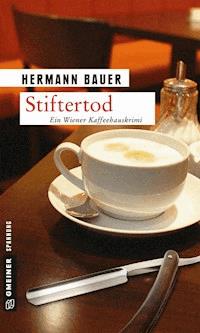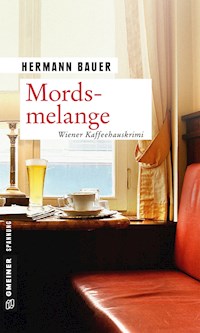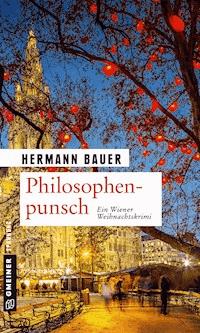Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Chefober Leopold W. Hofer
- Sprache: Deutsch
Fünf Abgänger des Floridsdorfer Gymnasiums treffen sich zu einem lustvollen Wochenende in einer abgelegenen ehemaligen Pension, um sich Abwechslung von ihrem Ehealltag zu verschaffen. Klara Gassner, als »Gast« eingeladen, wird nachts im Garten mit einem Stein erschlagen. Im Floridsdorfer Gymnasium wird gleichzeitig eine szenische Adaption von Schnitzler-Texten vorbereitet. Elisabeth Dorfer, die das Fräulein Else spielt, erhält obszöne Briefe. Chefober Leopold ermittelt in beiden Fällen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann Bauer
Schnitzlerlust
Ein Wiener Kaffeehauskrimi
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Altair de Bruin – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4460-9
Kapitel 1
»Wenn Treue nicht ein Gegengeschenk ist, dann ist sie die törichteste aller Verschwendungen.« (Schnitzler: Buch der Sprüche und Bedenken)
»Und? Klappt alles wie besprochen?«, erkundigte sich der groß gewachsene Mann mit dem kleinen Schnurrbart und den an den Schläfen schon leicht angegrauten Haaren. Dabei wischte er kurz mit einer Serviette über den Kaffeefleck auf seinem Mund.
»Aber natürlich, 100-prozentig«, beeilte sich Waldemar ›Waldi‹ Waldbauer, neben Leopold zweiter Oberkellner im traditionsreichen Floridsdorfer Café Heller, zu versichern. »Das Haus wird zwar nicht mehr offiziell als Pension geführt, aber das hat nichts zu bedeuten. Mein Freund Sebastian, dem es gehört, möchte sich das bloß einfach nicht mehr antun. Die ganze Arbeit nur für die Steuer, dann auch noch eine Kontrolle nach der anderen – Sie verstehen sicher, was ich meine. Sie können ruhig mit Ihren Freunden für ein paar Tage dort absteigen.«
»Wir brauchen nichts weiter als ein Badezimmer mit Dusche und warmem Wasser und frischgemachte Betten«, beruhigte ihn der angegraute Blonde.
»Das ist alles dort«, beteuerte Waldbauer. »Soviel ich weiß, gibt es in jedem Zimmer ein Bad mit Toilette und Dusche, auch einen Fernsehapparat – nichts Großartiges, alte Bildschirme, aber einige Sender kann man schon empfangen. Dann ist da noch eine Küche, wo man sich etwas zu essen machen kann, mit einem kleinen Aufenthaltsraum. Und Sebastian hat versprochen, genug fürs Frühstück in den Kühlschrank zu geben.«
»Na, dann ist ja alles in Ordnung.« Der Mann rieb sich die Hände. »Und der Preis?«
Waldbauer zögerte ein wenig. »Sie wissen ja, es muss alles extra hergerichtet und in Schuss gebracht werden. Sebastian hat gemeint, 50 Euro pro Person und Nacht …«
Der Blonde suchte nach seiner Brieftasche. »Überhaupt kein Problem. Macht bei je zwei Nächten für sechs Personen also genau 600 Euro. Das Haus ist etwas abgelegen, sagst du?«
»Man kann es gut mit dem Auto von der Brünner Straße oder mit der Straßenbahnlinie 31 erreichen, aber es handelt sich um eine ganz ruhige Wohngegend am Karl-Benz-Weg. Außerdem ist es ein schönes altes Haus mit dicken Mauern. Da sind Sie garantiert ungestört, Herr Emmerich.«
Emmerich blätterte sechs 100 Euro-Scheine auf den Tisch. »Bitte schön«, sagte er. »Da ist das Geld.« Er legte noch einmal 100 Euro dazu. Gleichzeitig äugte er misstrauisch in Richtung Theke, wo Frau Heller aufgetaucht war und einen kurzen Kontrollblick durch das Lokal warf. »Die sind für dich«, bemerkte er eine Spur leiser. »Aber eines ist wichtig, und darauf muss ich mich verlassen können: Diskretion! Verstehst du, Waldi? Absolute Diskretion! Unser kleines Wochenende im Haus von deinem Freund geht niemanden etwas an.«
Waldi Waldbauer deutete eine Verbeugung an. »Selbstverständlich«, bekräftigte er, während er rasch das Geld einsteckte. »Ich werde schweigen wie ein Grab, das gehört doch zu meinem Beruf. Aber eine Kleinigkeit wäre da noch, bitte schön. Mein Freund hat gemeint, wenn irgendwas ist … wenn was passiert … Bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch … Unter welchem Namen läuft denn das Ganze?«
Emmerich stand auf und nahm Waldi Waldbauer väterlich an der Schulter. »Was soll schon passieren?«, fragte er. »Ich habe dir jetzt alles bezahlt, eine nette Provision für dich mit eingeschlossen. Wir haben nicht vor, die ganze Bude kurz und klein zu schlagen. Wir wollen bloß unsere Ruhe. Da reicht es doch, dass du mich kennst, und dass ich der Herr Emmerich bin. Außerdem bringe ich dir am Montag die Schlüssel zurück.«
Waldi nickte untertänig und ein wenig hilflos.
»Ich habe dich also nicht überzeugt?«, hakte Emmerich nach. »Schade! Dabei habe ich bei der ganzen Sache extra darauf geschaut, dass du auch etwas davon hast. Und um den Preis gefeilscht habe ich auch nicht, obwohl ich woanders sicher ein billigeres Quartier finden würde. Was machen wir denn da nur?«
»Es ist nur wegen Sebastian … Er hat gesagt, dass …«, stotterte Waldi.
»Schon gut, schon gut.« Emmerich kritzelte hastig etwas auf einen Zettel. »Da hast du eine Telefonnummer«, brummte er. »Aber bitte nur in Ausnahmefällen anrufen, hörst du? Wir wollen nicht gestört werden.« Er blickte mahnend hinüber. Waldi steckte den Zettel ein und nickte abermals.
»Jetzt hast du alles, was du brauchst«, bemerkte Emmerich und zwinkerte Waldi dabei zu. »Die Schlüssel hole ich mir dann am Donnerstag, wie abgemacht. Und noch einmal: Die Sache ist streng vertraulich und erfordert äußerste Diskretion. Zu niemandem ein Wort, auf keinen Fall zu deinem lieben Kollegen Leopold. Wie neugierig der ist, brauche ich dir wohl nicht zu verraten, das weißt du ja selber. Ich wäre sehr enttäuscht von dir, wenn er etwas in Erfahrung bringen würde.«
»Da brauchen Sie überhaupt keine Angst zu haben«, beteuerte Waldi. »Ich werd doch dem Leopold nichts erzählen, da können Sie sich ganz auf mich verlassen.« Dann kassierte er von seinem Gast 6,60 Euro für ein kleines Bier und ein Schinkenbrot mit Gurkerln und Mayonnaise. Schließlich verabschiedete er sich mit einem beinahe schon vertraulichen »Also bis Donnerstag, Herr Emmerich.«
»Was haben S’ denn jetzt so lang mit dem g’sprochen?«, wollte Frau Heller wissen, kaum dass der Gast gegangen war.
»Nichts Besonderes«, antwortete Waldi beiläufig.
»Mich wundert, dass der Herr in letzter Zeit wieder öfters kommt«, teilte ihm Frau Heller mit. »Er war jahrelang bei uns abgängig. Bei dem müssen S’ aufpassen, dass er Sie nicht übers Ohr haut. Früher war er nämlich ein ganz schöner Filou.«
»Mich haut schon keiner übers Ohr«, gab Waldi im Brustton der Überzeugung von sich. Er wusste über den Gast zwar nicht mehr, als dass er Emmerich hieß und eine Zeit lang regelmäßig im Heller verkehrt hatte. Dazu kam jetzt noch der Zettel mit der Telefonnummer, das war alles. Aber was sollte schon passieren? Da wünschte jemand ein paar ruhige Zimmer für sich und seine Freunde am Wochenende, und er, Waldemar Waldbauer, kannte jemanden, der einen solchen Wunsch erfüllen konnte.
Nein, nein, man durfte gar nicht lang nachdenken und sich beirren lassen. Das bereitete nur Kopfzerbrechen. Draußen stand der Frühling in seiner schönsten Blüte, und die Sonne lachte durch die großen Fenster auf die Karten- und Billardtische. Da war gute Laune angesagt.
Und Hand aufs Herz: Wie oft schon hatte sich Leopold auf Geschäfte mit irgendeiner undurchsichtigen Kundschaft eingelassen. Da war es doch nur recht und billig, wenn auch Waldi einmal seine Beziehungen nutzen und sich ein kleines Taschengeld verdienen konnte. Für so etwas galt immer noch das schöne Wort Chancengleichheit. Also: Was sollte schon passieren?
Kapitel 2
»Hätte ich es vor einer Stunde für möglich gehalten, dass ich in einem solchen Falle überhaupt mir jemals einfallen lassen würde, eine Bedingung zu stellen? Und nun tue ich es doch. Ja, Else, man ist eben nur ein Mann, und es ist nicht meine Schuld, dass Sie so schön sind, Else.« (Schnitzler: Fräulein Else)
Frau Pohanka, die Sekretärin am Floridsdorfer Gymnasium, betrat das Lehrerzimmer in der 10-Uhr-Pause mit einem säuerlichen Lächeln. Das bedeutete nichts Gutes, im Gegenteil: Es drohte Gefahr. Denn wenn es darum ging, der Lehrerschaft positive Nachrichten zu überbringen, trat Direktor Marksteiner gern selbst auf den Plan und sonnte sich unter den allseits zufriedenen Gesichtern. Galt es allerdings, in einem Gespräch ein spezifisches, einzelne Lehrer betreffendes pädagogisches Problem zu behandeln, dann schickte er zunächst einmal seine Vorzimmerdame in den Kampf.
Wer schon lang genug an der Schule war, erahnte mitunter einen Hauch von Mitleid in Frau Pohankas suchendem Blick. Für alle anderen blieb ihre Miene aber ein versteinertes und ausdrucksloses Rätsel. Es war ja auch nicht wesentlich, was sie persönlich empfand. Ihre Aufgabe bestand lediglich darin, die betreffenden Personen rasch und ohne größeres Aufsehen in die Direktion zu bringen. Diesmal hatte sie schon nach wenigen Augenblicken Frau Professor Margarethe Vollnhofer ausfindig gemacht und zu sich gerufen. Die andere Lehrkraft, um die es ging, Herr Professor Thomas Korber, stand glücklicherweise genau vor ihr. Sie brauchte nur den Zeigefinger ihrer rechten Hand zu krümmen und ihn herbeizuwinken wie einst die böse Hexe im Märchen ›Hänsel und Gretel‹.
Korber verstand sofort. Wenn es ihn und Margarethe Vollnhofer traf, konnte es sich nur um ihr gemeinsames Projekt handeln, wobei der Begriff ›gemeinsam‹ eigentlich nicht stimmte. Direktor Marksteiner hatte ihm seine als sittenstreng bekannte Kollegin Vollnhofer vorsichtshalber zur Seite gestellt, weil er um die moralischen Auswirkungen bei dieser Sache fürchtete.
Das Thema des Projekts war nämlich das literarische Schaffen des großen österreichischen Dramatikers und Novellisten des Fin de Siècle und beginnenden 20. Jahrhunderts, Arthur Schnitzler, der in seinen Werken auch die durch das Werk Siegmund Freuds nun erstmals bekannten seelischen Tiefen der Menschen ansprach. Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 7A1 sollten sich mit Teilen seines Schaffens auseinandersetzen und Ausschnitte daraus – etwa aus dem ›Reigen‹, ›Leutnant Gustl‹, ›Fräulein Else‹, ›Liebelei‹ oder der ›Traumnovelle‹ – künstlerisch bearbeiten. Dafür erhielten sie alle nötigen Freiheiten. Ende Mai waren schließlich szenische Aufführungen in der Schulbibliothek und im Café Heller geplant.
Marksteiner empfing seine beiden Lehrer mit einem mürrischen »Ah, da sind Sie ja«, und wies ihnen einen Platz ihm gegenüber an. »Bitte setzen Sie sich doch. Nun, wie läuft das Projekt?«
»Gut«, reagierte Korber beinahe zu schnell. Er warf seiner Kollegin einen kurzen, Übereinstimmung suchenden Blick zu. Sie nickte nur stumm.
»Sie wissen, ich habe meine Einwilligung zu diesem durchaus interessanten und spannenden Versuch gegeben, obwohl ich Bedenken hatte«, fuhr Marksteiner fort. »Bedenken, Sitte und Anstand betreffend. Schnitzlers Texte sind ja, wenn ich das so sagen darf, einigermaßen frivol und erotisch. Er hatte schon zu seiner Zeit diesbezüglich Probleme mit den Behörden, sein ›Reigen‹, dessen kreisförmig angeordnete Szenen bloß eindeutige Dialoge vor und nach dem Geschlechtsverkehr darstellen, war ein Skandal. Und auch wenn wir mittlerweile im 21. Jahrhundert angelangt sind, beschäftigen Sie noch nicht ausgereifte Jugendliche damit, die das eine oder andere falsch verstehen können. Wir dürfen unsere Verantwortung nicht unterschätzen.«
»Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen«, reagierte Korber wieder zu rasch. »Die Schüler werden ja von uns betreut. Sie haben die einzelnen Stellen sehr bewusst ausgewählt und diskutieren in den Gruppen ernsthaft darüber. Schon nächste Woche werden die ersten Überarbeitungen fertig sein.«
Marksteiner war inzwischen aufgestanden und ging mit auf dem Rücken verschränkten Händen in der Direktion auf und ab. Das tat er immer, wenn er nervös war. Seine große, Ehrfurcht gebietende Gestalt war dabei leicht gebückt, und er setzte seine Schritte langsam und präzise. »Wirklich nicht?«, forschte er. »Der Schüler Josef Kern aus der 7A ist in der Mathematikstunde mit diesem Buch erwischt worden.«
Plötzlich hielt Marksteiner ein abgegriffenes Taschenbuch in seiner rechten Hand. Korber konnte den Titel des Bändchens deutlich lesen: ›Josefine Mutzenbacher. Die Geschichte einer wienerischen Dirne, von ihr selbst erzählt.‹ Diesen Klassiker der österreichischen pornografischen Literatur kannte er nur zu gut.
Er erschrak, doch nur kurz. Was sollte der Unfug? Was konnte er dafür, dass den Kern Pepi die Lebensbeichte einer Wiener Prostituierten aus der Zeit um 1900 mehr interessierte als die Formeln und Gleichungen von Professor Mann? Mathematik war ein sehr trockenes Fach, da konnte man es dem Pepi nicht verdenken, dass er zeitweise Sehnsucht nach saftigeren Inhalten hatte. Mann war leider ein viel zu verständnisloser Lehrer, um dafür ein Einsehen zu haben.
»Was hat denn das mit uns zu tun?«, wollte Korber wissen.
»Ganz einfach«, erklärte Marksteiner. »Ich habe die Schwierigkeiten aufgrund der Freizügigkeit der Schnitzler’schen Dichtung kommen gesehen. Natürlich habe ich gespürt, dass Sie mich wegen meiner Einwände für einen altvaterischen Sonderling halten. Ich kann mich noch genau daran erinnern, was Sie damals ins Treffen geführt haben: Schnitzler gehöre zur klassischen österreichischen Literatur, seine Schriften hätten bereits an die 100 Jahre oder sogar mehr auf dem Buckel. Der Fokus Ihres Projekts liege ja auf dem Seelenleben der einzelnen Figuren, der Kritik Schnitzlers an den damaligen gesellschaftlichen Verhältnissen und der nach wie vor bestehenden Aktualität seiner Themen. Und einzelne pikante Textstellen würden auf aufgeklärte Schüler von heute keinen Eindruck mehr machen.«
»Das stimmt ja auch«, rechtfertigte Korber sich. Seine Kollegin Vollnhofer zog es vor, weiterhin zu schweigen.
»Gar nichts stimmt«, versetzte Marksteiner gereizt. »Den Beweis halte ich hier in der Hand! Für manche ist Schnitzler offenbar nur die Einstiegsdroge. Sie wollen jede Unanständigkeit detailliert beschrieben sehen. Sie führen sich das Geschlechtsleben im alten Wien während des Unterrichts drastisch vor Augen. Wo bleibt da die pädagogische Betreuung, um die ich Sie in diesem Fall besonders gebeten habe? Ich frage Sie: wo?«
»Ist es wirklich so, dass Sie mich und meinen Unterricht für die spätpubertären Anwandlungen eines einzigen Schülers verantwortlich machen?«, fragte Korber provokant. Nach wie vor sah er nicht ein, warum Marksteiner um diese kleine Undiszipliniertheit so großes Aufsehen machte. Ihm selbst hatte die Mutzenbacher einst während langweiliger Schulstunden auch willkommene Abwechslung gebracht. Erwischen hatte er sich halt nicht lassen wie der etwas ungeschickte Kern Pepi. Außerdem lag sogenannte ›erotische Literatur‹ im Augenblick überall im Trend. Bücher wie ›Shades of Grey‹, ›Feuchtgebiete‹ oder ›Nacktbadestrand‹ standen in den Bestsellerlisten ganz weit oben. Jeder blätterte da hinein, um mitreden zu können. Verglichen mit solchen sterilen Machwerken hob sich die Lebensbeichte der Josefine Mutzenbacher schon allein vom historischen Ambiente her wohltuend ab.
»Nein, natürlich nicht«, kam es jetzt in gemäßigterem Ton von Marksteiner. »Ich weiß schon, dass solche Dinge eben vorkommen. Aber es spricht sich schnell herum und bringt Ihnen und Ihrem Projekt keinen guten Ruf ein. Sie wissen, was ich meine!« Dieser dezente Hinweis von Marksteiner deutete an, dass Korber am Floridsdorfer Gymnasium bekannt für seine diversen Pantscherln, einmal sogar mit einer Schülerin, war. Um Margarethe Vollnhofers Mund spielte ein Lächeln. »Lesen Sie also diesem Josef Kern einmal vor der ganzen Klasse ordentlich die Leviten und sagen Sie ihm, dass sich seine Eltern das Buch bei mir abholen können, wenn er Wert darauf legt, es wieder zu bekommen«, forderte Marksteiner Korber auf. »Damit ist die Sache hoffentlich erledigt. Etwas anderes bereitet mir weitaus mehr Kopfzerbrechen.«
Mit diesem Satz war Marksteiner leise geworden. Gefährlich leise. »Das ›Fräulein Else‹ steht bei Ihnen auch auf dem Programm?«, erkundigte er sich.
›Fräulein Else‹, das war die berühmte Erzählung Arthur Schnitzlers über ein junges Mädchen, das seinen verschuldeten Vater, der auch Geld unterschlagen hat, retten und vor einer Inhaftierung bewahren möchte. Der einzig mögliche Geldgeber, Herr von Dorsday, fordert von ihr, ihn als Gegenleistung für sein Eingreifen in seinem Hotelzimmer aufzusuchen und sich ihm eine Viertelstunde lang nackt zu zeigen. Sie willigt ein. Im entscheidenden Augenblick erleidet sie jedoch einen Nervenzusammenbruch und bringt sich mit Schlaftabletten um. Das alles wird in einer für die damalige Zeit revolutionären Technik erzählt: dem inneren Monolog. Alle Gedanken, Gefühle und Gemütseindrücke Elses werden in einem großen Bewusstseinsstrom in der Ich-Form wiedergegeben.
Korber wusste nicht, was sein Direktor jetzt von ihm wollte, er ahnte nur, dass es wieder nichts Gutes war. »Ja«, ließ er ihn deshalb nur knapp und vorsichtig wissen. »Die Schülerin Elisabeth Dorfer wird das machen. Sie wird das Ende der Erzählung vortragen. Wir werden sehen, was sie sich dazu hat einfallen lassen.«
»Ausziehen wird sie sich ja wohl nicht, oder?« Marksteiner verzog seinen Mund zu einem verkrampften Grinsen.
»Das werden wir unter keinen Umständen zulassen«, mischte sich Margarethe Vollnhofer in das Gespräch ein.
Typisch, jetzt kommt er mit Klischees aus der untersten Schublade, dachte Korber. Da hielt Marksteiner in jener Hand, in der sich vorhin noch die Josefine Mutzenbacher befunden hatte, plötzlich ein Kuvert, aus dem er ein Stück Papier zog. »Da, lesen Sie«, forderte er Korber auf.
Korber überflog den auf einem Computer geschriebenen Text. Margarethe Vollnhofer las begierig mit:
»Liebe Elisabeth!
Oder soll ich dich gleich Else nennen? Ich kann den Augenblick kaum mehr erwarten – du weißt schon! Den Augenblick, in dem du nackt vor mir stehen wirst, meinem Blick schutzlos ausgeliefert. Den Augenblick, in dem ich alles an dir betrachten kann, deine Brüste, deine Schambehaarung und noch vieles mehr. Ich freue mich schon darauf, wenn dein Gesicht erröten wird und du aus Verlegenheit versuchen wirst, deine Augen von mir abzuwenden. Aber habe Vertrauen zu mir. Es kann dir nichts geschehen, denn ich werde bei dir sein. Schon bald ist es so weit.
Dein dir noch unbekannter Freund.«
Korber war perplex. »Diesen Brief hat man …«
»… an Elisabeth Dorfer geschickt, jawohl!«, beendete Marksteiner den Satz. »Abgestempelt bei uns auf dem Postamt Floridsdorf. Na, was sagen Sie dazu?«
»Vielleicht ist es der dumme Streich eines Klassenkollegen«, mutmaßte Margarethe Vollnhofer.
»Das glaube ich nicht«, widersprach Korber. »Der Brief enthält keinen einzigen Fehler. Das wäre bei einem Schüler schon eine kleine Sensation. Und dann Stil und Wortwahl. Sieht ganz nach einem erwachsenen Absender aus. Ein Perverser?«
»Wie auch immer, wir müssen die Sache ernst nehmen, sehr ernst sogar«, erklärte Marksteiner. »Elisabeths Eltern waren gerade hier und möchten unter allen Umständen, dass sich ihre Tochter aus dem Projekt zurückzieht. Das hieße dann auch, dass sie bei den Aufführungen nicht mitmacht. Nur zu verständlich! Trotzdem wollte ich auch Sie um Ihre Meinung fragen.«
»Was sagt denn Elisabeth selbst dazu?«, wollte Korber wissen.
»Das entzieht sich leider meiner Kenntnis«, antwortete Marksteiner ausweichend. »Ich habe noch nicht persönlich mit dem Mädchen gesprochen. Die Eltern meinen, sie sei nach wie vor geschockt.«
Es war doch stets dasselbe. Aufgebrachte Eltern, ein besorgter Direktor – da kam logischerweise eine erst am Schluss zu Wort, nämlich die Betroffene selbst. Warum liefen die Dinge bloß so?
»Wir müssen sie entscheiden lassen«, legte sich Korber fest.
»Und wenn etwas passiert, was dann?«
»Passieren kann immer etwas, ob sie nun mitspielt oder nicht. Wenn es jemand auf sie abgesehen hat, wird er sich durch solche Maßnahmen nicht abschrecken lassen. Und wenn es nur ein Störenfried ist, der ihren Auftritt mit allen Mitteln verhindern möchte, tun wir genau das, was er will. Für Elisabeth wäre es der absolute Höhepunkt des Schuljahres. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie trotz allem nicht freiwillig darauf verzichten wird.«
»Sie würde sich ausgeschlossen fühlen. Wir können ihr nicht einfach mir nichts, dir nichts die Teilnahme verbieten, nur weil ein Verrückter diesen Brief geschrieben hat«, bekam Korber jetzt die unerwartete Unterstützung von Margarethe Vollnhofer. »Das wäre pädagogisch äußerst bedenklich.«
Bravo, die Kollegin zeigt ja doch menschliche Züge, befand Korber anerkennend. »Ist die Polizei verständigt worden?«, wollte er von Marksteiner wissen.
Marksteiner schüttelte den Kopf. »Der Brief ist gestern gekommen. Elisabeths Eltern wollten zuerst mit mir sprechen und wissen, ob irgendein Schüler als Absender infrage kommen könnte. Bis jetzt deutet nichts darauf hin. Sie haben also auch keine Erklärung dafür?«
»Nein! Darum würde ich gerne Inspektor Bollek bitten, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Er könnte diskrete Nachforschungen anstellen. Sie kennen ihn ja bereits2«, überlegte Korber.
»Der Polizist, der damals einige Schüler wegen der Vorgänge am Jedleseer Friedhof befragt hat? Warum nicht«, zeigte sich Marksteiner einverstanden. »Wir bräuchten uns nichts vorzuwerfen, und vielleicht führt es uns auch auf eine heiße Spur. Reden Sie also mit ihm, ich bitte Sie darum.«
»Dürfte ich dazu vielleicht den Brief haben? Ist es das Original?«
»Wie bitte? Ja natürlich! Da, nehmen Sie!« Marksteiner überreichte Korber das Schriftstück. »Und sprechen Sie mit Elisabeth Dorfer. Ich möchte möglichst rasch Klarheit haben, wie es mit dem Projekt weitergeht. Wenn sie immer noch mitmachen möchte, von mir aus. Aber keine Überredungstricks, haben Sie mich verstanden?«
»Ja, Herr Direktor. Danke schön!« Ein entspanntes Lächeln spielte um Korbers Lippen, als er sich von Marksteiner verabschiedete. Mittlerweile kannte er seinen Chef genau. Zunächst wirkte er streng und übervorsichtig, letztendlich war er aber immer verständnisvoll und offen für die Wünsche und Maßnahmen seiner Lehrer. Er polterte, gab dann aber auch gerne nach, wie der Vater einer großen Familie.
Draußen auf dem Gang bedankte sich Korber bei seiner Kollegin. »Ich habe mich für die Schülerin deswegen eingesetzt, weil ich sie und ihren Eifer sehr schätze«, gab ihm Margarethe Vollnhofer zu verstehen. »Es hat absolut nichts damit zu tun, was ich von Ihnen und diesem fragwürdigen Projekt halte.«
*
»Natürlich musstest du mit dem Brief gleich zu deinem Inspektor Bollek laufen«, ärgerte Leopold sich. »An mich hast du dabei überhaupt nicht gedacht. Du traust mir wohl nicht zu, dass ich in dieser heiklen Geschichte Erfolg habe.«
Korber gönnte sich nach dem aufregenden Vormittag, den er mit einem Kurzbesuch bei seinem Freund im Polizeikommissariat abgeschlossen hatte, ein Bier an der Theke des Café Heller. Dabei sah er Leopold eher belustigt zu, wie der sich echauffierte, und blies kleine Rauchwölkchen aus seiner Zigarette in die Luft. »Es geht gar nicht darum, was ich dir zutraue«, erklärte er ihm. »Für mich zählt, dass du eine feste Beziehung eingegangen bist und deiner Freundin Erika versprochen hast, einen Großteil deiner spärlichen Freizeit mit ihr zu verbringen. Oder hast du es dir schon wieder anders überlegt?«
»Nein, natürlich nicht«, antwortete Leopold knapp. Dabei stellte er fein säuberlich eine Melange auf das kleine Silbertablett, gab ein Glas Wasser dazu und legte den Kaffeelöffel darauf. Er musste zugeben, dass Korber im Recht war. Er hatte jetzt eine Freundin, die ihn brauchte, und um die er sich kümmern musste. Da konnte er nicht mehr so wie früher kriminalistische Nachforschungen betreiben, wenn sich etwas Seltsames oder gar ein Verbrechen ereignete. Das würde nur seinem Glück schaden. Er wusste selbst nicht, warum er immer wieder darauf vergaß.
Ich bin glücklich, dachte er, während er die Melange nach hinten zu Frau Fürthaler trug. Ja, Leopold war in der Tat glücklich. Es gab jetzt jemanden, der ihn vom Kaffeehaus abholte oder auf ihn wartete, wenn er spät nach Hause kam. Es gab jemanden, der ihn liebevoll ›Schnucki‹ nannte. Es gab eine Frau, mit der er großen Spaß im Bett hatte, und mit der ihm auch sonst nie langweilig wurde. Diese Frau hieß Erika Haller. Ihr gehörte eine Papeterie, in die Leopold oft auf Besuch kam, wenn er mittags Dienstschluss hatte, und wo er die Kunden dann mit seinem Schmäh unterhielt. Erika kochte auch vorzüglich. Und manchmal, wenn er sie beinahe einen ganzen Tag nicht zu sehen bekam, ging sie ihm richtiggehend ab.
Leopold war mehr als glücklich. Nur dass er diesem Glück Opfer bringen musste, ärgerte ihn. Es ärgerte ihn sogar sehr. Gerade jetzt beispielsweise hätte er gerne in Erfahrung gebracht, wer einer jungen Schülerin die frivolen Zeilen geschrieben hatte.
»Trotzdem sage ich dir, dass ich da eher was herausfinde als Bollek«, wandte er sich deshalb gleich wieder an Korber, als er an die Theke zurückkam.
»Mag sein. Es geht aber auch um das Gefühl des persönlichen Schutzes für das Mädchen. Den kannst du ihr nicht bieten. Hauptsache, sie macht weiterhin bei dem Projekt mit«, meldete Korber erleichtert.
»Freut mich außerordentlich«, gab Leopold beleidigt von sich.
»Sie war zwar immer noch ein bisschen durcheinander, als die Kollegin Vollnhofer und ich sie gefragt haben, aber sie scheint die richtige Einstellung zu haben: Jetzt erst recht, und das ist gut so!«
»Na bitte!«
»Quengle nicht! Denk lieber an deine Erika! Du solltest dich freuen, dass du noch eine wie sie gefunden hast. So selbstverständlich ist das in deinem Alter nämlich nicht.«
»Ich habe mich wohl verhört«, ätzte Leopold.
»Wieso verhört? Ich bin um einiges jünger als du, und bei mir hat es auch lange gedauert, bis sich die Liebe eingestellt hat«, gab Korber zu bedenken.
Er machte einen genüsslichen Schluck von seinem Bier und führte eine weitere Zigarette zum Mund. Dabei dachte er nach, ob er sich glücklich fühlte. Ja natürlich, Korber war in der Tat glücklich. Warum denn auch nicht? Sein Schnitzler-Projekt lief nun wieder nach Plan. Der Frühling tat ihm gut, er spürte ihn in jeder Faser seines Körpers und war voll Energie. Und schließlich war er, trotz aller Schwierigkeiten, schon länger mit seiner Geli zusammen, als er sich anfangs hätte träumen lassen. Er war sogar schon sehr lange mit ihr zusammen. Zu lange?
»Liebe schön und gut. In eine gemeinsame Wohnung zieht ihr ja weiterhin nicht«, schreckte ihn Leopold aus seinen Gedanken.
»Das ist eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit. Man muss nichts überstürzen«, verteidigte Korber sich. »Es funktioniert ja vorläufig auch so.«
Bei diesem Satz gab es ihm einen leichten Stich. Er stimmte, aber leider stimmte er nicht ganz. Eigentlich handelte es sich um eine Kleinigkeit, um etwas, das schon einmal vorkommen durfte. Dennoch überschattete es seine gesamten Glücksüberlegungen. Am vorigen Sonntag war es gewesen. Er war mit Geli entlang des Marchfeldkanals spazieren gegangen, hatte den warmen Nachmittag genossen. Danach, in Korbers Wohnung, war es relativ rasch zum Liebesspiel gekommen. Plötzlich, mitten im Geschlechtsakt, hatte Korber dann gemerkt, wie seine Begierde nachließ. Er hatte Geli zum Höhepunkt gebracht, ohne dabei selbst große Lust zu verspüren. Es war eine sehr mühsame Prozedur gewesen. Natürlich fragte er sich, wie so etwas hatte passieren können. Die Antwort, die er fand, verblüffte ihn und war einleuchtend zugleich: Sie waren vielleicht tatsächlich schon zu lange miteinander liiert. Dass sie sich mittlerweile in- und auswendig kannten, zeitigte seine ersten fatalen Auswirkungen auf dem Gebiet der Sexualität.
»Über kurz oder lang kommst du ihr nicht aus«, hörte Korber in der Zwischenzeit Leopold laut nachdenken. »So haben wir beide das gefunden, was unserem Leben einen Sinn gibt. Wir gehen einer hoffnungsvollen Zukunft entgegen.«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, kam sofort Korbers Replik. »Ich liebe Geli zwar, und ich kann mir auch immer besser vorstellen, mit ihr zusammenzuleben. Davor habe ich überhaupt keine Angst mehr, das kannst du mir glauben. Eine Familie gründen, den Abend solide zu Hause verbringen, ein kleines Kind heranwachsen sehen – alles schöne Dinge, auf die ich mich freue.«
»Wo liegt denn dann diesmal das Problem?«, forschte Leopold, der die schwankende Gemütsverfassung seines Freundes bereits ausreichend kannte.
»Unsere Gesellschaft vertritt die unsinnige Auffassung, dass alles auf immer und ewig sein soll«, holte Korber aus. »Das heißt, man hat, sobald man gebunden ist, in der Liebe für die Zukunft überhaupt keine Aussichten mehr, außer natürlich es wird eine total verbockte Lebensgemeinschaft und man lässt sich deshalb scheiden. Aber das will ja keiner. Eine Beziehung auf Zeit, eine sogenannte Lebensabschnittspartnerschaft, würde einem da mehr Möglichkeiten eröffnen und unserer modernen Zeit eher entsprechen.«
»Wie viele Tage würde so ein Lebensabschnitt bei dir denn dauern?«, erkundigte sich Leopold eher belustigt.
»Mit dir kann man über so ein ernstes Thema einfach nicht normal reden, jetzt noch weniger als früher. Es geht einzig und allein darum, dass man nicht zum Gefangenen einer Beziehung wird. Wenn einem jemand anders gefällt und man sich ein bisschen mit diesem Menschen einlässt, heißt es gleich, man hat seinen Partner betrogen. Welch hässliches Wort!«
»Als was würdest du es denn bezeichnen?«
»Das ist jetzt unerheblich. Was mich stört, ist diese kleinbürgerliche Einstellung«, ereiferte Korber sich. »Selbst wenn man wirklich vorhat, für den Rest seines Lebens mit einem Menschen in Liebe zusammenzubleiben, hat doch jeder, ich betone jeder, egal welchen Geschlechts, das Bedürfnis nach ein wenig Abwechslung. Machen wir uns nichts vor! Irgendwann weiß etwa ein Mann zur Genüge, wie die Zunge der Partnerin schmeckt, wie sie mit ihrem Hintern wackelt, wie ihre Brüste aussehen, und was ihn zwischen ihren Beinen erwartet. Dass man da auch wieder einmal Sehnsucht nach etwas anderem bekommt, ist nur zu natürlich.«
»Weißt du, dass du ganz schön vulgär wirst?«, machte Leopold seinen Freund aufmerksam. »Ich glaube, das Bier wirkt schon.«
»Ach was, du willst es nur nicht wahrhaben. Jetzt bist du noch frisch verliebt. Warten wir einmal ab, wie du in ein oder zwei Jahren redest.«
»Und was würdest du sagen, wenn deine Geli ähnliche Gedanken hegt?«, fragte Leopold irritiert.
»Ich würde es verstehen«, erklärte Korber, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt. »Es kommt sicher der Moment, wo es sie nicht mehr sonderlich aufregt, was sie zu sehen bekommt, wenn sie mir die Hose aufknöpft. Dann wird sie sich von anderen Männern angezogen fühlen, weil sie vermutet, dass dort ein bisschen mehr vorhanden ist. Und ein knackiger Popo gefällt den Frauen auch ganz gut, habe ich mir sagen lassen.«
»Ja aber wenn sie dann wirklich zur Tat schreitet?«
Korber zuckte mit den Achseln. »Dann ist es einfach so. Obwohl ich denke, dass ich mir in dieser Hinsicht bei Geli keine allzu großen Sorgen zu machen brauche. Sie ist eher anhänglich und nicht auf große Abenteuer aus. Fast möchte ich sagen leider, weil ich dadurch natürlich ein schlechtes Gewissen habe, sollte ich einmal eine andere Frau ansprechen, die mir gefällt.«
Leopold betrachtete den kleinen Möchtegerncasanova ihm gegenüber genauer. Wenn er so an der Theke lehnte und die Augen verdrehte, während er das Bier in sich hineinrinnen ließ, konnte man sich gut vorstellen, was er gerade dachte. Und es waren sicher keine schönen Gedanken. Früher einmal, da hatte man Korbers Eskapaden noch einer gewissen Unbeholfenheit zuschreiben können. Aber jetzt hatte Leopold den Eindruck, dass er berechnend geworden war. Was er da beinahe revolutionär von freier Liebe hinausposaunte, war natürlich alles Blödsinn. Er dachte nach, wie er sich das holen konnte, was er wollte. Er überlegte im Detail, wie er zu einem genussvollen Seitensprung kommen konnte, ohne sich vor Geli dafür rechtfertigen zu müssen. Dabei fühlte er sich moralisch auch noch im Recht. Leopold sah in seinem Freund einen dieser dekadenten und geilen Typen aus den Dramen und Erzählungen Schnitzlers, die er jetzt mit seinen Schülern einstudierte.
Er selbst kannte solche Verlockungen nicht. Die einzige Untreue Erika gegenüber, nach der er sich sehnte, war es, wieder einmal einen Kriminalfall zu lösen, ohne auf sie Rücksicht nehmen zu müssen. Natürlich reizte ihn der anzügliche Brief an Elisabeth Dorfer, von dem er durch Korber erfahren hatte. Er bot sozusagen die Möglichkeit eines kleinen Trainings zwischendurch. Aber was würde seine Erika bloß dazu sagen?
Korber legte das Geld für sein Bier auf die Theke und machte sich zum Gehen bereit. »Mach bitte in nächster Zeit keinen Unfug«, ermahnte Leopold ihn.
»Wo denkst du hin?«, erwiderte Korber. »Ich werde doch die Idylle meiner Beziehung zu Geli nicht aufs Spiel setzen. Außerdem kommt sie heute Abend mit zwei Arbeitskollegen zu einem Spieleabend. Du siehst also, es ist alles bestens. Aber lass mir doch die Möglichkeit, zumindest in Gedanken ein wenig fremdzugehen.«
»Ob du es glaubst oder nicht, das ist Gift«, beschwor Leopold ihn mit ernster Miene.
»Wer behauptet so etwas schon außer dir?«
»Die Statistik«, antwortete Leopold kühl. »Bei den Gedanken allein bleibt es ja nicht. Und von da an wird die Angelegenheit hochexplosiv. Denn Untreue, in welcher Form auch immer, ist nun einmal einer der häufigsten Gründe für ein kapitales Verbrechen!«
*
Korber hörte nur mehr mit halbem Ohr hin. Als er das Heller verließ, spürte er ein Verlangen nach Freiheit und Abwechslung. Er bog um die Ecke, als plötzlich ein weibliches Wesen vor ihm stand, das er von früher her kannte. »Ja Sophie! Das ist aber eine Überraschung«, rief er aus.
Sophie Kuril war zwar schon ein wenig über ihre besten Jahre hinaus, aber immer noch ungeheuer attraktiv. Ihr leicht gewelltes brünettes, von ein paar grauen Strähnen durchzogenes Haar umspielte locker ihre Stirn. Das Gesicht mit der schmalen Brille wirkte streng und ein wenig unsicher, doch wenn sie ihren Mund zu einem Lächeln verzog, änderte sich das sofort. Der mittelgroße, sportliche Körper steckte in einem eleganten schwarzen Lederanzug. Sie hatte sich, wie es schien, ein wenig herausgemacht. Mit ihrer rechten Hand rollte sie eine kleine Reisetasche hinter sich her.
»Thomas, nein so etwas«, gab sie zurück. »Jetzt hätte ich beinahe gefragt, was du da machst, aber du unterrichtest ja hier am Gymnasium.«
Sophie Kuril und Thomas Korber waren einander im Vorjahr bei einem Englischseminar begegnet. Sie hatten sich sofort sympathisch gefunden, Telefonnummern und E-Mail-Adressen ausgetauscht und vereinbart, einander möglichst bald wieder zu treffen. Wie es bei solchen Gelegenheiten meist der Fall ist, wurde nichts daraus. Es blieb beim Wollen. Das eine oder andere Mal dachte man vielleicht daran, anzurufen oder kurz ein paar Zeilen zu schreiben, dann aber tat der Alltag sein Übriges, und die Sache geriet in Vergessenheit. Umso überraschter waren beide jetzt ob dieser zufälligen Begegnung.
»Und was tust du da?«, wollte Korber wissen.
»Ich unterrichte zwar nicht hier, aber ich bin da auch einmal zur Schule gegangen«, antwortete Sophie.
»Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen«, erinnerte Korber sich. Dann hatte er eine Idee. »Möchtest du vielleicht sehen, wie die Schule jetzt ausschaut? Wir könnten beide einen kurzen Blick hineinwerfen«, schlug er vor.
»Ein andermal«, lehnte Sophie dankend ab. »Eigentlich war ich nur neugierig, ob es das Café Heller noch gibt. Da haben wir nämlich an manchen Vormittagen mehr Zeit verbracht als in der Schule. Wir haben ganz schön gestagelt damals.«
»Dann gehen wir doch hinein und trinken einen Kaffee!« Korber hatte nicht im Sinn, diese zufällige Begegnung gleich wieder enden zu lassen.
Sophie errötete leicht und schüttelte den Kopf. »Tut mir schrecklich leid, es geht nicht«, gestand sie. »Ich sollte eigentlich schon wieder ganz woanders sein. Ich wollte nur einen Sprung vorbeimachen und durch die Fenster gucken. Das habe ich jetzt ja gemacht.«
Korber bemerkte die Reisetasche. »Du fährst fort?«, fragte er.
»Im Gegenteil, ich komme quasi an«, antwortete sie vorsichtig. »Ich muss … Es ist wegen der Schule, verstehst du? Ich treffe mich mit ein paar Kollegen. Es wird ein richtiges Arbeitswochenende.«
Korber lächelte wissend. »Die neue zentrale Reifeprüfung, stimmt’s? Die lässt uns ja überhaupt keine Ruhe. Andererseits: So dringend kann das nicht sein. Ein paar Minuten könntest du mir wenigstens schenken. Schließlich haben wir uns lange nicht gesehen.«
Wiederum schüttelte sie den Kopf, diesmal entschiedener. »Wir mailen uns, ja? Wie wir uns das damals vorgenommen haben. Dann habe ich sicher einmal Zeit für dich.«
Unbewusst hatten beide begonnen, in Richtung Bahnhof zu gehen. »Wo musst du überhaupt hin?«, erkundigte er sich.
Sophie war das alles offensichtlich gar nicht recht. Nur widerwillig erteilte sie Auskunft: »Ich fahre mit der Straßenbahnlinie 31 bis zur Haltestelle Hanreitergasse, dann biege ich in den Karl-Benz-Weg hinein. Es sollte leicht zu finden sein. Ich hoffe es zumindest.«
Korber war gleich wieder Feuer und Flamme. »Das ist ja wunderbar«, freute er sich. »Es ist ganz in der Nähe meiner Wohnung, nur auf der anderen Seite der Brünner Straße. Gemeinsam finden wir es sicher.«
»Meinst du?« Sophie Kuril fühlte sich immer weniger wohl in ihrer Haut. Am liebsten wäre sie Korber rasch wieder losgeworden, aber der ließ sich jetzt nicht abschütteln, im Gegenteil: Je einsilbiger sie wurde, desto entschiedener machte er sich an sie heran. Auch in der Straßenbahn störte es ihn nicht, dass sie wortkarg blieb. Er wollte wissen, wohin sie ging. Gerade das zu verhindern, war offenbar ihre Absicht. Doch es nützte nichts. Als sie ausstiegen, heftete er sich an ihre Fersen.
»Hör mal, ich finde schon allein hin, ich brauche dich nicht dazu«, teilte sie ihm mit. »Was sollen meine Kollegen denken, wenn ich mit dir antanze?«
»Dass ich auch eine Art Kollege bin.«
»Nein! Du wirst jetzt gehen, verstehst du? Du hast hier nichts verloren«, wurde sie beinahe grob.
»Ich komme ja nur bis zum Eingang mit«, bettelte Korber.
»Das ist nicht möglich. Du würdest mir nur schaden. Vielleicht erkläre ich es dir später einmal. Du kannst mir, wie gesagt, nächste Woche eine Mail schreiben. Aber jetzt lass mich einfach allein, okay?«
Sophie warf ihm eine Kusshand zu und beschleunigte dann ihren Schritt, als hätte sie Angst, er würde ihr weiter nachlaufen. Etwas entfernt in der schmalen Gasse sah Korber ein Auto und Leute darum herum. Sophie winkte, die anderen winkten zurück. Offenbar war sie bei ihren Freunden und Kollegen angekommen. Die Tore zu dieser Welt blieben für Korber verschlossen.
Vielleicht war es besser so. Andererseits – wie oft brachte der Zufall eine liebe Bekannte ganz in seine Nähe? Er warf einen letzten sentimentalen Blick auf Sophie. Da fiel es ihm plötzlich ein: Das Haus, in das sie jetzt mit ihren Kollegen ging, war doch die ehemalige Pension Vogelsang, viele Jahre hindurch ein günstiges, wenn auch ein wenig abseits gelegenes Quartier für Wienbesucher aus den Bundesländern oder aus dem Ausland. Dann war die Zahl der Nächtigungen allmählich aber stetig gesunken. Niemand wusste so richtig, woran es lag: an der schlechten Anbindung zum Stadtzentrum, der nicht gerade überragenden Infrastruktur oder der Renovierungsbedürftigkeit des Hauses. Der Besitzer mit dem bezeichnenden Namen Sebastian Fink hatte die Pension jedenfalls kurzerhand geschlossen. Da das Haus nach wie vor ihm gehörte, vermutete Korber, dass er es hie und da für ein kleines Entgelt zur Verfügung stellte – unter der Hand natürlich. Jetzt eben dieser Gruppe um Sophie Kuril.
Er konnte sich nicht helfen, irgendetwas an der Sache kam ihm komisch vor. Sophie war so kurz angebunden und beinahe unfreundlich gewesen. Natürlich hatte er sich recht aufdringlich verhalten, dennoch kannte er sie anders, aufgeschlossener und mitteilsamer. Er hatte sogar damals bei dem Englischseminar den Eindruck gehabt, sie wären sich menschlich recht nahegekommen. Irgendetwas machte sie nervös, aber was? Das Arbeitswochenende wohl kaum. Oder doch?
Korber fasste den Beschluss, der Sache auf den Grund zu gehen. Und da sich Sophie für den Augenblick in seiner unmittelbaren Nachbarschaft befand, war er überzeugt, dass ihm das auch gelingen würde.
1 Die 7. Klasse Gymnasium entspricht in Österreich der 11. Schulstufe und wird von 16- bis 17jährigen Schülern und Schülerinnen besucht.
2Siehe den vorhergehenden Band ›Lenauwahn‹
Kapitel 3
»DER JUNGE HERR: Machen Sie keine solchen Geschichten, Marie … Ich hab Sie schon anders auch gesehn. Wie ich neulich in der Nacht nach Haus gekommen bin und mir Wasser geholt hab; da ist die Tür zu Ihrem Zimmer offen gewesen … na …« (Schnitzler: Reigen)
Längst hatte sich die Schwüle des Abends nach innen übertragen. Die Musik aus dem CD-Player spielte so leise, dass man sich daneben ungezwungen unterhalten konnte, aber so laut, dass sie nicht ganz zum Hintergrundgeräusch verkümmerte. Der Raum war nur spärlich durch einen Kerzenleuchter erhellt, den einer der Gäste mitgebracht hatte. Eines der Pärchen, die sich inzwischen gebildet hatten, begann zu tanzen, ein zweites folgte wenig später. Dabei vollführten die Hände mehr Bewegungen als die Beine. Schon bald griff ihr Partner Sophie Kuril ungeniert unter die Bluse. Das andere Paar küsste sich so wild, dass es aussah, als würden die beiden einander auffressen.
Der Tanz erfüllte nur einen Zweck: in Stimmung zu kommen für das, was folgen sollte. Emmerich Holub und die dritte Frau, die ein wenig jünger als ihre Geschlechtsgenossinnen wirkte, tranken von dem zuvor schon reichlich geflossenen Sekt. Die Frau machte bereits einen ziemlich beschwipsten Eindruck. Sie gluckste und kicherte und hatte beim Reden einen Zungenschlag. Plötzlich stand sie auf und fing an, sich auszuziehen. Emmerich Holub feuerte sie dabei vehement an. »Los, mach weiter, ich will dich nackt sehen«, grölte er. »Ich will dein Popscherl sehen. Komm, zeig mir dein süßes Popscherl!«
Sie entledigte sich rasch ihres Gewandes und hielt Holub ihr Hinterteil provokant vors Gesicht. Er bedeckte es sofort mit einer Salve von Schlägen und Küssen. Auch bei den anderen Paaren hatte sich bereits so viel getan, dass man dazu überging, das Geschehen in die einzelnen Schlafzimmer zu verlegen.
Es war nämlich kein Arbeitstreffen, das an diesem Wochenende in der ehemaligen Pension Vogelsang stattfinden sollte. Alle sechs Teilnehmer waren bis jetzt brave und biedere Eheleute gewesen. Sie hatten beschlossen, ihre Partner für zwei Tage und zwei Nächte nach Strich und Faden zu betrügen. Jeder Mann sollte dabei jeweils einmal mit jeder Frau das Bett teilen. Das war zwar gefährlich, gab der Sache jedoch einen besonderen Kick.
*
Leopold lag wach auf dem Rücken und starrte mit weit aufgerissenen Augen zur Decke. Er hatte sich immer noch nicht ganz an die großzügigen Dimensionen von Erika Hallers Schlafzimmer gewöhnt. Außerdem kamen in seinem Kopf allerlei Dinge zusammen.
»Was hast du?«, wollte Erika, die mit weiblicher Intuition spürte, dass ihn etwas beschäftigte, wissen. »Kannst du nicht schlafen?«
»Ich denke nur ein bisserl nach«, versuchte er, sie zu beruhigen.
»Das kenne ich«, seufzte sie. »In Kürze gehst du wieder nachschauen, was im Kühlschrank ist, und legst eine mitternächtliche Zwischenmahlzeit ein. Erstens ist das nicht gesund, und zweitens macht es mich nervös, Schnucki!«
»Das Problem besteht darin, dass ich in letzter Zeit vergessen habe, was es heißt, nachzudenken«, sinnierte Leopold. »Mir gehen Dinge durch den Kopf, aber es fehlt ihnen der Fokus, die Richtung, das Ziel.«
»Dann schläfst du vielleicht doch bald wieder ein«, hoffte Erika.
»Darum geht es nicht«, winkte Leopold ab. »Die Sache ist eher allgemeiner Natur. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Im Kaffeehaus sind meine Handlungen mehr oder minder automatisiert. Ein Gast kommt, bestellt etwas, ich bringe es ihm. Nach einer Weile hat er gegessen und getrunken. Dann bestellt er entweder noch etwas oder er will zahlen. Dazwischen kann sich vielleicht noch ein beiläufiges Gespräch, ein Plauscherl, entwickeln. Aber das ist alles keine wirkliche Herausforderung.«
»Und?« Erika Haller drehte sich zu ihm. Sie war hellhörig geworden.
»Ich brauche während meiner ganzen Arbeit nicht nachzudenken, das ist es. Bei uns beiden läuft auch alles gut, da würde es höchstens stören, wenn ich nachdenken würde«, fuhr Leopold fort.
»Bring es gleich auf den Punkt: Dir gehen deine kriminalistischen Abenteuer ab.«
»Und wenn dem so wäre?«, forschte Leopold vorsichtig nach.
»Wer ist denn ermordet worden?« Erika war jetzt nicht nur hellhörig, sondern auch hellwach.
»Noch niemand. Aber im Gymnasium ist eine kleine Sauerei passiert.«
»Hat dich Thomas auf eine Fährte angesetzt?«
»Leider nicht!« Leopold erzählte Erika kurz die Geschichte um den mysteriösen Brief an Elisabeth Dorfer, wie er sie gehört hatte. »Was denkst du?«, fragte er abschließend.
»Schlimm«, antwortete sie. »Aber jetzt befasst sich ohnehin die Polizei damit.«
»Genau genommen befasst sich nicht die Polizei damit, sondern nur Inspektor Bollek. Das ist vielleicht das Schlimmste an der Sache.«
»Komm, lass deine alte Rivalität.«
»Wie soll ich, wenn ich weiß, dass er wieder einmal nichts ausrichten wird?«
»Jetzt werde bloß nicht ungerecht, Schnucki! Sag, hast du überhaupt den Eindruck, dass irgendjemand möchte, dass du dich der Sache annimmst?«
Der Hieb saß. Leopold verschlug es kurz die Sprache. Während er noch nachdachte, was er darauf am besten sagen könnte, spürte er, wie Erikas Hand seinen Arm sanft berührte. »Du möchtest helfen«, nahm sie ihm die Worte aus dem Mund. »Das verstehe ich ja auch. Aber wie?«
Es war eben doch seine Erika, wie er sie von Anfang an kennen- und liebengelernt hatte. »Genau das sind die Dinge, über die es sich lohnt, nachzudenken«, befand er erleichtert. »Wie würdest du eigentlich reagieren, wenn du so alt wärst wie diese Elisabeth Dorfer und einen derartigen Brief erhieltest?«
Erika überlegte: »Die Mädchen sind zwar heute schon viel aufgeklärter, als wir es in dem Alter waren. Trotzdem würde ich mich zuallererst in meiner Intimsphäre bedroht fühlen und mich dann natürlich maßlos über meine Ohnmacht ärgern. Denn ich kann mich ja nicht wehren.«