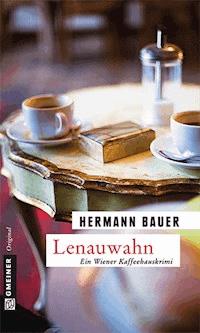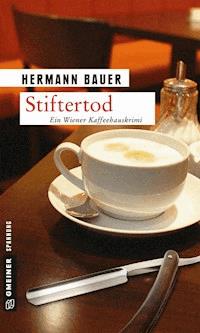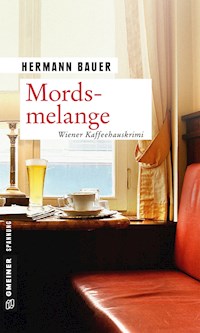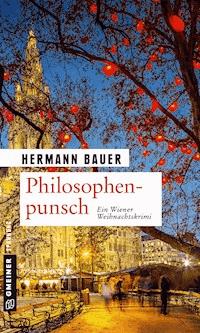Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Chefober Leopold W. Hofer
- Sprache: Deutsch
Kaum von einem langjährigen Auslandsaufenthalt in Deutschland zurückgekehrt, wo er den deutschen Rilke-Lyrik-Preis gewonnen hat, engagiert sich René Kreil für eine Fußgängerzone im Zentrum Floridsdorfs. Durch sein provokantes Vorgehen macht er sich schnell Feinde. Als er nach einem Fernsehinterview erstochen in seinem Arbeitszimmer aufgefunden wird, ist der Kreis der Verdächtigen deshalb enorm. Die Polizei ermittelt, aber Oberkellner Leopold ist ihr wie immer einen Schritt voraus …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann Bauer
Rilkerätsel
Ein Wiener Kaffeehauskrimi
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2015
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © -Mook$- / photocase.de
ISBN 978-3-8392-4786-0
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Kapitel 1
Im Sturm, der um die starke Kathedrale
wie ein Verneiner stürzt der denkt und denkt,
fühlt man sich zärtlicher mit einem Male
von deinem Lächeln zu dir hingelenkt:
lächelnder Engel, fühlende Figur.
(Aus: Rilke, L’Ange du Méridien)
Als René Kreil, von der Alten Donau kommend, den Kinzerplatz überquerte, waren der Platz selbst und die mächtige Pfarrkirche St. Leopold in ein magisches Licht getaucht. Soeben war ein heftiger Regenguss, begleitet von ein paar Blitzen und Donnerschlägen, niedergegangen. Die dunklen Wolken zogen weiter, es fielen ein paar letzte Tropfen. Schon bemühte sich die Sonne wieder hervor, und am Himmel zeigten sich die Umrisse eines Regenbogens.
Kreil schüttelte den Kopf. Und das alles an einem Sonntagvormittag Anfang September um 10 Uhr, dachte er. Was das Wetter doch bisweilen für Kapriolen schlug. Er bedauerte, dass er nichts bei sich hatte, um die merkwürdige Stimmung festzuhalten: keinen Fotoapparat, keinen Notizblock, keinen Kugelschreiber. Nur in seinen Gedanken konnte er alles abspeichern und hoffen, dass er es später wieder nahezu genauso abzurufen vermochte. Die Szene erschien ihm eine Würdigung in Form eines Gedichtes wert. Denn er war ja Poet.
Kreil faszinierte das imposante neugotische Kirchengebäude mit seinem über 90 Meter hohen Turm. St. Leopold, die drittgrößte Kirche Wiens, war am Beginn des 20. Jahrhunderts noch zur Regierungszeit Kaiser Franz Josefs errichtet worden. Floridsdorf hatte man gerade der Stadt Wien eingemeindet und das Donaufeld* nach der Donauregulierung trockengelegt. Schon als Kind hatte diese Kirche auf den heute 56-jährigen Kreil einen gewaltigen Eindruck gemacht. Wie oft war er mit seiner Mutter und seinem Bruder hierher gekommen, und während die Mutter auf einer Bank ein Buch gelesen hatte, waren er und sein Bruder August im Wettstreit um die Kirche gelaufen. Ganz egal, wer dabei den Kürzeren zog – es endete, ganz unpassend zu der heiligen Umgebung, immer im Streit und manchmal, wenn die Mutter nicht rechtzeitig herbeieilte, auch mit einer Rauferei. Die Mutter musste sich dann von gaffenden Passanten anhören, welch ungezogene Fratzen sie zur Welt gebracht hatte, und reagierte ihren Ärger auf ihre Weise ab: mit ein paar Watschen.
Wir haben uns schon damals nicht gut vertragen, August und ich, ging es Kreil durch den Kopf. Der gegenseitige Vorwurf hatte stets gelautet: Du kannst nicht verlieren.
Er wollte weitergehen, aber irgendwie kam er nicht von der Kirche los, die er nach langer Zeit wieder ganz aus der Nähe sah. Sie übte eine unerklärliche Anziehungskraft auf ihn aus. Ein Gefühl der inneren Unruhe bemächtigte sich seiner. Es war ihm, als blickte der steinerne Turm mit der grünen Kirchturmspitze und der Uhr mit dem römischen Ziffernblatt direkt in sein Herz, als gäbe es keine Geheimnisse zwischen ihm und diesem Gebäude, das noch immer in einem ganz unnatürlichen Licht vor ihm dastand. Er erinnerte sich. Als Kind war er natürlich nicht nur um die Kirche gelaufen, er hatte auch regelmäßig den Gottesdienst besucht, weil seine Eltern es so wollten. Nach der Firmung wurden diese Besuche rasch seltener, bis sie schließlich ganz aufhörten. Seither hatte er die Kirche St. Leopold nicht mehr betreten.
Was ist schon dabei, auf einen Sprung hineinzugehen, überlegte Kreil. Teils lenkte ihn dabei die Neugier, teils spürte er weiterhin diesen seltsamen Drang in sich. Der Gesang, der schwach herausklang, zeigte ihm an, dass gerade eine heilige Messe stattfand. Das gab seinem Herzen einen weiteren Stoß. Er stieg die Stufen zum kleinen Seiteneingang empor und betrat das Innere des Gotteshauses.
Kreil nahm seinen Hut ab und strich über das lange, gewellte, nach hinten frisierte Haar. Sofort stieg der Geruch von Weihrauch angenehm in seine Nase. Eine überschaubare Anzahl von Gläubigen verteilte sich ungleichmäßig auf die engen, hölzernen Bankreihen: vorne einige, hinten nur sehr wenige. Im Gegensatz zu Kreils früheren Kirchenbesuchen, wo die Frauen noch links, die Männer rechts vom Mittelgang Platz genommen hatten, saßen Frauen und Männer jetzt gemeinsam. Gerade ging die Kommunion zu Ende, und die letzten Teilnehmer kamen vom Altar zurück. Erneut wurde Kreil unruhig. Es war ihm, als müsse er auch noch schnell nach vorne eilen und die Hostie zu sich nehmen. Aber es war wohl zu spät. Außerdem wusste er noch von früher, dass die Seele vor Einnahme der Kommunion reingewaschen sein musste, und das war bei ihm überhaupt nicht der Fall. Er konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, wann er das letzte Mal gebeichtet hatte.
Ich lebe im Zustand der Sünde, schoss es Kreil durch den Kopf. Noch vor wenigen Minuten wäre ihm das vollkommen egal gewesen. Jetzt aber meldeten sich die Vergangenheit und sein schlechtes Gewissen. Bilder tauchten in ihm auf, die ihm den inneren Frieden raubten. Er spürte, wie sein Herz klopfte, sein Atem schneller wurde. Er hätte hier nicht hineingehen sollen, eigentlich gehörte er gar nicht hierher. Der Priester sprach die Worte des Segens. War damit auch er gemeint? Während Kreil mit halbem Ohr hinhörte, wuchs in ihm das Begehren, mit einem Mal alles loszuwerden, was jetzt wieder aus den Tiefen seiner Seele hervorkam und ihn bedrückte.
Er fasste einen Entschluss. Die Gelegenheit war günstig. Er ging rasch im rechten Gang an den Kirchenbänken vorbei nach vorne zu dem Priester, der auf seinem Weg in die Sakristei hier mit seinen Ministranten vorbeikam. Der Priester schaute ihn prüfend an. Sein fragender Gesichtsausdruck zeigte, dass er den Mann noch nie zuvor gesehen hatte.
»Ich … ich möchte beichten«, stammelte Kreil, der nicht so recht wusste, was er sagen sollte.
»Gut«, nickte der Priester. »Wenn es denn so wichtig ist, gehen wir gleich nach hinten.« Er deutete auf den großen Beichtstuhl auf der anderen Seite, dann entließ er seine Ministranten und begab sich mit Kreil dorthin.
Kreil kniete nieder, der Priester setzte sich hinein und öffnete die Sprechklappe. Ein wenig hastig leierte er die gewohnten Worte herunter: »Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.«
Verwirrt wiederholte Kreil die Formel. Dann machte er unbeholfen ein Kreuzzeichen.
»Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir die wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit. Du bist hierher gekommen, um Gott um Verzeihung für deine Sünden zu bitten. Nun sage mir, was du auf dem Herzen hast, und gegen welche Gebote du verstoßen hast«, fuhr der Priester fort.
»Gegen ziemlich viele, Hochwürden.« Kreil entfuhr ein flüchtiges Lächeln. »Ich war eitel, unmäßig und anmaßend. Ich habe Streit gesucht. Meines Nächsten Frau habe ich nicht nur begehrt, sondern sie mir hin und wieder auch genommen. Gestohlen und gelogen habe ich ebenfalls. Aber darüber habe ich mir noch nicht allzu oft den Kopf zerbrochen. Was mich wirklich beschäftigt und bedrückt, ist schon eine Weile her.« Er rückte seinen Kopf ganz nahe an die Sprechklappe heran. »Ich habe einen Menschen getötet.«
Der Priester schreckte aus seiner entspannten Haltung auf. »Wie hat sich das zugetragen?«, wollte er wissen.
»Darüber möchte ich nicht sprechen«, erklärte Kreil sofort.
»Wie du meinst, mein Sohn«, erwiderte der Priester nach einigen Augenblicken des Nachdenkens. »Du erbittest Vergebung, und in seiner unendlichen Güte ist Gott der Herr auch bereit, dir zu verzeihen. Doch dazu ist es nötig, dass du deine Tat bereust und Buße tust. Solltest du es bis jetzt nicht getan haben, ersuche ich dich dringend, dich der irdischen Gerichtsbarkeit zu stellen und dein Vergehen zu sühnen. Was du mir hier beichtest, ist von großer Schwere und nicht ohne Weiteres abgetan.«
»Sie verstehen mich vielleicht falsch«, hielt Kreil entgegen. »Ich habe niemanden umgebracht. Aber ich fühle mich schuld am Tod eines Menschen und zwar so sehr, dass es mir vorkommt, als hätte ich ihn getötet.«
»Ein großer Druck lastet auf deiner Seele, trotzdem lehnst du es ab, mit mir über die Zusammenhänge zu sprechen«, redete der Priester auf Kreil ein. »Das macht mir die Sache nicht leicht. Ich spreche dich los von deinen Sünden, doch musst du in dich gehen, damit sie nicht Teil von dir bleiben. Denke nach, auf welche Art du Buße tun kannst, denn ein paar Gebete werden nicht reichen. Gehe auf die Menschen zu, denen du geschadet hast, und zeige ihnen deine aufrichtige Reue. Danke dem Herrn, denn er ist gütig. Geh hin in Frieden.«
»Danke … Amen«, stotterte Kreil und machte noch einmal das Kreuzzeichen. Dann verließ er rasch Beichtstuhl und Kirche.
*
Die Sonne hatte ihren Kampf gegen die dunklen Wolken nun endgültig gewonnen. Kreil setzte seinen auf so merkwürdige Art unterbrochenen Spaziergang fort. Nach etwa zehn Minuten war er bei einem Haus am Beginn des Satzingerwegs angelangt. Er schaute kurz auf die Namen ›Vogler/Novota‹ am Türschild, dann läutete er. Als sich nichts rührte, läutete er noch einmal.
Jetzt öffnete sich die Tür. Eine mollige Frau mit grau durchzogenem Haar in einem blauen Hausanzug schaute neugierig durch ihre Brille nach draußen. Sie erkannte den Gast nicht gleich. »Mein Gott, du bist es, René«, grüßte sie ihn dann ohne großen Enthusiasmus. »Was willst du?«
»Darf ich auf einen Sprung hineinkommen, Rosi?«
»Das ist jetzt überhaupt kein guter Zeitpunkt. Robert schläft noch, und es ist nicht zusammengeräumt. Im Kühlschrank sieht es auch ziemlich dürftig aus«, versuchte Rosemarie Vogler ihn abzuschasseln.
»Aber Rosi …«
»Wie kommst du eigentlich auf die Idee, nach Jahren hier so einfach aufzukreuzen? Hast du noch nie etwas von Telefon oder E-Mail gehört?«
»Ich bin erst vor ein paar Wochen wieder nach Wien zurückgekommen und hatte keine Handynummer oder Mailadresse mehr von euch«, entschuldigte Kreil sich.
»Hast du auch kein Internet? Robert hat eine Homepage. Als Künstler kommt man ja ohne so etwas nicht mehr aus.«
»Ach Gott, ich setze mich doch nicht stundenlang vor den Computer, wenn ich alte Freunde besuchen will«, beteuerte Kreil. »Da marschiere ich einfach los, wenn mir danach ist.«
»Und der Gedanke, dass es ungelegen sein könnte, ist dir nicht gekommen?«, fragte Rosemarie abwartend. Sie maß ihn mit ihren Augen, stellte fest, dass er älter geworden war – wie sie und Robert auch.
Kreil zuckte die Achseln: »Ich hab’s eben versucht.«
Rosemarie überlegte. »Komm rein«, gab sie schließlich nach. »Aber nur auf eine Schale Kaffee, hörst du? Und wenn du mit Robert zu streiten anfängst, schmeißen wir beide dich wieder hochkantig hinaus.«
Kreil ging in die geräumige, unaufgeräumte Küche, die er von früher nur zu gut kannte.
»Wo warst du eigentlich die ganze Zeit?«, wollte Rosemarie wissen, während sie Kaffee in eine Filtertüte gab. »Das müssen ja mindestens acht Jahre gewesen sein.«
»Neun«, korrigierte Kreil. »Ich war in Deutschland und Frankreich, im Schwarzwald und im Elsass.«
»Und was hast du dort gemacht?«
»Ich habe mich so durchgeschlagen. Gastvorlesungen an der Universität Freiburg, künstlerische Betreuung verschiedener literarischer Projekte, freie Mitarbeit bei der einen oder anderen Zeitung und natürlich meine große Passion, die Lyrik.«
»Einen Preis hast du immerhin bekommen.«
»Den Deutschen Rilke Lyrik-Preis für mein Lebenswerk, auf den ich sehr stolz bin. ›Für das gelungene Wagnis, entgegen dem Zeitgeist anspruchsvolle gereimte Gedichte in den verschiedensten klassischen Strophenformen, vor allem in der beinahe schon vergessenen Form des Sonetts, zu verfassen‹, wie es in der Würdigung hieß.«
»Und morgen bist du sogar im österreichischen Fernsehen.«
»Ja, in der Kultursendung. Ein Live-Interview anlässlich meiner Rückkehr.«
Rosemarie Vogler, die bis jetzt verkehrt zu ihm gestanden war, drehte sich zu Kreil um. Sie sah in seinen Augen, dass er stolz auf sich war. Sein schon von einigen Falten durchzogenes Gesicht wirkte immer noch so unbeschwert und fröhlich wie früher. Unbeschwert mit starker Neigung dazu, keine Verantwortung zu übernehmen und sich wenig um die Gefühle anderer Menschen zu scheren, dachte Rosemarie. Auf eine beinahe kindliche Art eigensinnig und stur. Sie fragte: »Warum hast du nie etwas von dir hören lassen?«
»Es war … Aber ich habe doch geschrieben, ein paar Male«, protestierte Kreil.
»Was du nicht sagst!«
»Sicher! Schöne, altmodische Briefe auf Papier, wie es sich für einen Dichter gehört. Angerufen habe ich nicht, weil die Nummer nicht stimmte, die ich eingespeichert hatte. Aber geschrieben habe ich!«
»An diese Adresse? Wir haben nie etwas von dir bekommen. Und du kannst gegen die Post sagen, was du willst, aber dass sie es schafft, einen Brief innerhalb von neun Jahren zuzustellen, traue ich ihr schon zu.«
Wenn er nicht lügt, hat Robert die Briefe einkassiert, dachte Rosemarie bei sich. Dann hat er sie gelesen und sich darüber geärgert, dass René ein paar heiße Liebesbezeugungen an mich eingefügt hat, wie das so seine Art ist. Dieser unverbesserliche Kindskopf! »Wieso bist du eigentlich zurückgekommen?«, erkundigte sie sich, während sie lieblos eine Schale mit Blümchenmuster und schwarzem Kaffee vor ihn hinstellte. »Hast du plötzlich Heimweh bekommen? Ich weiß noch, wie du auf Wien und Österreich geschimpft und gesagt hast, du möchtest alle Brücken abbauen, bevor du fort bist.«
»Vielleicht war es etwas überspitzt formuliert, aber ich habe es damals in diesem engen, kleinen Land nicht mehr ausgehalten«, verteidigte Kreil sich. »Der Erfolg hat mir Recht gegeben. Ich konnte eine weit größere Öffentlichkeit mobilisieren als hier und ganz ohne den Zwang, einflussreiche Freunde zu haben. Ich habe einen Preis bekommen, um den man mich im ganzen deutschen Sprachraum beneidet. Aber nach einigen Jahren hält man es eben in der Fremde nicht mehr aus und ist froh, wieder daheim zu sein.«
Rosemarie setzte sich zu ihm. Sie faltete ihre Hände auf dem Küchentisch. »Jetzt sag mir doch bitte einmal, warum du heute zu uns gekommen bist, René«, forderte sie ihn auf.
Kreil seufzte. »Wenn man so lang weg gewesen ist, fühlt sich die Heimat genauso an wie die Fremde«, sagte er. »Man kennt die Leute zwar, aber die Leute kennen einen nicht mehr. Ich habe mir die Sache einfacher vorgestellt. Ich habe keine Freunde. Da habe ich gedacht, ich könnte einen Teil meiner Vergangenheit zurückholen.«
»Und dabei sind ausgerechnet wir dir eingefallen.«
»Natürlich! Wir drei haben doch schöne Zeiten miteinander verbracht.«
Obwohl diese Behauptung Kreils stimmte, durfte Rosemarie das jetzt auf keinen Fall zugeben. »Du warst auf niemanden gut zu sprechen, ehe du fortgegangen bist«, erinnerte sie ihn. »Alles war dir zuwider. Du hast uns und andere fühlen lassen, wie sehr es dich ankotzt. Dann bist du weg. Jetzt bist du wieder da. Du glaubst, du brauchst nur auf einen Knopf zu drücken, und alles ist so wie früher. Wie stellst du dir das vor?«
»Ich stelle mir gar nichts vor«, entgegnete er. »Ich merke nur, wie die Zeit vergangen ist. Zu viel Zeit. Wie viel bleibt noch? Versteh mich bitte richtig: Ich habe keine Angst, von heute auf morgen tot umzufallen oder ein hoffnungsloser Krüppel zu sein. Aber was kann ich noch schaffen? Wenn ich auf der Straße unter den vielen fremden Menschen gehe, überfällt mich manchmal eine seltsame Müdigkeit. Dann werde ich nachdenklich und mir fallen die folgenden Zeilen aus einem meiner Gedichte ein:
›… Egal, ob träge
oder mit Arbeit du verbringst die Stunden.
Die Zeit vergeht. Und ist auch schon entschwunden.
Ins Fleisch dir schneidend wie durchs Holz die Säge.‹«
»Ich kann mich an dieses Gedicht erinnern«, teilte Rosemarie Kreil mit. »Wie hieß es doch gleich?«
»Was du auch tust«, antwortete er. »Meine Gedanken haben sich seither nicht verändert.« Nach einer kurzen Pause fügte er leise hinzu: »Genauso wenig wie meine Gefühle für dich.«
Rosemarie Vogler stand ruckartig auf und zog Kreil die leere Kaffeeschale unter der Nase weg. »Ich hätte mir gleich denken können, worauf du aus bist, aber schlag dir das aus dem Kopf«, ersuchte sie ihn. Dann wechselte sie sofort das Thema: »In der Bezirkspolitik engagierst du dich jetzt ja auch. Jedenfalls machst du ganz schön Werbung für die neue Fußgängerzone am Floridsdorfer Spitz.«
»Ich helfe mit, die Leute zu überzeugen, dass das für unseren Bezirk das Beste ist«, erklärte Kreil. »Ich stehe voll hinter dem Projekt. Gerade für uns Künstler ergeben sich dadurch ungeahnte Möglichkeiten: Stände mit Kunsthandwerk, Ateliers und Schauräume, kleine Geschäfte mit Produkten fern vom Massenbetrieb. Um die derzeit leerstehenden Geschäftslokale gibt es ein richtiges Griss. Sollte Robert übrigens an Räumlichkeiten interessiert sein, könnte ich meine Verbindungen spielen lassen.«
Rosemarie überhörte dieses Angebot. »Es hagelt immer noch Proteste gegen die Fußgängerzone«, wandte sie ein. »Es heißt, sie würde zu einem Verkehrschaos führen, sodass die Autofahrer in Zukunft einen großen Bogen um unseren Bezirk machen. Die Geschäftsleute auf der Floridsdorfer Hauptstraße sind fuchsteufelswild. Sie denken, dass sie die ersten Opfer dieser Maßnahme sein werden, weil niemand mehr über die Floridsdorfer Brücke und damit durch ihre Straße fahren wird. So unrecht haben sie, glaube ich, nicht.«
Kreil machte eine wegwerfende Handbewegung. »Lauter Kleingeister«, behauptete er. »Den Geschäften geht es ja jetzt schon schlecht, das hat nichts mit der Fußgängerzone zu tun. Alle glauben, sie können so arbeiten wie vor 50 Jahren. Sie stellen keine Überlegungen an, wie sie mit den Herausforderungen unserer Zeit zurechtkommen sollen. Diese Lahmärsche sollen froh sein, wenn sie aus ihrem Winterschlaf geholt werden.«
Man hörte Geräusche aus dem Nebenzimmer. Robert Novota hatte offensichtlich seinen vormittäglichen Schlaf beendet. »Du solltest gehen«, sagte Rosemarie. »Wo wohnst du jetzt eigentlich?«
Kreil stand auf. »Bei meiner Mutter.«
»Ach so? Und ihr vertragt euch?«
»Leidlich! Rosi, hör mir bitte noch einen Augenblick zu …«
Doch mitten in Kreils Worte hinein ging die Tür auf, und Novota betrat kräftig hustend die Küche. Er trug noch immer einen Pyjama. Als er Kreil sah, verfinsterte sich sein Gesicht. »Was um alles in der Welt machst du hier?«, fragte er mürrisch.
»Servus, Robert! Ich bin wieder in Wien.«
»Hab ich bemerkt.«
»Ich wollte nur einfach einmal hallo sagen, weil wir uns schon eine Ewigkeit nicht gesehen haben.«
Novota deutete auf Rosemarie. »Ihr wolltest du hallo sagen. Das hast du hoffentlich ausreichend getan, denn jetzt bitte ich dich, wieder zu verschwinden. Ich möchte einen angenehmen Sonntag verbringen, und da ist deine Gegenwart nicht unbedingt förderlich.«
»Ich hätte kurz mit dir zu reden, Robert«, ließ sich Kreil nicht einschüchtern. »Es geht um die neue Fußgängerzone am Floridsdorfer Spitz. Ich könnte dir dort ein Lokal als Atelier oder Schauraum verschaffen, zu einem sehr günstigen Preis …«
Novota ging mit seinem Gesicht ganz nahe an das von Kreil heran und zwang ihn dadurch, die Überreste seiner Alkoholfahne einzuatmen. »Jetzt hör einmal zu«, forderte er ihn auf. »Lass mich mit der Fußgängerzone in Ruhe, sie interessiert mich nicht. Ich will meine Ruhe haben. Du bist wieder da, schön. Aber ich möchte dich nicht sehen. Und Rosemarie hat dir hoffentlich auch schon klargemacht, was sie von solchen Hausbesuchen hält, oder?« Er warf seiner Lebensgefährtin einen fragenden Blick zu. Sie nickte kurz.
Kreil erhob sich. »Na gut, ich gehe«, gab er schließlich nach. »Vielleicht denkt ihr ab und zu einmal daran, welch schöne Zeiten wir früher hatten.«
»Bist du noch nicht fort?«, rief ihm Novota nach, als er die Türklinke in die Hand nahm.
* Donaufeld ist heute ein Bezirksteil Floridsdorfs.
Kapitel 2
Manchmal gehe ich an kleinen Läden vorbei, in der rue de Seine etwa. Händler mit Altsachen oder kleine Buchantiquare oder Kupferstichverkäufer mit überfüllten Schaufenstern. Nie tritt jemand bei ihnen ein, sie machen offenbar keine Geschäfte.
(Aus: Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge)
»Korber!« Direktor Marksteiners sonore Stimme hallte über den Gang des Floridsdorfer Gymnasiums. »Auf ein Wort!«
Thomas Korber kam gerade vom Englischunterricht in der 2. Klasse C, und anstatt ihn von seiner Sekretärin, Frau Pohanka, zu sich beordern zu lassen, fing Marksteiner ihn persönlich vor seiner Direktionskanzlei ab. Das bedeutete für Korber, dass er keine schlechte Nachricht oder gar eine Standpauke zu befürchten hatte. Sonst hätte Marksteiner auf die Unglücksbotin Pohanka zurückgegriffen.
Launig wies der Direktor Korber den Platz ihm gegenüber an. »Und? Haben Sie sich schon wieder an die Schule gewöhnt?«, erkundigte er sich beiläufig. »Wo waren Sie denn in den Ferien?«
»Großteils in Wien, aber eine Woche im Salzkammergut«, antwortete Korber wahrheitsgemäß.
»Das Salzkammergut, ja, ja. Eine traumhafte Gegend, wenn’s dort nicht immer regnen würde. Waren Sie in Ischl?«
»Nein, in Fuschl, Herr Direktor. Und das Wetter war Gott sei Dank schön.« Korber erinnerte sich an die Wanderungen mit seiner Freundin Geli Bauer, ans Baden im kühlen See, an die unbeschwerten Abende zu zweit. Der Urlaub war wichtig für seine Beziehung mit Geli gewesen, um die es zuletzt wieder einmal nicht sehr gut gestanden war.
»Da hatten Sie ja Glück«, stellte Marksteiner lapidar fest. Dann kam er zum eigentlichen Grund des Gesprächs: »Jetzt stehen wir also wieder am Schulanfang, lieber Korber. Da gilt es, Hunderte kleine Dinge zu erledigen, und über eins davon würde ich gern mit Ihnen reden. Zwei Ihrer Schüler haben doch im Vorjahr schöne Preise bei einem Poetry-Jam gewonnen.«
»Slam«, korrigierte Korber.
»Wie bitte?« Marksteiner fuhr irritiert mit seinem Kopf von den Aufzeichnungen hoch, die er in der Hand hielt.
»Bei einem Poetry-Slam, einem Wettbewerb, bei dem es sowohl um den poetischen Ausdruck der inneren Gefühlswelt als auch auf eine mitreißende Bühnendarbietung ankommt. Denn der Wettkampf wird sofort durch das Publikum entschieden. Da geht die Post ab, wenn ich es so zwanglos formulieren darf. Tamara Lesicky aus unserer Schule hat damals gewonnen, und Peter Stachowicz wurde Dritter.«
»Ausgezeichnet, lieber Korber! Ich weiß ja, dass ich mich auf Sie verlassen kann, wenn es darum geht, dass unsere Gymnasiasten mit ausgezeichneten Leistungen auf dem Gebiet der Kunst und Kultur brillieren«, lobte Marksteiner seinen Deutsch- und Englischlehrer. »Darum wende ich mich auch jetzt wieder an Sie. Das Unterrichtsministerium wünscht, dass anlässlich der Anforderungen für die neue zentrale Reifeprüfung die Schüler wieder mehr mit den Grundkenntnissen der Literatur vertraut werden. So ein Poetry … Also so ein Wettstreit auf offener Bühne gut und schön, aber wir beide wissen, dass bei so etwas die Show im Vordergrund steht. Wie rein sich das reimt und wie holprig das daherkommt ist ja mehr oder minder egal, oder? Nun sollen jedoch das Versmaß, der Reim und die Gedichtformen wieder stärker beachtet werden. Ein Jambus ist eben ein Jambus, ein Kreuzreim ein Kreuzreim und ein Sonett ein Sonett. Deshalb wurde ein Wettbewerb ins Leben gerufen, der von den Teilnehmern Gedichte in den traditionellen Spielarten und Formen verlangt. Hier sind die Teilnahmebedingungen. Einsendungen schriftlich bis zum Soundsovielten an die folgende Adresse und so weiter. Lesen Sie sich alles durch und reichen Sie es an interessierte Schüler weiter.«
Korber nahm die Ausschreibung skeptisch aus der Hand des Direktors entgegen. »Glauben Sie, dass so etwas bei unseren Schülern auf entsprechende Gegenliebe stoßen wird?«, zweifelte er. »Im Vergleich zu einem Poetry-Slam wirkt es etwas langweilig und altbacken.«
»Ich denke schon«, lächelte Marksteiner. »Das Ministerium lässt sich die Sache etwas kosten. Es gibt Preise in drei Kategorien, und jeder ist mit € 3.000.- dotiert. Das ist für einen jungen Menschen doch sicherlich genug Anreiz, sich einmal auf den Spuren der Dichterväter zu versuchen. Einen schönen, klingenden Namen hat der Bewerb auch: Rhymin’ Rilke-Contest. Damit wird der wohl größte österreichische Dichter des vergangenen Jahrhunderts gewürdigt. Und es gibt eine spektakuläre Schlussveranstaltung, wo die besten Autoren Gelegenheit haben werden, sich und ihre Gedichte einem größeren Publikum, Prominenz aus Kultur und Politik eingeschlossen, vorzustellen. Lesen Sie es sich nur in Ruhe durch, es ist alles detailliert beschrieben.«
Korber überflog die Ausschreibung. Rhymin’ Rilke-Contest! Er musste innerlich lachen. War etwas auch noch so stockkonservativ, so bekam es doch zumindest eine modern wirkende englische Bezeichnung. Dann rief er kurz alles ab, was ihm zu Rilke einfiel: ein ruheloser Geist, den es durch halb Europa getrieben hatte und der doch nirgendwo richtig heimisch geworden war; ein Suchender nach Gott und dem Sinn in allen Dingen; einer, dessen Sehnsuchtsvorstellungen sich nie erfüllten, dessen Bindungen brüchig waren; der sich öfter in finanziellen Nöten befand; der davon beseelt war, Zeitloses, Ewiggültiges zu schaffen und die Abhängigkeit des Menschen von zeitlichen Zwängen verabscheute; ein Träumer; letztlich aber einer der größten und begnadetsten Poeten nicht nur seiner Epoche, des beginnenden 20. Jahrhunderts, sondern der Weltliteratur überhaupt. Korber liebte seine wunderschön geformten, genau durchkomponierten Gedichte, nicht nur die berühmten wie etwa den Panther, sondern auch die zahlreichen Sonette, Elegien und anderen lyrischen und epischen Dichtungen. Ob aber seine Schüler diese Liebe teilten und man sie dazu bewegen konnte, etwas Ähnliches zu entwerfen, diesbezüglich blieb er trotz des finanziellen Anreizes skeptisch.
»Natürlich ist es jetzt vor allem notwendig, dass Sie und die anderen Deutschlehrer der Lyrik in den nächsten Wochen einen prominenten Platz im Unterricht einräumen«, drang Marksteiner auf Korber ein, als hätte er dessen Gedanken erraten. »Die Schüler müssen mit ihren vielfältigen Spielarten und Formen wieder etwas anzufangen wissen, damit sie bei der Zentralmatura auch das literarische Thema bewältigen können. Das ist, wie gesagt, der Hintergrund der ganzen Aktion. Informieren Sie also Ihre Kollegen dahingehend im Rahmen einer Fachgruppensitzung. Ich werde mich selbstverständlich persönlich davon überzeugen, dass die Sache klappt.«
So ungefähr habe ich mir das vorgestellt, dachte Korber. Unter dem Deckmantel eines gut dotierten Wettbewerbs wurde still und heimlich die Kontrolle vor Einführung der Zentralmatura verstärkt, damit alle inhaltlichen Bereiche hundertprozentig abgedeckt waren.
»Natürlich liegt mir sehr am Herzen, dass wir auch bei dieser Konkurrenz wieder den bewährten ausgezeichneten Eindruck hinterlassen«, ersuchte Marksteiner. »Sobald wir eine Teilnehmerliste haben, bitte ich Sie, diese Gruppe gesondert zu betreuen. Haben Sie schon einen Kandidaten oder eine Kandidatin im Auge, die Ihrer Meinung nach einen Preis für unsere Schule erringen könnte?«
»Derzeit fällt mir niemand ein«, antwortete Korber illusionslos. Nachdem er sich von Marksteiner verabschiedet hatte, begab er sich auf den Gang hinaus, wo ihn der Schülerlärm und das Läuten zur nächsten Stunde vorerst wieder auf andere Gedanken brachten.
*
»Das ist er«, raunte Leopold seiner Chefin mit einem Deuter nach hinten zu, während er zwei Silbertabletts mit leergetrunkenen Kaffeeschalen zurückbrachte.
Frau Heller ließ ihren Blick neugierig durch ihr Kaffeehaus gleiten. Wenn die Tische, so wie jetzt, voll waren und man sah, dass es den Leuten schmeckte und sie sich gut unterhielten, tat sie das besonders gern. »Wer?«, wollte sie wissen.
»René Kreil, unser internationaler Literaturstar. Ein waschechter Floridsdorfer. In Deutschland hat er einen großen Preis gewonnen. Dann ist er nach Österreich heimgekehrt, und seither liegen ihm hier alle zu Füßen. ›Floridsdorfer Rilke‹ wird er genannt. Heute Abend ist er sogar im Fernsehen«, klärte Leopold seine Chefin auf.
»Aha! Und wenn dieser Mann so gut ist und so tolle Preise bekommt, warum ist er dann noch nicht bei uns im Kaffeehaus aufgetreten?«
Leopold wollte etwas Boshaftes darauf antworten, das mit Geld und den finanziellen Möglichkeiten des Café Heller zu tun hatte, unterließ es aber wohlweislich und bemerkte nur knapp: »Weil er nicht da war. Das ist bei internationalen Stars so üblich, dass sie sich eher im Ausland aufhalten als zu Hause. Aber jetzt ist Herr Kreil, wie gesagt, wieder zurück.«
»Na, hoffentlich bleibt er auch hier«, erwachte in Frau Heller das künstlerische Interesse. »Was hat man schon von einem Star, der sich immerzu außerhalb seines Heimatbezirks herumtreibt? Meinen Sie, ich soll zu ihm gehen und ihn fragen, ob er bei uns eine Lesung abhalten würde? Da wäre unser Kaffeehaus sofort wieder in aller Munde, finden Sie nicht auch?«
»Besprechen Sie das zuerst vielleicht mit Ihrem künstlerischen Berater, dem Herrn Wondratschek«, riet Leopold. »Der kennt sich in solchen Dingen besser aus. Außerdem würde ich den Herrn Kreil jetzt nicht stören. Sie sehen doch, dass er in ein wichtiges Gespräch vertieft ist.«
»Wahrscheinlich geht es um ein großes literarisches Projekt«, mutmaßte Frau Heller.
»Ich glaube, es geht eher um die neue Fußgängerzone vorn am Floridsdorfer Spitz. Da hat er nämlich auch seine Finger drinnen«, gab Leopold von sich. Als ihm seine Chefin allerdings Näheres darüber herauslocken wollte, eilte er zu einem durstigen Gast, der ihn zu sich gerufen hatte.
*
Kreil gegenüber saß ein Mann Mitte 40, dessen Halbglatze und Ringe unter den Augen ihn allerdings älter aussehen ließen. Er machte einen nervösen und ungeduldigen Eindruck. Ständig klopfte er mit den Fingern auf den Tisch und räusperte sich. »Komm, René, sag mir, wann ich mit dem Geld rechnen kann«, forderte er.
Kreil tat, als ob er aus allen Wolken fallen würde. »Ich kann es immer noch nicht glauben. Du hast es mir doch geschenkt«, beteuerte er.
»Frecher geht es wohl nicht«, empörte sich Walter Kerze, sein Gegenüber. »Ich habe es dir geliehen, damit du dir deinen großen Traum von ein paar Jahren im Ausland überhaupt leisten konntest. Du hast von mir einen zinsenfreien Kredit über 10.000 Euro bekommen, aber jetzt, wo du wieder da bist, möchte ich das Geld schön langsam zurückhaben.«
Kreil schüttelte langsam und deutlich den Kopf. »Du befindest dich im Irrtum, Walter. Das war eine Spende. Kannst du dich denn nicht mehr erinnern? Einmal möchtest du der Kunst einen guten Dienst erweisen, hast du gesagt. Dabei hast du mir noch auf die Schulter geklopft.«
»Spende? Da kann ich nur lachen! Wir waren zwar immer gute Freunde, aber jetzt hört sich der Spaß langsam auf!«
»Was hast du in der Hand?«, fragte Kreil mit einem Mal sehr bestimmt. »Habe ich dir irgendeinen Schuldschein unterschrieben? Gibt es Zeugen für deine Behauptungen?«
»Du willst doch nicht abstreiten, was wir damals vereinbart haben«, mahnte Kerze ihn.
»Ich streite nichts ab, ich bin nur gegen verschwommene Erinnerungen«, stellte Kreil klar. »In Deutschland habe ich dich immer liebevoll als meinen Mäzen bezeichnet. Du warst mein großer Förderer, und das werde ich dir nie vergessen. Also komm mir jetzt bitte nicht mit so einem Schmarrn!«
»Ich würde dich ja wegen der Rückzahlung nicht drängen«, versuchte Kerze es auf die sanfte Tour. »Aber meine Firma steht leider auch nicht mehr so gut da wie vor ein paar Jahren. Ich brauche das Geld. Bitte versteh das!«
»Aha! Daher weht der Wind! Du benötigst Geld und willst mir einreden, dass ich es dir schulde«, ging Kreil sofort zum Angriff über.
»Jetzt mach aber einmal einen Punkt!«
Kreil faltete seine Hände und legte sie entspannt auf das kleine Kaffeehaustischchen. Er spürte, dass er so gut wie gewonnen hatte. Nur noch ein Quäntchen Überzeugungskraft, dann würde Kerze Ruhe geben. Vorläufig zumindest. »Ich habe dir eins versprochen«, bearbeitete er ihn mit ruhiger, eindringlicher Stimme. »Wenn ich reich werde, zahle ich dir alles zurück, habe ich gesagt. Die Betonung lag auf ›wenn‹ und ›reich‹. Ich war eben ein unverbesserlicher Optimist. Ich dachte, ich könnte mit meinen Gedichten die Welt erobern. Nun, ein bisschen was habe ich ja bekommen, ich kann mich nicht beklagen …«
»Der Rilke-Preis war hoch dotiert, mit 15.000 Euro!« Kerze hielt sich mit Mühe unter Kontrolle. Er begann, mit seinem Zeigefinger in der Luft herumzufuchteln.
»Natürlich war ich darüber sehr glücklich. Allerdings hat der Preis für mich viel mehr bedeutet als das rein Materielle: Ruhm, Anerkennung, Wertschätzung meiner dichterischen Arbeit.« Kreil lehnte sich zurück. »Was bedeutet schon Geld? Was sind 15.000 Euro, wenn man vorher viel in Projekte investiert und von der Hand in den Mund gelebt hat? Man träumt davon, wohlhabend zu sein, und dabei zerrinnt einem alles zwischen den Fingern.«
»Du musst dir doch schön langsam eine Existenz aufgebaut haben. Oder hast du etwa alles wieder zum Fenster hinausgeworfen?«
Kreil deutete mit einer Geste seine Machtlosigkeit dem Schicksal gegenüber an. »Ich hab’s leider nicht geschafft. Ich lebe jetzt wieder bei meiner Mutter, weil ich mir keine eigene Wohnung leisten kann. Meine Auslagen sind tatsächlich hoch. Und für eine kleine Torheit von früher muss ich auch noch immer bezahlen. So ist das Leben!«
»Ich bekomme alles von dir zurück, bis auf den letzten Cent!« Kerzes Zeigefinger war gar nicht mehr zu beruhigen.
»Natürlich hoffe und glaube ich, dass mir das Glück bald wieder hold sein wird«, redete Kreil seelenruhig weiter. »Ich schreibe gerade an meinen Memoiren, und dass man mich jetzt schön langsam auch in Österreich ernst nimmt, wird für den Verkauf sicher förderlich sein. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen in die Politik, wer weiß. Oder ich kriege einen gut dotierten Job in der Kunstszene. Du siehst, ich habe einige Möglichkeiten. Sollte ich es auf meine alten Tage zu einem bescheidenen Wohlstand bringen, werde ich mich wie versprochen bei dir revanchieren. Bis dahin musst du dich allerdings ein wenig gedulden.«
»Gedulden?« Man sah es Kerze an, dass ihm der Kragen platzte. »Ich habe es satt. Von jetzt an werde ich dir keine ruhige Minute mehr lassen. Ich werde mir schon holen, was mir zusteht. Jedenfalls habe ich keine Zeit, auf großzügige Almosen von dir zu warten. Und unsere sogenannte Freundschaft kannst du auch vergessen.«
»Die Zeit vergeht schnell, ganz ohne unser Zutun, Walter«, äußerte Kreil nachdenklich. »Sie ist eins der wenigen Dinge, über die wir nicht bestimmen können. Wir sollten uns mit ihr abfinden und nicht hoffen, dass sich gewisse Abläufe schneller oder langsamer gestalten. Es liegt nicht in unserer Macht, die Zeit aufzuheben oder zu verändern. Wir wissen nicht einmal, wie viel davon uns noch bleibt. Das relativiert alles.«
»Überhebliches Gefasel«, schnauzte Kerze ihn an, ehe er aufstand und das Heller, ohne sich von Kreil zu verabschieden, schleunigst verließ.
*
»Also was ist jetzt mit diesem Kreil und der Fußgängerzone?«, löcherte Frau Heller in der Zwischenzeit Leopold, kaum dass er wieder neben ihr stand.
»Auf einmal sind Sie neugierig«, stellte Leopold fest, während er ein Krügerl Bier mit einer schönen Schaumkrone zapfte. »Die ganze Zeit über haben Sie sich allerdings kaum für das Geschehen in Ihrer unmittelbaren Nähe interessiert. Haben Sie denn noch nicht die Plakate mit dem Konterfei unseres Poeten und den schönen Zeilen gesehen:
›Keine Autos, keine Eile,
niemand kommt zu spät.
Flanieren durch die Künstlermeile –
Lebensqualität!‹«
»Ach, das ist er«, ging Frau Heller ein Licht auf. »Jetzt erkenne ich ihn erst so richtig. Ausgesprochen sympathisch wirkt er auf den Plakaten, wie er lächelt und gleichzeitig weise dreinschaut. Ein guter Werbeträger für eine gute Sache. Denken Sie, dass es mit der Fußgängerzone etwas wird, Leopold? Sie würde unseren Bezirk ohne Zweifel beleben.«
Leopold seufzte nur, rollte mit den Augen und trug das Bier mit der Schaumkrone nach hinten.
»Glauben Sie etwa nicht?«, fragte ihn Frau Heller, als er zurückkam.
»Wie soll so eine Fußgängerzone unseren Bezirk beleben?«, ereiferte sich Leopold sofort. »Das Gegenteil wird sie tun. Abschneiden wird sie uns vom übrigen Wien und damit praktisch von der ganzen Welt.«
»Jetzt übertreiben Sie aber, Leopold. Wer schneidet uns denn ab?«
»Meine Güte, ist das denn so schwer zu verstehen?«, startete Leopold einen Erklärungsversuch. »Wer in Zukunft über die Floridsdorfer Brücke in unseren Bezirk kommt, endet im Nichts, weil er in großem Bogen um das Zentrum herumfahren muss, und zusätzlich wird’s einen Dauerstau geben. Nach Floridsdorf fahren und mit der Gewissheit im Stau stehen, dass man nie wirklich dort hinkommt: Wer tut sich das schon an? Von der Nordbrücke her ist es ziemlich das Gleiche. Die Leute werden auf der Autobahn an uns vorbeifahren und mit dem Finger in unsere Richtung deuten: Schau, da hinten liegt Floridsdorf. Schöne Aussichten sind das!«
»An allem haben Sie etwas auszusetzen«, rügte ihn Frau Heller. »Dabei wäre es doch wichtig, dass wieder etwas Schwung in unseren Bezirk kommt. Mit dem Umsatz vieler Geschäfte um den Spitz herum schaut es nicht gut aus, das ist sogar schon in der Zeitung gestanden.«
»Das ist wegen der großen Einkaufszentren im Umland so. Und wie kommen die Leute dorthin? Mit dem Auto«, gab Leopold zu bedenken.
»Mit diesen Zentren können wir nur konkurrieren, indem wir uns von ihnen unterscheiden. Das Einkaufen muss wieder zum Erlebnis werden. Und dazu brauchen wir die Fußgängerzone.«
»Die Leute pfeifen auf ein Erlebnis, die wollen nur alles billig haben, am liebsten umsonst. Wenn so eine Fußgängerzone eröffnet wird und sie einem die Schnäppchen nachwerfen, wenn es Freibier gibt und gratis Würstel dazu, dann drängen sie sich für einen Tag, dass es zum Grausen ist. Darin besteht aber auch schon das ganze Erlebnis. Dann fahren sie wieder ins Einkaufszentrum, oder sie bleiben gleich zu Hause und kaufen alles übers Internet.«
»Übers Internet?« Auf diese Frage Frau Hellers sahen beide einander kurz unsicher in die Augen. Weder sie noch Leopold wussten mit dem Begriff allzu viel anzufangen – tangierte jene Einrichtung, die vom Großteil der Menschen mittlerweile als unverzichtbar angesehen wurde, ja ihr Leben nicht im Geringsten.
»Jawohl, übers Internet«, fuhr Leopold nach der kurzen Pause, die entstanden war, unerbittlich fort. »Diese Fußgängerzone wird jedenfalls nur für Wirbel und Unruhe sorgen. Vor allem werden dabei viele Leute ihr eigenes Süppchen kochen. Das führt zu Konflikten, und – ich traue es mich ja gar nicht zu sagen – unter Umständen sogar zu einer Gewalttat.«
Frau Heller kannte sowohl die Vorliebe ihres Oberkellners für Verbrechen jeder Art als auch seinen Hang zur Schwarzmalerei. Mittlerweile bereute sie es, überhaupt mit der Debatte begonnen zu haben. Sie suchte einen Weg, ihn auf andere Gedanken zu bringen. »Sie fahren doch gern mit dem Rad, Leopold«, erwähnte sie deshalb. »Das dürfen Sie in der neuen Zone nach Belieben tun, denn eigentlich wird es keine reine Fußgängerzone, sondern eine Begegnungszone zwischen Fußgängern und Radfahrern. Wenigstens das sollte Ihnen Freude bereiten!«
Aber damit brachte sie Leopold nur in eine noch negativere Stimmung. »Schauen Sie, Frau Chefin: Am liebsten fahre ich auf einem Radweg, wo mir nichts begegnet und vor mir nur andere Radfahrer sind«, erläuterte er. »Dann noch sehr gerne in den kleinen Gassen, wo einem nur ab und zu ein Auto begegnet. Aber warum soll es so schön sein, Fußgängern mit dem Rad zu begegnen? Wenn ich so etwas schon will, benötige ich dafür keine eigene Zone, da brauche ich nur mit dem Rad auf den Gehsteig zu fahren und laut zu klingeln, damit sie alle erschrecken und auf die Seite springen. Das erfüllt denselben Zweck.«
»Ich sage jetzt gar nichts mehr«, resignierte Frau Heller. »Sie schnauzen mich ja doch nur an. Woher kommt denn diese schreckliche Laune? Haben Sie etwa Liebeskummer?«
»Nein, da ist alles in Ordnung«, antwortete Leopold knapp. Wenn es um seine Beziehung mit Erika Haller ging, hielt er sich mit Worten vornehm zurück, denn das ging außer ihm und Erika niemanden etwas an.
»Dann ist Ihnen einfach fad«, stellte Frau Heller fest. »Unsereins freut sich, dass wir schönes Wetter haben und alles friedlich ist, und Sie sehnen schon den nächsten Mord herbei. Sie fühlen sich erst wieder wohl, wenn einer daliegt in seinem Blut. Ich beobachte diese Entwicklung mit Besorgnis, Leopold. Manchmal kommen Sie mir richtig abartig vor.«
»Meine Gedanken sind um nichts abartiger als die von den Leuten, die eine solche Fußgängerzone bauen wollen.«
»Ach was! Lassen Sie mich endlich mit Ihrer Fußgängerzone zufrieden!«
»Mit meiner Fußgängerzone? Ihre Fußgängerzone ist das! Warum sind Sie überhaupt so dafür? Diese Zone bringt unserem Kaffeehaus so gut wie gar nichts. Wir liegen ja doch ein bisserl abseits davon.«
»Ich habe gedacht, gerade darin könnte ein Vorteil liegen«, bemerkte Frau Heller nun etwas leiser und errötete dabei leicht. »Wissen Sie, wenn sich der ganze erste Wirbel einmal gelegt hat, kommen die Leute vielleicht drauf, dass es bei uns schön ruhig zugeht, dass man bequem und ohne Stau von der anderen Seite mit dem Auto zufahren kann, dass ums Eck ein kleiner kostenfreier Parkplatz liegt … Wir müssen dann nur ein wenig Werbung machen: ›Ruhe und Entspannung außerhalb der Fußgängerzone im Floridsdorfer Traditionscafé Heller …‹«
»Jetzt hab ich Sie«, unterbrach Leopold seine Chefin. »Sie sind mir ja eine Farbenverkehrerin sondergleichen. Offiziell tun Sie so, als wären Sie für die Fußgängerzone, dabei setzen Sie doch aufs Auto!«
»Natürlich bin ich dafür, schon der Umwelt zuliebe«, stellte Frau Heller klar. »Aber wenn man die Dinge realistisch betrachtet, muss man unumwunden zugeben: Ohne Auto geht heutzutage gar nichts!«
*
Stanislaus Kubista saß, vom Eingang des Café Heller aus gesehen, am letzten Fenster rechts hinten. Das fette, schwarze, strähnige Haar war glatt nach hinten gekämmt, wo ein kleines Schwänzchen den Abschluss bildete. Er trug beinahe ausschließlich weite T-Shirts, in die sein Bauch bequem hineinpasste. Seine Gesichtshaut war unrein, das Kinn meist nicht rasiert. Die dicke, unmodische Brille verstärkte den schlampigen Eindruck, den sein Äußeres machte.
Kubista betrachtete den Platz beim Fenster bereits als so etwas wie sein Eigentum. Von 9 Uhr früh bis zur Sperrstunde hockte er täglich da. Nur ganz selten verließ er ihn, um einem dringenden Bedürfnis nachzugeben oder sich die Beine zu vertreten und dabei den Billard-, Karten- oder Schachspielern ein wenig zuzuschauen. Am Morgen las er zunächst einmal die kleinformatige Boulevardpresse, dann kamen die seriösen Tageszeitungen dran. Nach dem Mittagessen half ihm eine bunte Illustrierte bei der Verdauung. Am späteren Nachmittag blätterte er sich noch durch die ausländischen Journale, außerdem studierte er um diese Zeit meist ein Buch, das er stets aus seiner Wohnung mitnahm. Dazwischen ließ er sich durch Musik auf seinem MP3-Player berieseln, um die Augen zu schonen, oder er hörte anderen Kaffeehausbesuchern bei ihren Gesprächen zu. Das tat er besonders gern, mischte sich jedoch nie ein, denn er scheute die Kommunikation mit anderen Gästen.
Zur Stoßzeit, wenn die Leute von der Arbeit nach Hause gingen oder fuhren, blickte Kubista mit Begeisterung hinaus auf die belebte Straße. Jetzt war alles in Bewegung, lief hierhin und dorthin, kam näher oder entfernte sich. Dieses Treiben faszinierte ihn, besonders deswegen, weil er alles als Zaungast aus einem eigenen Kosmos heraus betrachten konnte, fein säuberlich abgetrennt vom hektischen Geschehen. Immer wieder hielt er einzelne Szenen in einem Heft fest, das er ständig bei sich trug, manchmal sogar in Form eines kleinen Gedichts.
Kubistas Speisen- und Getränkeplan für den Tag war wenig abwechslungsreich. Wenn er am Morgen kam, frühstückte er ausgiebig: zwei Eier im Glas, eine Buttersemmel, ein Kännchen Tee. Später am Vormittag gönnte er sich eine Melange, zu der er eine große Flasche Mineralwasser bestellte, die er bis zum Abend austrank. Zu Mittag nahm er das Tagesmenü mit einer Flasche Bier zu sich, gegen 4 Uhr nachmittags trank er eine weitere Melange und aß einen von Frau Hellers vielgerühmten Blechkuchen. Zum Nachtmahl gab es entweder Würstel, Spezialtoast (Schinken-Käse), oder eine Eierspeis, manchmal auch eine saure Wurst, dazu ein oder zwei Gläser vom weißen Hauswein. Schon bald hatte er mit Frau Heller einen Fixpreis für dieses Paket ausverhandelt, sodass er im Kaffeehaus quasi auf Vollpension ohne Übernachtung lebte.