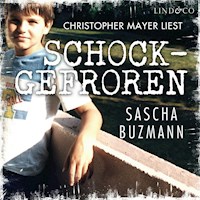9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In seinem aufrüttelnden Erfahrungsroman "Schockgefroren" erzählt Sascha Buzmann von seiner Entführung durch Adam Geist. 86 Tage dauerte Buzmanns Martyrium in Geists Wohnwagen in Mainz. Körperliche und sexuelle Gewalt, die Angst um das eigene Leben sowie die seelischen Grausamkeiten beschreibt er in diesem Roman hautnah, ungeschönt und doch mit der nötigen Distanz.
"Schockgefroren" ist eine Abrechnung mit dem Täter und ein Tatsachenroman, der versucht, das Unsagbare aus der Ich-Perspektive im Präsens im Worte zu fassen. Und der verlorenen Kindheit eine Stimme zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
SASCHA BUZMANN
In Zusammenarbeit mit Daniel Oliver Bachmann
SCHOCK GEFROREN
Wie ich 86 Tage in der Gewalt meines Entführers überlebte
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Das Buch beruht auf wahren Begebenheiten. Zum Schutz der Rechte der Personen wurden einige Namen, Orte und Details verändert.
Originalausgabe
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gabriele Ernst, Icking
Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck Büro für Gestaltung, Berlin
Umschlagmotiv: Sascha Buzmann 2011 bei seiner Rückkehr an den Tatort. © Andreas Varnhorn, Bad Vilbel
Umschlagmotiv Kinderfoto Sascha Buzmann: © privat
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-1986-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Buch der Psalmen, Psalm 23
Inhalt
1. Entführung2. Überleben3. BefreiungDie Welt ist gefährlich, und ich war nicht darauf vorbereitet.
1. Entführung
Die Zeitungen werden später schreiben, dass an diesem 9. Januar 1986 ein Schneesturm tobte. Aber es ist nur für die Erwachsenen ein Schneesturm; für mich, einen kleinen Jungen von neun Jahren, ist es ein Wintermärchen. Schneeflocken, groß wie mein Handteller, fallen vom Himmel. Sie bedecken mich, bedecken die Straße, die Bäume, die Häuser, sie bedecken die ganze Welt. Eben bin ich aus dem Bus ausgestiegen. Von der Haltestelle bis zu meinem Elternhaus sind es keine 200 Meter. Als ich losstapfe, denke ich daran, dass meine Fußstapfen in kurzer Zeit nicht mehr da sein werden. Sie werden vom Schnee bedeckt sein, der alle Spuren beseitigt und alle Geräusche dämpft und die ganze Erde in eine Zauberwelt verwandelt.
Ein Schneemann bleibt, denke ich. Ich sollte einen Schneemann bauen.
Ich knie nieder und sehe meinen Händen zu, wie sie weit ausholen, um genug Schnee für eine große Kugel einzufangen. Mein Schneemann soll so groß sein wie ich, nein, größer will ich ihn, mindestens doppelt so groß. Ich bin 1,33 Meter, und ich überlege mir, wie ich einen Schneemann bauen kann, der doppelt so groß ist. Vielleicht mit einem Stuhl, vielleicht, wenn ich einen Stuhl hole und darauf stehe? Ich bin gefangen in meinem Spiel, bin in einer anderen Welt, in einer unschuldigen Kinderwelt. Ich denke an meinen Schneemann und dass ich eine Möhre für seine Nase möchte und zwei Kohlenstücke für die Augen. Und einen Hut; natürlich, mein Schneemann braucht einen Hut, und in der Hand hält er einen Besen, so wie es sich gehört. Ich denke daran, wie sich meine Schwester freuen wird, wenn sie heimkommt, und meine Eltern und alle Leute, die bei uns im Haus wohnen, sobald sie aus der Tür treten und mein Schneemann sie begrüßt. Ich forme die Schneekugel noch größer und überlege mir, dass ich zwei weitere brauche …
Ich sehe den Mann nicht kommen. Ich höre ihn auch nicht, der Schnee dämpft seine Geräusche. Er packt mich brutal, sein Arm legt sich um meinen Hals. Er würgt mich, ich schnappe nach Luft. Er sagt etwas, aber ich verstehe ihn nicht. Er zerrt mich mit sich. Wie einen Sack zerrt er mich mit sich. Meine Beine sind frei, ich strample, ich wehre mich, aber er ist stärker, er ist so viel stärker als ich. Er schleppt mich zum Gebüsch neben unserm Haus. Schnee dringt unter meine Jacke, während der Mann mich ins Gebüsch schleift, und dann ist er auf mir. Sein Atem stinkt, sein Gesicht ist ganz nahe, zu einer Fratze verzerrt, er versucht, seinen Mund auf meinen zu drücken. Wieder strample ich und schlage nach ihm, aber er legt sich mit seinem ganzen Gewicht auf mich. Es ist, als wolle er mich erdrücken. Ich bekomme keine Luft und öffne panisch den Mund, und da drückt er seinen darauf, und alles, was man von mir hören kann, ist ein ersticktes Gurgeln.
Niemand kann das hören. Niemand kann uns sehen. Es schneit in dicken Winterzauberflocken, und die Erwachsenen sind zuhause, auch meine Eltern sind zuhause, keine zwanzig Meter von mir entfernt, getrennt durch die Hauswand, ein Gebüsch und einen Fremden, der mich jetzt packt und hinter sich herschleppt.
Ich muss sterben, denke ich. Der bringt dich um.
Panik überkommt mich. Meine Beine versagen ihren Dienst, und ich stolpere, aber der Mann reißt mich hoch. Er beschleunigt seine Schritte, sein Griff um meinen Arm ist wie ein kaltes Stück Eisen. Verzweifelt drehe ich den Kopf. Da sehe ich das helle Licht aus dem Küchenfenster unserer Wohnung scheinen, und in dem Lichtkegel steht mein Vater. Ich will schreien, will ihn auf mich aufmerksam machen, aber der Mann zischt: »Kein Wort, oder du bist tot.« Der Schrei erstickt in meiner Kehle. Jetzt sind wir schon dreißig Meter vom Haus entfernt, vierzig Meter, fünfzig Meter, hundert Meter. Vor uns liegt ein weites, schneebedecktes Feld. Es verliert sich am Horizont, wo Erde und Himmel im Schneesturm zu einem unbestimmten Etwas verschmelzen. Darauf läuft der Fremde zu. Mich schleift er mit sich, als sei ich eine leblose Puppe.
Das alles dauert keine fünf Minuten. Es ist der Beginn eines Martyriums, das 86 Tage dauern soll. Es ist der Beginn meines Martyriums. Noch nie musste ein Kind in Deutschland so lange in der Gewalt eines Sexualtäters ausharren. Und auch nach meiner Befreiung ist das Martyrium für mich nicht vorbei. Es dauert bis heute an, auch wenn ich vieles vergessen habe.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe nichts vergessen. Es muss heißen: Das Martyrium dauert bis heute an, aber ich habe die Erinnerungen daran, so weit es mir möglich war, verdrängt.
25 Jahre später klingelt es an meiner Tür. Wieder ist Januar, wieder tobt draußen ein Schneesturm. Den Winter von 2010 werden die Menschen so schnell nicht vergessen. Schneereich ist er und eiskalt, und einige sprechen vom Jahrhundertwinter. In meiner gemütlichen Zweizimmerwohnung ist es mollig warm. Mein Blick geht aus dem Fenster hinüber zu den Höhen des Taunus. Dahinter liegen Wiesbaden und Mainz und, keine zehn Kilometer von mir entfernt, der Ort des Verbrechens. Doch daran denke ich nicht. Daran denke ich so gut wie nie. Und wenn ich es doch einmal tue, bringe ich mich ganz schnell auf andere Gedanken. Im Moment beschäftige ich mich mit einem neuen Job. Schon geraume Zeit arbeite ich als Kellner in der gehobenen Gastronomie, und vor mir liegt ein Angebot eines Mehrsternehotels in einem österreichischen Ferienort. Ich denke darüber nach, ob ich es annehmen soll. Die Bezahlung kann sich sehen lassen, sie ist deutlich besser als in vergleichbaren Häusern in Deutschland. Dafür werden die Arbeitsbedingungen hart sein wie immer. Der Beruf eines Kellners ist kein Zuckerschlecken, wir arbeiten, wenn andere ihre Freizeit genießen. In dem Wintersportort werde ich noch mehr Schnee sehen als hier, und eigentlich bin ich kein großer Freund der weißen Pracht. Also, soll ich, soll ich nicht? Ich kann mich nicht entscheiden und überlege mir, ob ich eine Münze werfen oder die Sache einfach ein paar Tage ruhen lassen soll. Es gibt viele Dinge, die ich ruhen lasse, selten entscheide ich mich schnell. In diesem Augenblick klingelt es. Ich blicke auf meine Uhr. Es ist 9:20 Uhr, das ist keine Zeit für meine Freunde. Von meinen Eltern oder meinen vier Geschwistern, die ganz in der Nähe wohnen, hat sich auch niemand angesagt. Dann wird es wohl der Postbote sein. Ein Päckchen vielleicht, obwohl ich mich nicht erinnern kann, etwas bestellt zu haben. Ich gehe zur Gegensprechanlage und melde mich.
»Spreche ich mit Sascha Buzmann?«, klingt eine männliche Stimme blechern aus dem Lautsprecher.
»Ja«, antworte ich und denke, das steht doch an der Klingel. Mit wem außer Sascha Buzmann sollst du sonst sprechen?
Der Mann sagt: »Ich bin Journalist.« Er nennt den Namen eines bekannten deutschen Nachrichtenmagazins. »Ich würde mich gerne mit Ihnen über Ihre Entführung unterhalten.«
Mir stockt der Atem. Alles habe ich erwartet an diesem Morgen, aber nicht das. Auf gar keinen Fall, schießt es mir durch den Kopf, ganz gewiss werde ich mich nicht mit irgendeinem Fremden über meine Entführung unterhalten. Ich unterhalte mich mit überhaupt niemand über meine Entführung. Ich weiß nichts über meine Entführung, ich kann mich nicht erinnern, ich will mich nicht erinnern, lassen Sie mich in Ruhe!
Ich stehe in einer gebückten, unbequemen Haltung vor der Gegensprechanlage. Jetzt drehe ich mich um. Mein Blick schweift durch meine Wohnung. Sie ist mein kleiner, sicherer Hafen. Schön habe ich es hier, das sagt jeder, der mich besuchen kommt. Ich bin nicht reich, aber habe mir mein Zuhause gut eingerichtet. Es ist sauber. Manche sagen sogar, bei dir ist es peinlich sauber, aber so mag ich es. Sehe ich irgendwo Schmutz, greife ich zum Lappen und putze ihn weg. Leistet er Widerstand, höre ich nicht auf, bis das letzte Fleckchen verschwunden ist. Schmutz ist das Allerletzte, was ich brauchen kann, weil es damals so schmutzig war, weil dieser Mann so schmutzig war, weil ich so schmutzig war …
»Herr Buzmann? Sind Sie noch da?« Ich zucke zusammen. Für einen Augenblick hatte ich mich im Wohnwagen befunden, der 86 Tage lang mein Verlies gewesen war. Der Wohnwagen des Entführers. »Herr Buzmann?«
Nein, ich antworte nicht. Irgendwann geht der Störenfried bestimmt wieder. Er hat mich für heute schon genug aus der Bahn geworfen. Ich habe mir mein Leben mühsam aufgebaut und muss alles davon fernhalten, was mich aus dem Gleichgewicht bringt. Es gibt vieles, das mich aus dem Gleichgewicht bringen kann. Also, nicht antworten. Doch da ist auch eine Stimme, die etwas anderes sagt. Es ist 25 Jahre her, sagt sie. Ein Vierteljahrhundert. Vielleicht ist es an der Zeit, sich zu erinnern. Vielleicht ist es an der Zeit, sich den Dämonen zu stellen.
Nein! Ganz gewiss werde ich das nicht tun! Ich werde an den Tisch zurückgehen, ich werde den Arbeitsvertrag des österreichischen Hotels unterzeichnen, ich werde meinen Koffer packen, und ich werde sofort abreisen. Ich werde gar nicht erst abwarten, bis meine Arbeit beginnt, ich werde sie gleich antreten. Von mir aus unentgeltlich. Dort wird keiner an meiner Tür klingeln, dort will niemand mit mir über etwas sprechen, das so lange zurückliegt, aber mich noch immer nicht in Ruhe lässt.
Aber ich gehe nicht zurück zum Tisch. Stattdessen drehe ich mich um. Ich beuge mich hinab zur Gegensprechanlage. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verstrichen ist. Vielleicht ist der Mann an der Haustür bereits verschwunden. Dann soll es mir auch recht sein.
»Sind Sie noch da?« Meine Stimme klingt belegt. Als ob ich auf einmal erkältet bin, als ob ich ein Reibeisen verschluckt habe.
»Ja«, antwortet er. »Kann ich raufkommen?«
»Nein«, sage ich. »Werfen Sie Ihre Visitenkarte in den Briefkasten. Ich melde mich.«
Später sitze ich lange am Tisch und starre auf den Arbeitsvertrag. Ich spiele mit einem Kugelschreiber in der Hand, aber setze nicht meinen Namen aufs Papier. Ich gehe auch nicht zum Briefkasten, um die Visitenkarte zu holen. Ich bleibe einfach sitzen, wie ich es oft tue. Ich kann stundenlang sitzen und vor mich hin träumen. Ich zünde mir eine Zigarette an, und als ich sie fast aufgeraucht habe, zünde ich an ihrer Glut eine neue an. Irgendwann dämmert es. Es wird Abend, und als ich zur Packung greife, ist sie leer. Ich stehe auf, öffne das Fenster. Aus der Küche hole ich einen feuchten Lappen und wische die Zigarettenkrümel weg. Dann nehme ich den Briefkastenschlüssel. Langsam steige ich die Treppen hinab, jeder Schritt fällt mir schwer. Zwischen Rechnungen und Prospekten finde ich die Visitenkarte. Darauf das Logo des Nachrichtenmagazins, darunter ein Name und eine Telefonnummer. Ich drehe die Karte um. »Bitte rufen Sie mich an«, hat der Mann hinten draufgekritzelt.
Nein, das tue ich nicht.
Ich habe schon jetzt zu viel getan.
Dann greift meine Hand trotzdem zum Telefon. Das macht sie einfach so, ohne mein Mittun. Meine Finger wählen die Nummer auf der Karte, auch das machen sie ohne mein Mittun. Irgendwie hat sich mein Denken verabschiedet, diese Kontrollinstanz, die seit ewiger Zeit dafür sorgt, dass mich die Vergangenheit nicht ständig aufs Neue quält. Als ich heute Morgen aufstand, gab es keinerlei Anzeichen, dass sich das heute ändern soll. Aber so ist es. Ab heute wird alles anders sein.
»Hallo«, sagt der Reporter.
»Hier ist Sascha Buzmann. Wollen Sie mich noch immer sprechen?«
Für einen Augenblick herrscht verblüffte Stille. Dann sagt er: »Ich freue mich, dass Sie es sich anders überlegt haben.«
Habe ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe nur einen ersten Schritt getan, der mich aus der Isolierung führen soll. Er wird mich mit meiner Vergangenheit konfrontieren. Hätte ich gewusst, wie schmerzhaft das Erinnern ist, hätte ich es vielleicht nicht getan. Aber davon weiß ich in diesem Augenblick nichts. So wenig, wie ich vor 25 Jahren nichts von der kranken Welt der Erwachsenen wusste.
Er bringt dich zum See, schießt es mir durch den Kopf. Er wird dich ersäufen!
Im Schneesturm kann ich nicht genau erkennen, wo wir sind. Dort hinten muss der Golfplatz liegen, da gibt es einen kleinen See. Er will mich hinbringen und mich ins Wasser werfen und meinen Kopf runterdrücken, so lange, bis meine Beine und Arme aufhören zu zappeln, bis ich still bin. Das wird er tun, weil ich jetzt nicht still gewesen bin, weil ich etwas gesagt habe, weil ich gesagt habe: »Ich bin doch ein Junge!«
»Ich bin kein Mädchen! Ich bin ein Junge!« Das sagte ich im Gebüsch. Als er seinen Mund auf meinen presste. Als er mich küssen wollte. Dort im Gebüsch wurde mir auf einmal klar, dass ich den Mann schon einmal gesehen habe. Vorhin im Bus. Da hat er mir Blicke zugeworfen. Oder vielleicht auch Katrin. Katrin sitzt neben mir in der Linie 25, weil meine Schwester Jenny es so will. Wir haben die letzten Stunden mit Rollschuhfahren verbracht, in der Rollschuhdisko »Roll On« in Wiesbaden-Biebrich. Da treffen sich Leute, die Hip-Hop machen oder Breakdance oder Graffiti sprühen. Aber auch wir Kleinen dürfen zur Musik unsere Runden drehen. Weil ich ganz vernarrt ins Rollschuhlaufen bin, muss Jenny ein Auge auf mich haben. Obwohl sie mit ihren sechzehn Jahren auch andere Dinge im Kopf hat, tut sie das ganz gewissenhaft. Aber sie darf länger bleiben, während ich nach Hause muss, wenn es am Schönsten ist. Mit Mama und Papa hat Jenny ausgemacht, dass sie mich zu ihrer Freundin Katrin in den Bus setzt. Das haben wir schon häufig so gemacht, daher weiß ich, wenn Katrin in Wallau aussteigt, muss ich noch fünf Stationen weiterfahren. Als wir in den Bus steigen, bemerken wir den Mann. Er sieht verwahrlost aus, wie einer der Bettler, die ich bei einem Ausflug in Wiesbaden am Bahnhof sah. Sein Bart ist lang und struppig, seine Haare fallen in fettigen Strähnen herab. Katrin und ich suchen uns eine freie Sitzbank ein paar Meter von ihm entfernt.
»Guck nur, wie der aussieht«, flüstert Katrin. Dann vergessen wir den Mann. Katrin fragt mich, was ich zu Weihnachten gekriegt habe, und ich schwärme ihr von meinen Geschenken vor. »Masters-of-the-Universe-Figuren«, erzähle ich stolz. »He-Man und Skeletor. Und die Burg.« Katrin lacht. Ich mag sie, weil sie immer fröhlich ist. »Hast du den Typen beim Rollschuhlaufen gesehen?«, fragt sie. »Der sah auch aus wie He-Man.«
Wir überlegen uns, wann wir das nächste Mal ins »Roll On« können. Ich übe Sprünge und Rückwärtsfahren und bin begierig darauf, Fortschritte zu machen. Mit dem Finger zeichne ich He-Man mit Rollschuhen auf die angelaufene Fensterscheibe. Dahinter sehe ich das Wirbeln der Schneeflocken. »Heute schneit es nur einmal«, sagt Katrin. »Ich muss jetzt aussteigen. Mach’s gut, Sascha.«
Wir sind in Wallau angekommen. Der Bus hält, Katrin steht auf, und mit ihr steigt eine Handvoll Menschen aus. Als ich mich noch einmal nach ihr umdrehe, sehe ich wieder den Mann mit dem wilden Bart. Er starrt mich an, aber ich achte nicht darauf. Viel mehr denke ich darüber nach, was Mama wohl zum Abendessen macht. Nach dem Rollschuhlaufen komme ich immer mit einem Bärenhunger nach Hause. Die nächsten fünf Haltestellen nehme ich gar nichts mehr wahr. Dann hält der Bus, und ich steige aus, wo ich schon so oft ausgestiegen bin: in Wiesbaden-Delkenheim. Ich gehe vor zum Busfahrer. Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass der verwahrloste Mann im Mittelausgang den Bus verlässt, aber mache mir keine Gedanken darüber. Die bunten Lichter des Supermarktes neben der Haltestelle fallen mir auf, weil darin die Schneeflocken so schön tanzen.
Am Laden vorbei führt mein Weg zum Spielplatz. Von dort sind es nur noch ein paar Schritte nach Hause. Als ich losmarschiere, habe ich auf einmal ein seltsames Gefühl. Es ist, als sei ich … als wäre etwas … nein, ich kann es nicht einordnen. Aber das Gefühl zwingt mich, stehen zu bleiben und mich umzudrehen. Da sehe ich den Mann mit dem wirren Bart, wie er ebenfalls stehen bleibt und sich umdreht. Der Busfahrer schließt die Türen und fährt los. Die Leute, die mit uns ausgestiegen sind, sind schon in Richtung Supermarkt verschwunden oder gehen über die Straße in die andere Richtung. Bei diesem Wetter hat es jeder eilig, nach Hause zu kommen. Nur der Mann und ich sind noch in der Nähe der Haltestelle. Ich bücke mich, forme einen Schneeball und werfe ihn in die Luft. Das bringt mich auf andere Gedanken. Kann ich einen Schneeball so hoch werfen, dass er im Himmel verschwindet? Wenn er das tut, wird er dann irgendwann wieder herabfallen? Ich mache den nächsten Schneeball, und während ich loslaufe, werfe ich ihn, so weit ich kann. Schon ist der nächste Schneeball dran. Und der nächste. Als ich den Spielplatz erreiche, habe ich den Fremden vergessen. Rund um den Platz stehen Laternen. Als ich sie erreiche, nehme ich seitlich von mir einen Schatten wahr. Er bewegt sich ganz langsam. Wieder kommt das seltsame Gefühl auf. Auf einmal höre ich eine Stimme in meinem Kopf. Es ist die Stimme meines besten Freundes Thorsten. Er sagt: »Das hat dich!« Ich wirble herum. Der Schatten ist verschwunden.
»Das hat dich!«, höre ich Thorsten noch einmal sagen, und jetzt ist es, als sei er neben mir. Dabei ist es ein halbes Jahr her, als er diese seltsamen Worte sprach. Es war mitten im schönsten Sommer gewesen, wir streunten mit seiner Schwester durch den Sauerkirschhain in der Nähe unserer Siedlung und schwärmten von den Kirschen, die wir uns einverleiben wollten.
»Schau doch, dort!«, sagte Thorsten plötzlich. Vor uns lag ein Kadaver. Er war halb verwest, und es war nicht mehr auszumachen, um was für ein Tier es sich gehandelt hatte. Es könnte ein kleiner Fuchs gewesen sein, einer von denen, die sich immer über die Mülltonnen hermachten. Oder ein Wiesel oder ein Siebenschläfer. Oder eine große Ratte. Das Fell war von Maden überzogen. Die Augen starrten leblos vor sich hin. Ein Fliegenschwarm hockte auf dem Kadaver und stob davon, als wir näher traten.
»Wie eklig!« Thorstens Schwester wandte sich ab, doch wir waren neugierig und kamen noch einen Schritt näher. Auf einmal hob Thorsten den Fuß und trat mit Wucht in den Kadaver. Es gab ein unheimliches Geräusch, als er aufplatzte und überall Gedärm herausspritzte. Es stank fürchterlich. In mir stieg ein Würgereiz auf.
»Das hat dich!«, sagte Thorsten.
Ich bekam es mit der Angst zu tun. »Was meinst du damit?«, fragte ich. »Was hat mich?«
»Das da. Das hat dich!«, wiederholte er. Seine Stimme zitterte. Wir sahen uns an, und dann sagte er: »Ich muss nach Hause.«
Bevor ich antworten konnte, rief er seine Schwester, und die beiden liefen davon. Ich warf einen Blick auf den zerquetschten Kadaver. Die Fliegen ließen sich auf den Innereien nieder, der Gestank wurde immer schlimmer.
»Warum hast du das getan?«, fragte ich leise, aber da war keiner mehr, der die Frage beantworten konnte. Plötzlich hatte ich ebenfalls das Gefühl, weglaufen zu müssen. So schnell ich konnte, rannte ich nach Hause, aber der Satz »Das hat dich!« lief mit. Und jetzt ist er wieder in meinem Kopf. Ich schaue nach links, ich schaue nach rechts, aber der Schatten ist verschwunden. Ich lache über mich. Du bist einfach immer zu ängstlich, sage ich zu mir. Da sehe ich auch schon unser Haus und weiß, dass Mama und Papa auf mich warten. Mein Hunger treibt mich darauf zu. Die Flocken tanzen noch immer so schön, und für einen Moment vergesse ich meinen Mordshunger wieder. Ich vergesse auch den Schatten, vergesse den fremden Mann. Der Schnee fällt jetzt so dicht, dass er meine Fußstapfen in Windeseile verdeckt.
Ein Schneemann bleibt, denke ich. Ich sollte einen Schneemann bauen.
Ich bücke mich, um eine Kugel zu formen. Auf einmal spüre ich einen Arm, der sich fest um meinen Hals legt.
»Schrei nicht!«, droht der Mann, der mich mit sich zieht. »Oder dir passiert was.«
Tränen rinnen mir über das Gesicht, ich kann sie nicht zurückhalten. Ein heißer Sturzbach im eisigen Wintersturm.
»Ich schreie nicht«, presse ich hervor. Wir haben den Golfplatz erreicht, ich kann den See vor mir sehen. Ich muss mich befreien, fährt es mir durch den Kopf, ich muss abhauen, ich muss nach Hause! Die Hand des Mannes umklammert mein Handgelenk. Ungestüm rennt er weiter. Ich stolpere immer wieder, aber er lässt mich nicht los. Er lässt mich niemals los.
»Bitte, lieber Gott«, flüstere ich, »ich will nicht sterben!« Ich versuche meinen Arm zu drehen, vielleicht gelingt es mir so, mich aus der Umklammerung zu befreien. Ich könnte über das Feld davonrennen, im Schneegestöber sieht mich der fremde Mann vielleicht nicht. Wenn ich dorthin zurücklaufe, wo wir hergekommen sind, kann ich in fünf Minuten unser Haus erreichen. Mein Papa wird herauskommen und den fremden Mann davonjagen. Wenn es mir nur gelingt, den Griff zu lösen, diese Finger, die sich in meinen Arm bohren. Ich stolpere wieder, und der Mann reißt mich brutal auf die Beine. »Weiterlaufen! Los!«, zischt er mich an. »Wehe du schreist, dann …«
Sein Mund ist ganz nah, sein schlechter Atem bereitet mir Übelkeit. »Hör auf zu heulen«, herrscht er mich an, aber das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ich kann mitlaufen, ich kann mich auf den Beinen halten, aber ich kann die Tränen nicht stoppen, die mir über die Wangen laufen und im kalten Wind gefrieren. Noch einmal drehe ich meinen Arm, will mich aus dem Klammergriff befreien. Den Schlag sehe ich nicht kommen. Er trifft mich am Kopf, genau überm Ohr. Ein stechender Schmerz durchfährt mich.
»Keine Mätzchen«, sagt der Mann. »Oder es setzt was. Du wirst jetzt schön weiterlaufen.« Der Weg führt hinab zum See. Ich kann sehen, wie der Uferbereich zugefroren ist.
»Das hat dich«, durchfährt mich die Stimme von Thorsten. »Das hat dich, und es wird dich töten!« Wieder bete ich zu Gott. »Bitte, bitte! Ich will nicht sterben!« Auf einmal ist da eine andere Stimme, und sie ist direkt in meinem Kopf. »Er wirft dich nicht in den See«, sagt sie. »Aber wenn du wegläufst, fängt er dich und erschlägt dich mit einem Stein.«
Im selben Augenblick weiß ich, dass es Gott ist, der mit mir spricht. Ich bin neun Jahre alt, ich habe keine Ahnung, wer Gott ist und wo er wohnt, und all die Geschichten aus dem Religionsunterricht waren bisher nur Geschichten. Doch auf einmal weiß ich, dass es ihn gibt, und ich weiß, dass er mit mir spricht. Er kann das tun, ohne die Stimme zu erheben. Sie ist in meinem Kopf, und sie ist klar und deutlich. »Wenn du wegläufst«, sagt sie nochmals, »fängt er dich und erschlägt dich mit einem Stein.«
Ich muss nicht sprechen, um mich mit der Stimme zu verständigen. Ich muss nicht sprechen, um mit Gott zu reden. »Wenn ich nicht abhaue«, fragen meine Gedanken, »komme ich dann wieder nach Hause?« Ich lausche, aber erhalte keine Antwort. »Komme ich wieder nach Hause???« Jetzt schreie ich innerlich, aber erhalte noch immer keine Antwort.
»Bitte, lieber Gott!!! Gib mir ein Zeichen!!!«
In meinem ganzen Leben habe ich noch nie eine solche Verzweiflung gespürt. Sie lässt sogar meine Tränen versiegen. Wir sind jetzt am See, der Mann bleibt stehen. Ich schaue zu ihm auf, aber etwas über ihm lenkt mich ab. Über ihm wird es hell, und dann sehe ich es: Eine Sternschnuppe saust über den Himmel. Nie zuvor habe ich ein helleres Licht mitten in der Nacht gesehen. Auch der Mann hebt den Kopf. Für einen Augenblick lockert sich sein Griff. Da kommt die Stimme wieder: »Nicht weglaufen! Er kriegt dich und erschlägt dich mit einem Stein.«
Die Sternschnuppe verglüht am Horizont. Es wird wieder dunkel, und es ist, als sei sie nie da gewesen. Doch für mich ist die Schnuppe ein Zeichen. Ein Zeichen, das sagt: »Vertraue mir.«
»Wo geht es nach Hochheim?«, fragt der Mann unvermittelt. »Weißt du es?«
»Ja«, antworte ich. »Ich kenne den Weg.«
Die Welt ist ein seltsamer Ort. Während ich in meiner kleinen Wohnung lebe, meiner Arbeit nachgehe und versuche, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen, gibt es da draußen Menschen, die das Gegenteil tun. Sie suchen Geschichten fremder Leute, und wenn sie etwas gefunden haben, machen sie sich auf den Weg. Sie legen weite Strecken zurück und klingeln an fremden Türen. Sie sagen: »Ich würde mich gerne mit Ihnen über Ihre Entführung unterhalten.« Ich weiß nicht, ob sich diese Menschen darüber im Klaren sind, was sie damit auslösen. Sie sagen: »Ihre Geschichte darf man nicht vergessen.« Und wahrscheinlich haben sie recht. Dabei habe ich immer wieder versucht, meine Geschichte zu vergessen, und vielleicht wäre es mir eines Tages auch gelungen. Doch es soll anders kommen. Wie es in meinem Leben immer anders kommt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!