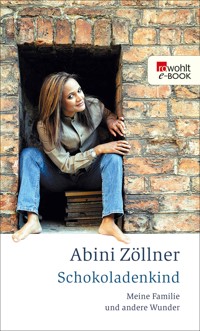
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vom Anderssein im Osten und vom wunderlichen Westen: Eine außergewöhnliche Frau erzählt. Wie lebte es sich in der DDR, wenn der Vater Afrikaner und die Mutter Jüdin ist? Mit viel Humor und souveräner Offenheit erzählt Abini Zöllner von ihrer Jugend im Osten und den Erfahrungen im Westen, ihrer turbulenten Ehe mit dem Musiker Dirk Zöllner und einer besonderen Mutter-Tochter-Beziehung, von mittleren Katastrophen und von kleinen Wundern. Abini Zöllners Leben ist reich an immer neuen Wendungen: Sie lernt Friseurin, weil sie nicht studieren möchte, jobbt als Model, tanzt im Friedrichstadt-Palast, schauspielert und wird schließlich Journalistin. Sie erzählt von ihrer ungewöhnlichen Geschichte und vom Lebensgefühl des jungen Berlin vor und nach der Wende. «Eine außergewöhnliche Frau mit einer ganz speziellen Sprache.» (Johannes B. Kerner) «Sie beschreibt sehr ironisch, mit einer wunderbaren Genauigkeit und Distanz den Alltag in der DDR.» (ZDF, aspekte extra) «Lebenslust pur.» (Petra) «Abini Zöllner erinnert kurzweilig daran, wo und wie wir mal gelebt haben.» (Thüringer Allgemeine) «So seltsam das Leben auch sein mag, Abini Zöllner hat sich köstlich amüsiert.» (Welt am Sonntag)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Abini Zöllner
Schokoladenkind
Meine Familie und andere Wunder
Für das raffinierteste Rätsel,
die kostbarste Erfahrung
und das schönste Vergnügen
– für meine Familie.
1 Die Regeln meiner Schule
Ich mag keine Kneipen oder Bars. Nach einer halben Stunde werde ich nervös, weil ich nicht länger auf den Stühlen sitzen kann und daran denken muss, dass sie mir schon viel zu lange viel zu hart sind. Und Alkohol schmeckt mir auch nicht, nicht einmal Kaffee, erst recht nicht in dieser verrauchten Luft. Ich gehe gern in Restaurants, um etwas zu essen, darin kann ich einen Sinn sehen, aber in Kneipen, in denen man nur trinkt, raucht, redet, sehe ich keinen. Das sagt mir mein Verstand.
Ich gehe also nicht gern in Kneipen, und das ziemlich oft. Dann sitze ich stundenlang auf den harten Stühlen, trinke Wein, rauche Zigaretten und bestelle mir zum Schluss einen Kaffee. Es ergibt keinen Sinn. Mein Gefühl meint, es wäre aber auch sinnlos, immer sinnvoll zu leben, um eines Tages sinnvoll zu sterben. Wäre es auch.
Da sitze ich wieder in einer Kneipe, halte mich an meinem Glas fest und schaue in das hypnotische Flackern der Kerze.
Plötzlich macht die Zeit einen Sprung.
Mamel fühlte sich einerseits total erschöpft und andererseits völlig entkräftet. Nie zuvor in ihrem Leben war sie so glücklich gewesen. Mit einem großen Schalom nahm sie mich in die Arme. Zum Arzt sagte sie, dass der Weg ins gelobte Land gegen diese Geburt ein Spaziergang gewesen sein muss.
Sie hatte keine leichte Entbindung, als sie mit zweiundvierzig Jahren ihr erstes Kind bekam, obwohl ich mein Bestes gegeben habe. Mit größter Vorsicht arbeitete ich mich durch den Geburtskanal, bis ich den Arzt sah. Ich lächelte ihn so charmant wie möglich an, er aber packte mich an den Beinen, gab mir einen Klaps, und Mamel freute sich, als ich vor Schmerz aufschrie. So landete ich in einer absurden Welt.
Immerhin war ich ein Sonntagskind. Doch Mamel ging in Sachen Glück lieber auf Nummer sicher und nannte mich auch noch Abini, was auf Deutsch «Du bist mein mir vom Himmel geschickter Anteil» bedeutet. Kaum hatte sie das Göttergleiche vermenschlicht, fing sie an, das Menschliche zu vergöttern: «Herr Doktor, sehen Sie nur, eine afrikanische Stirn. Mein Kind hat eine afrikanische Stirn.» Dann küsste sie mich mehrere Male auf den Kopf und versprach, immer auf mich aufzupassen.
Das Versprechen hat sie bis heute gehalten.
Mein Vater, der vor dem Kreißsaal stundenlang gewartet hatte, stürmte nach der Entbindung herein und umarmte uns. Er freute sich über seine kleine Tochter mit dem nigerianischen Namen und sagte, dies sei der schönste Tag seines Lebens, das müsse er feiern. Mamel wusste, dass er nun fremdgehen würde, und nahm es als Zeichen seiner echten Freude. Das waren meine Eltern.
Auf mich wartete eine gut behütete Jugend: Mamel schützte mich davor, der Vernunft zum Opfer zu fallen, die DDR schützte mich davor, die Welt kennen zu lernen, Gott schützte meine Familie vor materiellem Wohlstand, und mein Vater schützte mich vor dem Glauben, Reis dürfe nicht klumpen.
Ich war ein jüdisch-yorubanisches Gemisch, und es war bereits mehr als ein Jahr vergangen, ohne dass ich den Segen irgendeines Gottes erhielt. Dann endlich entschieden sich meine Eltern, und ich wurde getauft, protestantisch. Auf dass alle, gleich, an welchen Gott sie glauben, nicht verloren werden – so jedenfalls verstand ich später meinen Taufspruch.
Zu meiner Taufe kamen meine Tanten und Onkel, die eigentlich nicht meine Tanten und Onkel, sondern die Freunde meiner Eltern waren. Echte Verwandte hatte ich nicht, keine Oma, keinen Opa, keine Schwester, keinen Bruder und eben auch keine Tanten oder Onkel. Die Freunde meiner Eltern waren unsere Familie. Und wie echte Tanten und Onkel stellten sie im Laufe der Jahre bei jedem Wiedersehen fest, «wie schnell die Zeit vergangen» sei.
Als ich «seit dem letzten Mal schon wieder so gewachsen» und aus mir «langsam eine kleine Dame» geworden war, etwa um diese Zeit wurde ich eingeschult. Bis dahin allerdings hatte ich eine unbekümmerte Kindheit. Mamel liebte mich wie ein kleines Wunder, und wir lebten wie im großen Vergnügen. Aus wenig viel zu machen gehörte gewissermaßen zu ihren leichtesten Übungen.
Wir wohnten in einer beengten Altbauwohnung, in der das eine Zimmer fünfzehn und das andere acht Quadratmeter groß war. Im Grunde war alles zu winzig, aber Mamel sagte: «Wir haben ein Bad und eine Innentoilette, einen Balkon, auf dem wir frühstücken können, und hohe Pappeln vor den Fenstern. Das ist doch was.» Ja, das war was. Das war sogar genug, um es als Komfort auszulegen. Wie töricht wäre es da gewesen, sich an der Ofenheizung zu stören. Wir hatten genügend Phantasie, unsere Wohnung als echten Glücksfall zu empfinden.
Im Wohnzimmer stand ein alter Schrank aus schwarzem Ebenholz, den Mamel aus China mitgebracht hatte. Er war ein geschnitztes Meisterwerk, auf das sie nicht verzichten wollte, weil viele Erinnerungen daran hingen. Für ihn gab es leider keinen richtigen Platz, weshalb er zwischen die kantige Zeulenroda-Schrankwand und die robuste Sitzgarnitur gequetscht worden war. Eigentlich hätte das schöne Stück inmitten dieser Formlosigkeit verschwinden müssen. Aber es verschwand nicht. Und darum passte es so gut zu Mamel: Beide konnten die Verhältnisse um sich herum ignorieren und so tun, als sei das hier ein gemütliches Nest. Und wenn Mamel und ihr Schrank schon so taten, dann glaubte ich es auch.
Ich wusste schließlich nicht mehr, was schöner war – unsere zu kleine Wohnung oder unsere zu formlose Einrichtung. Ich wusste nur, dass hier unser Nest war. Sobald Mamel beim Abendbrot mit Kerzen Stimmung verbreitete, Schnittchen servierte und zeremoniell den Tee aufbrühte, wurde uns so heimelig, dass wir darüber vergaßen, wie schnell unser wackliger Esstisch im Wohnzimmer unter dem Abendbrot zusammenbrechen konnte.
Dieses Malheur wiederholte sich oft, und wir arrangierten uns allmählich damit. Bis es regelrecht zum Ritual gehörte, dass der Tisch bei kleinsten Erschütterungen nachgab. Deshalb stellten wir das Essen immer vorsichtig ab und rückten noch vorsichtiger mit den Stühlen heran. Mamel hätte nie von mir verlangt, beim Essen die Hände auf den Tisch zu tun. Hätte sie nie. Das war zu gefährlich.
Wenn ich nach dem Essen mein Abendgebet sprach, habe ich prinzipiell den lieben Gott gefragt, ob er nicht «auch mal bitte unseren Tisch reparieren» könnte. Hat er nicht gemacht. Habe ich nie gemerkt, dass er es nicht gemacht hat. War also nicht wirklich schlimm.
Und wenn Mamel mich mit den Worten «Jetzt geht’s zum Federball» ins Bett brachte, erzählte sie fast nie Gutenachtgeschichten. Sie dachte sich viel lieber Lieder aus. Jedenfalls solange ich mich nicht dagegen wehrte. Oft sang sie dieses Lied: «Als ich ein Kind noch war/da sagte ich/Mama sag an:/Ist ein Prinzesschen schöner als ich/da sagte Mama dann:/Was kann schöner sein/viel schöner als Gut und Geld/für mich gibt’s auf dieser Welt/nu-hur dich allein.» Sie sang mit einer solchen Inbrunst, dass ich selbstverständlich annahm, das Lied sei von ihr. Wie lieb sie mich doch hatte.
Eines Tages durfte ich länger aufbleiben und sah mit Mamel einen Film, im Fernsehen lief «Der Mann, der zu viel wusste». Und da sang Doris Day «Que sera, sera/Whatever will be, will be». Das war genau die Melodie von «Was kann schöner sein». Da war ich mächtig stolz darauf, dass sie Mamels Lied sogar in Amerika sangen. Ihr Lied.
Bevor ich sechs wurde, hatte mir Mamel nicht nur Lieder, sondern auch Manieren beigebracht. Zwar hielt ich Messer und Gabel jeweils in der falschen Hand – weil ich es bei ihr als Linkshänderin so sah–, dafür achtete sie auf die wichtigen Dinge: vor fremden Leuten zur Begrüßung einen Knicks zu machen, immer höflich zu sein, den lieben Gott nicht zu vergessen und bösen Männern im Notfall zwischen die Beine zu treten. Nun sagte sie, «Schulbildung schadet nicht, wenn du dir später die Mühe machst, etwas Ordentliches zu lernen», und schickte mich in die Schule. Ich versprach, nur Einsen nach Hause zu bringen, damit sie stolz auf mich wäre, und freute mich, endlich ein Schulkind zu sein. Beides war, wie sich herausstellte, leichtfertig.
Meine Schule lag in Berlin-Lichtenberg. Das alte, ehrwürdige Backsteingebäude war nicht so blass wie die Neubauschulen, sondern schimmerte in einem warmen Rot. Es hatte verspielte Giebel, riesengroße Fenster und eine gewaltige Eingangstür. Ich fand es schön, dass meine Schule anders war, sie war mir sympathisch, mindestens ein Vierteljahr lang.
Aber meine Schule war so anders als andere, dass ich es bald gar nicht mehr fassen konnte und heute kaum mehr glauben mag. Sie fing an, mich zu erziehen, mit frommeren Regeln, als ich sie bis dahin vom Allmächtigen kannte. Die christliche Lehre war bald nur noch eine religiöse Übung, die Schule dagegen eine religiöse Wahrheit. Hier waren die Gebote Verbote, die meisten Regeln Untersagungen und Tabus.
So lehrte uns schon die Eingangstür das Fürchten, denn sie wurde fünf Minuten vor acht zugesperrt, obwohl der Unterricht erst um acht Uhr begann. Jeden Morgen sammelten sich ein paar hilflose Schüler vor der verschlossenen Tür. Dahinter stand ein Lehrer, der grinsend in ihre abgehetzten Gesichter schaute. Selbst wer drei Minuten vor acht kam, wurde erst zehn nach acht hineingelassen. Man sollte richtig zu spät kommen und daraus lernen. Das war die erste Regel.
Ausgerechnet 1973, als die Weltfestspiele Ostberlin beinah in eine tolerante Stadt verwandelt hatten, kam ich in diese schöne, aber völlig absurde Schule. Sie hatte gerade den Namen Horst-Viedt-Oberschule erhalten. Horst Viedt war, wie man uns erklärte, ein deutscher Soldat, der knapp vor Kriegsende zur Roten Armee überlief und am 6.Mai 1945 fiel. Ich dachte, was Sechsjährige denken: So was Blödes, hätte er sich zwei Tage versteckt, dann wäre der Krieg zu Ende gewesen und er würde noch leben. Horst Viedt tat mir wahnsinnig Leid. Doch ich lernte bald, dass unsere Schule kein armes Schwein und keinen bemitleidenswerten Soldaten, sondern einen mutigen Antifaschisten ehrte. Die zweite Regel lautete: Wir sind die Erben von Horst Viedt, dem unbestritten heldenhaften Widerstandskämpfer.
Als aufrechter Jungpionier war ich wie die anderen «Immer bereit», was zuerst einmal bedeutete, etwas für seine Nächsten zu tun. In den ersten Schuljahren ging ich oft Flaschen und Altpapier sammeln, trug älteren Menschen in der «Volkssolidarität» Gedichte vor oder legte als Timur-Helfer Hand an. Die Rentner konnten sich auf mich verlassen, besonders zwei ältere Damen, für die ich einkaufen ging. Ich beschaffte ihnen Mortadella aus der Büchse, ihren Lieblings-Malzkaffee «Im Nu». (es gab auch keinen anderen), Frisches aus dem «Kombinat Industrielle Mast», Pumpernickel, der «Kuhschnappelbrot» hieß, und natürlich «Schlagersüßtafeln», die weltweit leckerste Schokolade aus Knäckebrot. Die beiden Damen – es waren Schwestern – dankten es mir, indem sie beim Abschied eine Mark in meine Tasche fallen ließen. Das war sehr nett von ihnen, dennoch half ich am liebsten unserer Nachbarin Frau Schaklewski. Die wollte ihre Kohlen hochgetragen bekommen und belohnte mich dafür immer mit fünf West-Mark. Fünf große West-Mark für einen kleinen Timur-Helfer, das war außergewöhnlich. Und ganz nebenbei überwand ich so wegen des Westgelds auch noch die Angst vor unserem Keller.
An den Pioniernachmittagen wurden dann unsere Timur-Ausweise von unserer Pionierleiterin kontrolliert, anhand der Unterschriften konnte sie sehen, wie fleißig wir waren. Und wir waren sehr fleißig, deshalb machte sie mit uns so schöne Pioniernachmittage, dass ich mich abends beim lieben Gott vollen Herzens dafür bedankte. Mein Nachtgebet klang dann so: «Lieber Gott, ich bitte dich, behüte und beschütze mich. Behüt auch Mama und Papa und alle anderen fern und nah. Dass Mama, Papa gut sich sind. Und Abini ist ein liebes Kind. Lieber Gott? Und danke für den schönen Pioniernachmittag.»
Unsere Pionierleiterin war zufrieden mit uns und meinte, Horst Viedt wäre es ebenfalls gewesen. Dennoch mussten wir für ihn durch das «Manöver Schneeflocke» robben. Wahrscheinlich, damit seine Freude perfekt wurde.
Seit ich in der vierten Klasse Thälmann-Pionier geworden war, robbte ich nicht mehr über den Schulhof, sondern fuhr in Wehrerziehungslager. Sie befanden sich in romantischen Märchenwäldern, wie ich sie vom Pilzesammeln mit Mamel kannte. Aber hier fanden Gefechtsübungen statt. In den Wehrlagern wurden wir Mädchen nicht, wie die aus anderen Schulen, lediglich als Sanitäterinnen ausgebildet. Nein, unsere Horst-Viedt-Schule erzog uns zu Soldatinnen – das «-innen» wurde uns jedoch gleich wieder abgewöhnt. Also übten wir als Soldaten an der Seite unserer Jungs Kämpfe mit dem Gegner. Wir sangen Lieder über die «Partisanen vom Amur», die «treu dem Schwur» und mit blutroten Fahnen die Eskadronen stürmten. Oder über rote Matrosen, kleine Trompeter und die internationale Solidarität. Es gab unzählige Lieder zu singen, aber es gab nur einen Eid zu schwören: den, die Heimat zu verteidigen. Und das ging offensichtlich nur, wenn die Gewehre sprachen.
Doch wenn die Gewehre schwiegen und wir nicht Horst Viedt gedachten, waren wir wie andere Kinder auch. Grob und gemein, schadenfroh und abenteuerlustig. Naiv genug, etwas Ferienlagerstimmung aufkommen zu lassen, trafen wir uns heimlich hinter den Baracken und redeten uns ausnahmsweise nur mit unseren Namen an. Es war uns ein Vergnügen, dann nicht Kamerad zu heißen, sondern Anke, Elvira, Stefan, Torsten, Mike oder Abini.
Dabei mussten wir unsere Treffen streng geheim halten und ganz besonders vorsichtig sein, denn unsere Lehrer wachten feldwebelhaft über die Lagerordnung. Zu ihrer Verstärkung teilten sie Diensthabende ein, Kinder, die Nachtwache schieben mussten und – das war die dritte Regel – ihre Freunde verpetzen sollten, wenn ihnen «etwas Ungewöhnliches» an ihnen auffiel. Glücklicherweise waren die kleinen Feldwebel mit Kinderschokolade zu bestechen. Leider durfte es nur die von Ferrero sein. Hatte also Timur vor einer Reise ins Wehrerziehungslager das Westgeld von Frau Schaklewski sinnvoll in Süßigkeiten investiert, konnte sein Trupp recht lange Nächte erleben.
Morgens, wenn der Tag mit ausgiebigem Frühsport begann, hingen wir natürlich durch. Auch beim Fahnenappell, wo unüberhörbar Lieder aus den Lautsprechern dröhnten: «Dem Morgenrot entgegen/ihr Kampfgenossen all!/Bald siegt ihr allerwegen,/bald weicht der Feinde Wall!/Mit Macht heran und haltet Schritt!/Arbeiterjugend? Will sie mit?» Ja, möglicherweise wollte sie mit. Aber nach Frühsport und Fahnenappell hatte die Arbeiterjugend zunächst ein anderes Problem, der Feind hieß: großer Hunger.
Einmal saßen wir wieder unausgeschlafen, genervt und voller Vorfreude auf die kommende Nacht im Speisesaal und frühstückten, als meine Freundin Anke mich bat, ihr die Butter zu reichen. Ein Lehrer hörte das und befahl in scharfem Ton, dass sie drei Strafrunden auf nüchternen Magen absolvieren solle. Denn Regel Nummer vier besagte: «Beim Essen wird nicht gequatscht!» Sie erwiderte, dass sie das nicht verstehe – da musste sie noch eine Gasmaske aufsetzen. Als sie nach der ersten Runde ohnmächtig umfiel, war das der Beweis, «wie schnell ein schlechter Patriot aus der Fassung zu bringen ist». Von da an betete ich: «Mach, dass Anke und ich nicht mehr beim Essen quatschen. Lieber Gott, lass uns gute Patrioten sein.»
Der liebe Gott muss mich gehört haben und ließ uns beim Essen schweigen, aber er war sich wohl nicht sicher, ob wir allein deswegen gute Patrioten sein würden, und so schickte er uns vorsichtshalber in die Arbeitsgemeinschaft Schießen. Das Wehrerziehungslager gab es schließlich nur einmal im Jahr, da konnte man seine Vaterlandsliebe in den anderen Monaten schnell vergessen; die Arbeitsgemeinschaft Schießen jedoch gab es immer, sie lieferte sozusagen das Selbstverständnis für den Alltag. Also gut, gingen wir schießen.
Vor den Waffen hatten wir keine Angst. Viel unheimlicher war, dass sich der Schießstand unserer Schule in Kellerräumen befand, in denen Rattenkegel lagen, und wir fürchteten uns vor Ratten. Wir überwanden diese Angst, denn unser Ausbilder meinte, dass die Übungen nicht umsonst seien und uns eines Tages nützen würden. Er gab uns das Gefühl, als warte der Feind mit seinem Angriff, bis wir fertig ausgebildet wären. Regel Nummer fünf war klar: Der Ausbilder hat immer Recht.
Tatsächlich nützte es mir wenig, dass ich ein guter Schütze geworden war. Nur einmal habe ich auf dem Rummelplatz einen Schießbudenbetreiber verängstigt, weil ich sämtliche Gewinne abräumte. Dabei nahm ich die Ziele bloß deshalb so beherzt ins Visier, weil ich mir vorstellte, jede Papierrose sei eine Ratte. Aber das konnte der arme Mann ja nicht wissen.
Irgendwie hatte ich erwartet, als Jugendliche eines Tages eine Einberufung vom Wehrkreiskommando zu bekommen. Jedenfalls wurden an unserer Schule reichlich Mädchen für den Militärdienst geworben. Mamel meinte, ich solle nicht einmal daran denken, doch das war nicht so einfach, schließlich war ich wehrerzogen.
Schon an ganz normalen Schultagen wurde ich daran erinnert: Die Basis ist die Grundlage aller Fundamente! Disziplin muss sein! Mannschaftsdisziplin sowieso! Damit uns diese sechste Regel nicht entfiel, mussten wir uns auf dem Schulhof fürs Mittagessen ausrichten, also in Reih und Glied aufstellen. Jede Klasse, bei Wind und Wetter. Ich kannte keine andere Schule, an der so etwas exerziert wurde. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich nie eine andere Schule kennen gelernt hatte.
Das Prinzip des Einlasses war simpel: Wenn ein Schüler nicht schnurgerade auf Reihe stand, kam dessen Klasse nicht in den Speisesaal. Das brachte dem Betreffenden massiven Zuneigungsentzug, vor allem im Winter, wenn wir uns wegen eines Verräters mannschaftlich die Hintern abfroren und als letzte Klasse Essen fassen durften.
Doch nicht nur der Kälte wegen war der Winter an unserer Schule immer besonders anstrengend. Sobald es schneite, mussten wir in den Hofpausen, in denen wir nicht nach Essen anstanden, im Kreis laufen. Denn das war die siebte Regel: Jedes Kind hatte ein anderes an der Hand zu fassen, damit keine Schneeballschlacht entstehen konnte. In der ersten Zeit, in der wir noch oft vergaßen, unsere Handschuhe anzuziehen, steckten wir uns tagsüber mit Warzen an, die unsere Eltern abends mit Höllenstein wegzubekommen versuchten. Auf den Elternversammlungen tauschten sie gern alternative Heilmethoden aus, die sich bei einigen Kindern besonders gut bewährt hatten. Nach einem solchen Elternabend wartete Mamel den nächsten Vollmond ab, dann ging sie mit mir auf den Balkon, hielt meine Hände in die Dunkelheit oder sprach mit ihnen. Ich fand das ganz unterhaltsam und wurde tatsächlich ein warzenfreier Bürger.
Aber war ich auch ein vorbildlicher? Einer, der für den großen Sieg des Sozialismus taugte? An unserer Schule wurde die Frage folgendermaßen beantwortet: Wer für den Sozialismus vorbildlich Partei ergreifen will, muss den Klassenfeind hassen. Dafür gab es die Regeln Nummer acht, neun und zehn: Ein guter Sozialist trägt keine Westtüten, keine Westparkas und keine langen Haare, sondern Handschuhe, Handschuhe und nochmals Handschuhe. Und weil einige Schüler den Staatsbürgerkunde-Unterricht und die darin angesprochene «Weltoffenheit der SED und ihren proletarischen Internationalismus» als Einladung zum geistigen Pluralismus missverstanden, wurden die Regeln auf elf erweitert: Eine sozialistische Persönlichkeit stellt das ideologische Bewusstsein nicht in Frage. Niemals. Ich verstand: Jeder, der Westklamotten anzog, blöde Fragen stellte und lange Haare trug, hatte wahrscheinlich auch keine Handschuhe bei sich und war ein Klassenfeind.
Das war nicht schwer zu begreifen; leider blieb es nicht so einfach, ein guter Sozialist zu werden, denn in jedem Schuljahr kamen ein paar neue Regeln dazu. Wie gesagt, meine Schule war anders als andere.
Im siebten Schuljahr verbot uns Regel Nummer zwölf, Kaugummi zu kauen. Taten wir es trotzdem, hieß es: Maczkowiak, Schulze, Konarski, vortreten! Die Schüler mussten nach vorne kommen, das Corpus Delicti in einen Mülleimer spucken und diesen dann gemeinsam zu dem Container hinunterbringen, der auf dem Schulhof stand. Unsere Lehrer beobachteten vom Fenster aus, ob die Schüler tatsächlich auf dem Hof ankamen. Erst dann ging der Unterricht weiter.
Die dreizehnte Regel verbot uns wenig später, Stoffturnschuhe zu tragen. Wer es dennoch wagte, wurde aus dem Unterricht entlassen und nach Hause geschickt, um dort nach «festem Schuhwerk» zu suchen. Als die Regel noch so neu war, dass sie keiner kannte, traf sie zuerst meine Freundin Anke. Ihr Vater war gerade von einer Westreise zurückgekehrt. Er hatte seinen Bruder besuchen dürfen und Schuhe mitgebracht. Als er die grünen Nylon-Treter zu Hause auspackte, kamen Anke die Tränen. Hatte sie sich nicht ganz klar ausgedrückt? Weiße Knöchelturnschuhe aus Leder und von Adidas! Aber sie kriegte etwas völlig anderes und sollte sich dafür sogar bei ihrem Onkel bedanken. In ihrer Verzweiflung rief sie mich an, es war ein Drama, und ich trauerte mit ihr. Doch am nächsten Tag änderte sich Ankes Verfassung: Bevor die erste Stunde begann, wurde sie nach Hause geschickt.
Unser Mathematiklehrer war eine aufs Strengste gescheitelte Erscheinung, die zu allem Überfluss geometrisch in einer Art Anzug verpackt war. Schon äußerlich gab er sich so rechteckig, dass man hätte glauben können, die Erde wäre keine Scheibe, sondern ein Quadrat. Die Mathematik, die er verkörperte, duldete Ungleichungen oder Ungeraden nur in der Theorie, nicht in der Wirklichkeit, Gleichmacherei war ihm am liebsten. Für ihn war das Leben eine Rechenaufgabe, die man mit Logik lösen konnte. Er addierte seine Anforderungen an uns und dividierte sie durch unsere Unfähigkeit, sie jemals zu erfüllen. So wurden wir nie seine Schüler, sondern blieben immer seine Nullen. Nullen, die jetzt auch noch Stoffturnschuhe trugen. Dafür hatte er keine Formel.
Anke war von der Entlassung aus dem Unterricht freudig überrascht, doch ihr Vater wunderte sich, seine Tochter so schnell wiederzusehen. Er wunderte sich noch einige Tage, inzwischen hatten sich alle Kinder mit Westverwandten bereits Stoffturnschuhe besorgt, um ganz legal dem Unterricht fernbleiben zu können. Wir brauchten nun nicht mehr bis zur Besinnungslosigkeit heiße Cola zu trinken, damit uns schlecht wurde und wir nach Hause gehen durften, wir brauchten nur Stoffturnschuhe anzuziehen. Das klappte gut. Plötzlich aber hatte Ankes Vater keine Lust mehr, sich zu wundern. Er machte sich auf den Weg, und auf der Straße vor der Schule traf er unseren Mathelehrer. Der war Chef der Schülerlotsen und brachte sich jeden Morgen ins Verkehrsgeschehen ein. Ankes Vater ging auf ihn zu und rief ihm ins Gesicht, dass seine Tochter Stoffturnschuhe tragen könne, wann und wo es ihr passe. Der Lehrer wusste nicht, wie ihm geschah, wer ihn da anschrie, und Ankes Vater stellte sich nicht vor, weil er Repressalien gegen seine Tochter fürchten musste. Doch sein Auftritt mitten auf der Kreuzung zur Hauptverkehrszeit war so wirkungsvoll, dass bald alle unbehelligt Stoffturnschuhe tragen durften. Und wie kamen wir jetzt an unsere «Freistunden»?
Lange mussten wir nicht warten, da gab es eine neue, die vierzehnte Schulregel: Wir wurden nach Hause geschickt, weil «der Radiergummi bemalt» war. Kleine Kreuzchen oder Pünktchen genügten, damit es hieß, das sei ja wohl «kein ernsthaftes Arbeitsmittel» mehr. Dann mussten wir den Radiergummi daheim «anständig waschen». Und das konnte dauern.
Unser Mathelehrer engagierte sich besonders, wenn es darum ging, die Schulregeln zu vervollkommnen. Dafür hatte er mehre Ämter inne, die er sich selbst geschaffen hatte: Er war nicht nur Chef der Schülerlotsen, er teilte auch Ordnungstrupps ein. Zu Ordnern erhob er die älteren Schüler aus der neunten oder zehnten Klasse. Während der Unterrichtspausen standen sie auf den Treppen und bestraften alle, die auf der falschen Seite rauf- oder runterliefen, also die fünfzehnte Regel verletzten. Links war falsch? Links war falsch. Erwischten die Ordner einen Schüler, musste der sämtliche Stufen zurückgehen und dann die rechte Treppenseite benutzen.
Außerdem regelte der Mathelehrer die Hofpausen für uns. Einen schwarzweißen Stab hatte er schon, schließlich war er ja der oberste Schülerlotse. Mit diesem Stab malte er Zeichen in die Luft: Hielt er ihn senkrecht, durften wir vorbei, hielt er ihn waagerecht, war das Passieren nicht erlaubt. Obwohl er seine Bewegungen nie kommentierte, hatten wir verstanden. Wir waren schon ganz gut erzogen.
Es hätte schlimmer kommen können, denn der Mathelehrer, der über die Ordnungstrupps, die Schülerlotsen und die Hofpausen wachte, war auch Klassenlehrer. Wir waren uns einig, dass die Kinder seiner Klasse nicht zu beneiden waren. Und das stimmte. Als er im achten Schuljahr unser Klassenlehrer wurde, waren wir wirklich nicht zu beneiden.
Bis zu diesem Zeitpunkt – ich war jetzt vierzehn – hatte Mamel schon einiges darangesetzt, dass die Schule nicht im Zentrum meines Lebens stand. Sie hatte mich in einen Schwimmverein gesteckt und zur Musikschule geschickt, jahrelang war ich viermal die Woche unterwegs. Doch es nutzte nichts, ich musste ja jeden Morgen in meine Schule, sechsmal die Woche. Am Tag, als Mamel erfuhr, wer unser neuer Klassenlehrer werden sollte, beschloss sie, sich ins Elternaktiv wählen zu lassen, «um den Überblick zu behalten», wie sie sagte. Schließlich hatte sie einmal versprochen, immer auf mich aufzupassen, und jetzt sah sie akuten Handlungsbedarf.
Im Schwimmverein hatte sie bereits den Kassiererposten übernommen, in der Musikschule gab es keine Ehrenämter, so hatte Mamel noch Reserven. Als Mitglied des Elternaktivs kam sie von nun an bei allen Wandertagen mit. Und während meine Mitschüler sich hinter den Büschen vergnügten und sich für ihre ersten Küsse schämen konnten, stapfte ich zwischen meiner Mamel und meinem Lehrer. Nur Anke stapfte hin und wieder eine kurze Strecke neben uns, sozusagen als freundschaftliche Geste.
Mamel war seitdem überall präsent, selbst bei Klassendiscos. Früher hatte ich mich auf die Discos gefreut, weil ich für mein Leben gern tanzte, aber nun blieb ich sitzen, denn ich schämte mich, vor Mamel nach AC/DC Luftgitarre zu spielen oder gar auszurasten. So gut behütet, fühlte ich mich manchmal einsam und trauerte um meine kleinen Freiheiten – doch Mamel war mir nicht böse deswegen. Sie empfand es als großzügig, dass sie mir mein Klagen nicht übel nahm. Andere Eltern hätten bei so viel Undankbarkeit… Egal. Ich vermutete, dass Mamel ein bisschen schräg drauf war.
Mehr wollte ich eigentlich auch nicht. Ich wollte auch nur ein bisschen schräger drauf sein und nicht dauernd zur Musikschule rennen, zum Schwimmtraining oder zum Konfirmandenunterricht. Also versuchte ich, Mamel davon zu überzeugen, dass ich wenigstens nicht mehr zum Verein musste. Und überraschend, wie Mamel sein konnte, schmiss sie ohne Jammern den Kassiererjob.
Von da an ging ich mit meiner Freundin Anke regelmäßig ins SEZ, das Sport- und Erholungszentrum in Friedrichshain. Dort tauchten wir zweimal pro Woche in eine andere Welt ein. Wir lernten neue Freunde kennen, die ihr Leben wesentlich autonomer bestimmten als wir und sich in ihren Schulen Dinge erlaubten, an die wir nicht einmal zu denken wagten. Wir waren beeindruckt. Sie fingen an, mit uns über Schein und Sein zu philosophieren – es gab genug, was nicht so war, wie es schien–, und Anke und ich laborierten fortan an unserer Weltanschauung. Wir philosophierten gern und viel, was blieb uns übrig? Wir kannten ja sonst keine Möglichkeiten, unser Bewusstsein zu erweitern.
Beim Anschauen der Welt einigten wir uns etwa darauf, dass es gar nicht möglich sei, New York jemals zu sehen, und wie unvorstellbar es erst sei, New York niemals zu sehen. Auf der Suche nach der Wirklichkeit ließen wir unsere Gedanken schweifen und landeten am Ende wieder bei profanen Dingen.
Wir konnten nämlich auch provinziell. Sehr heimatverbunden war zum Beispiel die Erfahrung, dass sich Glück durch Mangel empfinden ließ: Unsere Freunde trugen Fleischerhemden aus dem VEB Berufsbekleidung und Tramper, wildlederne Bergsteigerschuhe. Beides, Hemden und Schuhe, war Mangelware, sodass die Jagd nach diesen Kleidungsstücken für mich eine Art Ersatzsport für mein Schwimmtraining wurde. Überhaupt konnte uns plötzlich vieles glücklich machen: Später kamen zu den Fleischerhemden und Schuhen noch Ohrlöcher, lange Haare, Shell-Parkas und andere Dinge dazu.
Mamel meinte zwar nach wie vor, dass Schulbildung bis auf weiteres nicht schaden könne, trotzdem setzte sie sich auch für meine neuen Bedürfnisse ein. Sie redete mit meinen Tanten am Telefon: «Annelotte, frag mich nicht, warum, aber es dürfen keine Apachi-Jeans mehr sein oder so was. Das Kind will nur Levi’s oder Wrangler.» – «Erika, die Turnschuhe dürfen auf keinen Fall bloß zwei Streifen haben, es müssen drei sein.» Meine Tanten, die, wie gesagt, gar nicht meine Tanten waren, sondern Freundinnen meiner Mutter, wunderten sich: «Ilse, das ist ja bei euch drüben schlimmer als bei uns. Wir haben unseren Kindern diesen Markenwahn schon wieder abtrainiert.» Mamel antwortete: «Wir sind noch nicht so weit. Hier kommt alles ein bisschen später.»
Schöner als alle Geburtstage zusammen waren dann die Tage, an denen der Postbote einen Abholschein in den Briefkasten steckte. Es war erstaunlich, wie sehr ein kleiner Zettel mein sozialistisches Bewusstsein trüben konnte und wie schnell mich meine Beine zur Paketausgabe nach Friedrichsfelde trugen. Zu Hause zelebrierte Mamel das Öffnen eines Westpakets, indem sie eine Ewigkeit nach einer Schere suchte. Früher oder später stand ich dann vor ihr – mit einem Küchenmesser in der Hand. Damit ging es einfach schneller. Warum sich so viel Mühe geben, die Pakete waren sowieso nicht richtig verschlossen: Manchmal fehlte etwas, zum Beispiel die Bücher für Mamel. Aber die Jeans, die waren immer drin.
Weil Mamel sich so für mich einsetzte, wollte ich sie nicht enttäuschen, obwohl ich von Tag zu Tag weniger Lust auf die Schule hatte. Als ich in der neunten Klasse nichts mehr vom Lernen hielt und meine erste Fünf bekam, simulierte Mamel einen Herzanfall. Mit allem Drum und Dran. Erst verkrampfte sich ihr Gesicht, dann der ganze Körper. Schließlich sank sie auf die Couch, meinte, ich solle ihr keine Blumen ans Grab, sondern lieber gute Zensuren nach Hause bringen, und streckte mir ihre Hand entgegen. Ich schlug ein.
Das hatte sie wirklich nicht verdient. Beim nächsten Mal wollte ich ihr eine gute Note präsentieren. Jedoch möglichst, ohne pauken zu müssen. Also setzte ich mich bei der bevorstehenden Mathearbeit neben die Klassenstreberin, Britta Dalle, und schrieb wie besessen von ihr ab. Alles. Das schien mir am sichersten. Zwei Tage später gab uns der Lehrer die Hefte zurück und meinte, er habe von mir keine Arbeit bekommen, von Britta Dalle dagegen zwei.
In meinem blinden Ehrgeiz hatte ich auch den Namen meiner Banknachbarin abgeschrieben. Dafür wurde mir ein Tadel angekündigt, und ich erhielt den Platz direkt vor dem Lehrertisch. Als ich Mamel am Abend alles beichtete und dachte, sie bekäme wieder einen Herzanfall, war sie ganz entzückt von meinem Malheur. Sie dankte dem lieben Gott, dass ich endlich in der ersten Reihe sitzen musste. Das mit dem Tadel wollte sie aber noch klären.
Am nächsten Tag begleitete sie mich zur Schule und meinte vor dem Klassenzimmer: «Bleib draußen. Verlass dich auf mich.» Die Tür blieb einen Spalt offen, und ich sah, wie Mamel vollkommen aufgeräumt auf meinen Lehrer zuging, mit ihm sprach und schließlich darauf bestand, dass «meine Tochter den Tadel erhält». Dann drehte sie sich um, zwinkerte mir zu und ging zur Arbeit. Sie wusste, dass unser Lehrer sich nichts vorschreiben lassen wollte. Schon gar nicht von Eltern. Um uns zu zeigen, wie ernst ihm das war, hat er den Tadel absichtlich nicht ausgesprochen, sozusagen als Denkzettel. Mamel war genial.
Nun saß ich also tadellos auf der Strafbank, an der vordersten Front unserer Klasse. Michael Treede, ein charmanter Sitzenbleiber, vergnügte sich unterdessen mit den Mädchen in den hinteren Reihen und spielte «Anhalten oder Weiterfahren»: Er legte seine Hand auf ihren Bauch, bewegte sie in Fünfzentimeterabständen auf ihren Busen zu, und die Mädchen sagten ihm, wann er anhalten musste und wann er weiterfahren durfte. Da ich ein mageres, sich spät entwickelndes Teilchen war, vermisste Michael mich dahinten nie. Einmal sind wir uns dennoch nicht entkommen: Ich betrat gerade den Klassenraum, als er hinter der Tür versteckt auf Mädchen wartete, die er begrapschen konnte. Ich trug eine Latzhose, und auf der Höhe, auf der andere schon Busen verstauten, verstaute ich meinen gewaltigen Schlüsselbund. Michael streckte blitzschnell seine Hand aus, um routiniert in einer weichen Brust zu landen. Doch diesmal winselte er. Ich war entsetzt: Der erste Junge, der nach meinem Busen griff, verstauchte sich die Finger. Fortan gingen wir uns aus dem Weg.
Auch die übrigen Jungs unserer Klasse waren frustrierend und durch die Bank so langweilig, dass ich mich gut mit dem Platz in der ersten Reihe arrangierte. Wären sie ein klein wenig spannender gewesen, hätte ich mich gern ablenken lassen, aber sie waren vom Schwachsinn befallen und spielten «Mundgeruch», «Schlitzauge» oder «Jui». Letzteres war ihr Lieblingsspiel. Dabei rollten sie die Silberfolien ihrer Frühstücksbrote zu einer Kugel und warfen nach einem Opfer, das dann «Jui» war und – sie machten daraus Regel Nummer sechzehn – die Mappen aller Jungs in der Pause zum nächsten Klassenraum schleppen musste. Bei diesen Jungs wurde einem das Lernen geradezu leicht gemacht.
So blieb es, bis zum Schluss.
Es gab Momente, in denen nahm ich an, das alles sei nur für mich inszeniert: diese Lehrer, diese Schule, diese sauberen Radiergummis. Da habe ich nicht geglaubt, das könne Wirklichkeit sein. Manchmal dachte ich sogar, wenn ich zu Hause die Tür von außen zuschlage, ist dort kein Kinderzimmer mehr, als existiere mein Zimmer nur, wenn ich es sehe. Ich war völlig sicher, dass es etwas gab, das an mir testete, ob es sich so leben ließe – in dieser Zeit, in dieser Gegend, mit diesen Menschen. Es kam mir vor, als sei ich ein Proband, mit dem ein Spiel gespielt würde. Ich fing an, Fragen zu stellen.
Mamel verstand und beteuerte, dass ich definitiv aus ihrem Bauch gekommen sei und dass mein Zimmer auch immer dasselbe Zimmer sei, wenn sie hineinschaue. Ich vertraute ihr. Wenn Mamel also dasselbe Zimmer sah, das wurde mir schlagartig klar, dann waren wir beide Versuchskaninchen, denen ein großes Berlin-Lichtenberg vorgemacht wurde.
Diese frühe Form der vorsichtigen Skepsis ereilte mich 1983.Zu jener Zeit, als die DDR aufatmete, weil sie sich über Franz Josef Strauß einen Milliardenkredit organisiert hatte, atmete ich auf, weil die Schule zu Ende ging. Möglicherweise hatte hier jeder jedem etwas vorgemacht. Ich wusste es nicht, ich war nur ein bisschen argwöhnisch geworden. Zum Glück hatte ich mir bis dahin nur die Geisteskraft geleistet, die mir meine Schule all die Jahre über abgefordert hatte, sonst hätte meine Skepsis mir die ganze Kindheit versaut.
Mamel freute sich, dass sich ihre Erwartungen erfüllten: Wir hatten die Schule mit Eins abgeschlossen. Und ich freute mich, dass ich sie nicht enttäuscht hatte, und noch mehr, endlich die Probezeit hinter mich gebracht zu haben. Meine Tanten und Onkel meinten, dass jetzt «der Ernst des Lebens beginnt». Der Spaß sei nun vorbei.
Vorbei? Der Spaß?
2 Tee statt Kaffee
So bin ich also durch den Spaß gehetzt, ohne ihn genossen zu haben.
Mein Verstand sagt, es wäre gut, wenn mein Leben eine kleine Pause einlegen würde, damit ich zu mir käme. Es sei zu rasant, und wenn ich nicht aufpasse, könne es mir versehentlich abhanden kommen. Soll ich also eine Pause machen?
Mein Gefühl meint, für die Kunst der Auslassung sei es zu früh.
Für Mamel stand fest, dass ich nach der zehnten Klasse auf die erweiterte Oberschule gehen, Abitur machen und dann studieren würde. Auch ich hatte nie daran gezweifelt, aber auf einmal war ich mir da nicht mehr sicher. Am Ende der zehnten Klasse wurde mir bewusst, dass dies möglicherweise nicht das Leben war, auf das ich mich so freute. In mir entwickelte sich ein Bedürfnis, mich gegen meine geplante Zukunft zu wehren und allen Zwang von mir abzuschütteln. Schließlich war ich ein junges Mädchen, das seine Vergangenheit noch vor sich hatte. Ich wollte aussteigen und beschloss kurzfristig, einen neuen Weg einzuschlagen. Einen Weg, auf dem ich über meine eigenen Herausforderungen stolpern würde und nicht über die Herausforderungen anderer.
Als ich Mamel meinen Entschluss mitteilte, kam ich ihr sogleich zuvor und simulierte einen Herzanfall, von dem «ich mich niemals erholen» würde, wenn «mein Leben so weitergeht». Und weil Mamel das nicht wollte, reagierte sie mit mütterlich-liebevollem Verständnis. So begab ich mich in meinen letzten Sommerferien, in denen alle schon wussten, wie und wo und wann es mit ihnen weiterging, auf die Suche nach einer Lehrstelle. Mamel fand das kamikazehaft, denn alle Stellen waren längst vergeben. Ich fand das toll, denn die erste Herausforderung wartete auf mich.





























