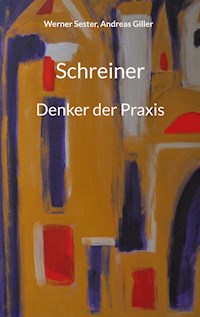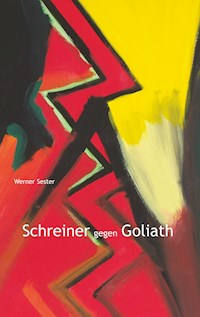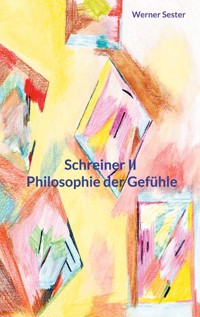
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Schreiner erlebt und fühlt die Welt mit den Augen eines Philosophen. Er beschäftigt sich mit dem Anfang, mit den Tiefen von Sein und Entwicklung und schließlich mit dem Ende. Das System eines Schreiners ist immer ganzheitlich. In seiner Person wirken Beginn, Gestaltung und Vollendung als Prozess von gelebten Gefühlen. Am Anfang ist die Einsamkeit im Tun ist Leidenschaft und Vezweiflung , in der Vollendung ist Freude und Trauer. Ein Schreiner lebt durch sein Gefühl. Und dieses Gefühl öffnet ihm das Tor für ein neues Weltverständnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Hochsensible Menschen leiden unter unserer groben Alltagswelt.
Sie können sich nur schwer von anderen Menschen abgrenzen, weil ihre feinstofflichen Gefühle nicht auf Auseinandersetzung, Konfrontation und Selbstschutz angelegt sind.
Diese Menschen bewegen sich jenseits der allgemeinen Alltagstauglichkeit. Sie empfinden deshalb ihr persönliches Los oftmals als Fluch.
Was als Bürde erscheint, ist in Wahrheit eine besondere Gabe.
Nur wenige Menschen verfügen über eine intensive Gefühlswelt, die noch so unverfälscht offen, umfassend und tiefgründig ist.
Diese Menschen haben mit ihren Gefühlen einen direkten Zugang zu verborgenen Werten, die ein respektvolles Miteinander und Füreinander im menschlichen Zusammenleben vermitteln können.
Hochsensible Menschen sind die Avantgarde einer neuen Zeit, weil sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen erfühlen können.
Eine Philosophie der Gefühle ist ein Versuch, dieser neuen Zeit gedanklich gerecht zu werden.
Und sie ist gleichzeitig eine Verbeugung vor allen Menschen, die die Last dieser Welt mit ihren Gefühlen tragen helfen.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einführung
2. Gedanken über den Anfang
3. Probleme
4. Der Stillstand
5. Im Grenzbereich der Vergangenheit
6. Im Grenzbereich der Zukunft
7. Das Lebensparadox
8. Märchen und Geschichten
9. Berührungen
10. Das Tor der Welten
1. Einführung
Ein Schreinermeister erlebt und fühlt die Welt mit den Augen eines Philosophen.
Er beschäftigt sich mit dem Anfang, mit den Tiefen von Sein und Entwicklung und schließlich mit dem Ende.
Das System eines Schreiners ist immer ganzheitlich.
In seiner Person wirken Beginn, Gestaltung und Vollendung als Prozess von gelebten Gefühlen.
Am Anfang ist die Einsamkeit, im Tun ist Leidenschaft und Verzweiflung, in der Vollendung ist Freude und Trauer.
Da ein Schreinermeister normalerweise nur auf das zurückgreift, was er be-greifen kann, würde sein philosophischer Ausflug innerhalb der natürlichen Grenzen von Tod und Geburt ein trostloses Dasein führen, gäbe es nicht die Gefühlswelt, die parallel mit all seinem Tun mitschwingt. Mit dieser Gefühlswelt lassen sich Grenzen überschreiten, ohne dabei die Grundlagen des händischen Begreifens und Erlebens verlassen zu müssen.
Die Bodenständigkeit der Gefühlswelt beim Verlassen von Grenzen ist Voraussetzung für ein Verhaftetsein in einer wissenschaftlichen Denkweise, die auf Überprüfbarkeit ausgerichtet ist.
Der Versuch, Gefühle als Richtpfeiler für eine ganzheitliche Philosophie zu etablieren, birgt stets das Risiko in sich, in Glaubenskategorien abzudriften. Es bleibt deshalb ein gewagtes Unterfangen, das hoher Achtsamkeit bedarf.
Da Erfolg und Misserfolg Lebensbegleiter des Schreinermeisters sind, bleibt er gelassen, wenn er in tabuisierte Zonen eintritt, um bekannte Denkgrenzen zu überschreitet. Scham und Vertrauen halten seine Gefühle im Gleichgewicht.
2. Gedanken über den Anfang
„Der Anfang ist der Anfang.“
Mehr gibt es über den Anfang eigentlich nicht zu sagen.
Ein für sich stehender Anfang ist ein Konstrukt und steht außerhalb jeder Einmischung. Dieser Ursprung ist nicht sichtbar, nicht greifbar, nicht denkbar und deshalb unverständlich.
Stellt man „die Frage nach dem Anfang“, befinden wir uns bereits in einer neuen Dimension. Wir schauen zurück mit den Augen des Betrachters.
Wir können den Anfang zwar nicht in seinem Ursprung sehen, wir können uns aber diesen Anfang mit unserem Geist spekulierend vorstellen.
An diesem Punkt betritt das philosophische Denken die Weltbühne. Mit der Einführung von Urstoffen wurde ein Gegenmodell zu den Erklärungsversuchen mythischer Weltbilder entwickelt.
Dieses naturorientierte Denken verlieh einem „Ursprung“ eine neue Denkrichtung. Die Suche richtete sich fortan auf einen Wesenskern, der die Grundlage allen Seins bilden sollte.
Mit dieser neuen Ausrichtung der Frage wird der Denkende zum Schöpfer eines Gedankengebäudes und gleichzeitig zum Betroffenen seiner eigenen Fragestellung.
Da jeder Mensch im Anfang seinen Ursprung hat, begibt sich der Mensch auf eine Suche nach einer Erkenntnis, deren Ergebnis er bereits ist.
Die Frage nach dem Anfang wird somit immer auch zu einer persönlichen Frage nach sich selbst.
Damit wird der Schöpfer zur tragischen Figur seines eigenen Schöpfungsaktes, die zu erkennen glaubt, aber für sich selbst keinen wirklichen Zugang zu den drängenden Fragen aus dem Ursprung findet:
„Wer bin ich?“, „Woher komme ich?“, „Was ist der Sinn meines Daseins?“.
Erkenntnis und Tragik des persönlichen Ausgeliefertseins vermischen sich zwangsläufig in der Frage nach dem Ursprung.
Und das ist auch der Grund, dass sich in der Beschäftigung mit dem nicht zu verstehenden Anfang Erkenntnisversuche stets mit religiösen Momenten vermischen.
Mit dem Fortschreiten des philosophischen Denkens verringern sich zwar die mythisch-religiösen Anteile in der Gesamtbetrachtung, das Mischungsverhältnis als solches ändert sich aber nicht.
Solange wir keinen persönlichen Zugang zu dem Unergründlichen haben, solange wird sich dieser Zustand auch nicht ändern.
Wir sind Suchende und werden vermutlich immer Suchende bleiben.
Diese Suche drückt sich in der Lebenshaltung jedes einzelnen Menschen aus.
In jeder Lebenshaltung findet sich ein Bezug des Menschen zu seinem geschichtlich geprägten „persönlichen Urfunken“, versteckt in Ideologien, Religionen oder Verschwörungserzählungen.
Somit wird jede Lebenshaltung zu einer sichtbaren Ausdrucksform eines interpretierten Anfangs, weil wir uns diesem Anfang nicht entziehen können.
Auf dem Anfang baut alles auf.
Der Anfang prägt uns in allem, was wir tun.
Wir können diese Prägung sogar in einer einzigen Frage zusammenfassen. Es ist die bedeutendste aller Fragen und gleichzeitig die letztendliche Frage:
„Warum?“
In jedem Anfang ist das Ende mit enthalten.
Deshalb reißt diese Frage eine Lücke in unserer Gefühlswelt auf, die uns hilflos und einsam macht.
Das Nichtwissen wirft uns in unsere Angst.
Um diesen unhaltbaren Zustand zu beenden, versuchen wir die letztendliche Frage in einen Kommunikationskontext mit dem Anfang einzubinden.
Dazu benötigen wir die Resonanz eines „Gegenüber“ aus der Welt des Unzugänglichen.
Das geschieht mit einer Hilfskonstruktion.
Wir verpassen dem Anfang mit Hilfe unserer denkenden Vorstellung ein Gesicht, das Gesicht unserer Phantasie. Diese Vorstellung projizieren wir danach auf den Anfang.
Um es deutlich auszusprechen: „Gott ist ein Produkt unserer denkenden Phantasie. Wir reden mit uns selbst, in der Hoffnung, dass wir irgendwie gehört werden.“
Im Anfang ist alles enthalten, was der Mensch wissen will. Im Anfang ist der Sinn unseres Daseins enthalten. Im Anfang ist der Grund all unseres Strebens verborgen.
Wir brauchen diesen Anfang für unsere Ganzheit, für unsere vollständige Identität.
Das macht uns zu Getriebenen des Anfangs.
Alles im Leben dreht sich auf die eine oder andere Weise um diesen Anfang.
„Leben“ und „Tod“ sind genauso Auswüchse des Anfangs wie die Gefühle der „Angst“ und der „Hoffnung“.
Die Entstehung des wissenschaftlichen Denkens ist eine direkte Folge und ein Aufbegehren gegen dieses Unbekannte. Das Streben nach gesicherten
Erkenntnissen ist die Beruhigungspille gegen die Unsicherheit, die uns antreibt.
Und der Glaube ist nichts anderes als eine Strategie, sich gegen die Bedrohungen aus dem Anfang zu schützen.
Der Anfang berührt unser Denken und unser Gefühl und aktiviert damit unsere Handlungsbereitschaft.
„Veränderungswille“ und „Hingabe“ sind hierbei die Pole unserer Handlungsmöglichkeiten. Beide Pole wirken in uns.
Wir streben einerseits nach der „großen Erkenntnis“, aber andererseits wollen wir den sicheren Boden unserer Gewohnheiten nicht verlassen.
Wir fühlen uns von dem Unbekannten magisch angezogen, aber wir fürchten auch durch unsere Hinwendung zu dem Unbekannten um unser Seelenheil.
Das Unbekannte im Anfang spaltet unsere Gefühlswelt.
Die Gefühlswelt des drängenden Geistes hat eine andere Qualität als die Gefühlswelt der persönlichen Betroffenheit.
Während der Geist der Erkenntnis die Gefühlswelt in die Isolation und Einsamkeit zwingt, sind die Gefühle der persönlichen Betroffenheit ganz im sozialen Leben verhaftet.
Von welchem Ausgangspunkt wir uns dem Unbekannten annähern, bleibt eine ganz persönliche Angelegenheit. Die Fähigkeiten und die Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen entscheiden, wie und wie weit er sich dem Unbekannten annähern will und kann, und mit welcher Absicht er es tut.
Ein Schreinermeister ist ein Mensch der Praxis.
Deshalb gibt es für ihn nur einen gangbaren Weg.
3. Probleme
Ein Philosoph und ein Schreinermeister beginnen gleichermaßen ihre Wegstrecke auf dem Pfad der Erkenntnis. Ihre Wege mögen unterschiedlich sein, die Richtung hingegen ist gleich. Ihr Handeln ist auf die Entzauberung des Unbegreiflichen ausgerichtet.
Der Philosoph vertraut auf die unbegrenzte Macht seiner Gedanken.
Der Schreinermeister vertraut auf die Macht seiner Gefühle. Er muss erleben, um zu verstehen.
Die philosophische Annäherung an ein Verständnis des Ursprungs beginnt mit Thales von Milet (625– 545 v. Chr.). Wasser galt für ihn als Urstoff, der von Göttern belebt war.
Das war eine durchaus empirisch geprägte Vorgehensweise.
Thales galt als glänzender Beobachter.
Er erkannte die Bedeutung von Wasser für alles Leben und war fest davon überzeugt, dass die Erde auf dem Wasser schwimmt, was er aus seinen Beobachtungen über Erdbeben ableitete.
Das waren kühne, beeindruckende Gedanken von einem Mann mit großem Praxisverständnis.
Ein Schreinermeister steht ganz in seiner Tradition, von der Praxis aus zu denken. Auch er beobachtet sehr genau. Für Thales war das Wasser von Göttern beseelt, womit sein Urstoff die Verbindung zum Anfang bewahrt hat.
Für einen Meister ist es die Akzeptanz des Unbekannten als Teil seiner gelebten Praxis.
Er weiß, dass Teile seiner Praxis nicht wirklich kontrollierbar sind. Sein Arbeitsmaterial „Holz“ führt ihn immer wieder in nicht fassbare Denkbereiche hinein, bei denen das Gefühl und die Intuition die Führung im Entscheidungsprozess übernehmen. Dieses kreative Moment bedient sich von irgendwoher und steht außerhalb von Berechenbarkeit und Logik.
Aus einem Gefühl wird ein unabhängiges, nicht kontrollierbares Gefühlsdenken.
Das Gefühl denkt und entscheidet eigenständig.
Ein Meister kennt das. Das ist Teil seines alltäglichen Erlebens.
Deshalb bleibt er stets offen für alles Nichtgreifbare.
Und deshalb hört er auch interessiert zu, wenn religiöse Vorstellungen von der Erschaffung der Welt, direkt durch Gott, kollidieren mit einer wissenschaftlichen Vorstellung von einem Urknall, der gerne als Ausgangspunkt von Entstehen und Werden angesehen wird.
Hier prallen Denkungsarten unversöhnlich aufeinander.
Aber was sagt das über den Anfang aus?
Der Meister sieht das sehr nüchtern:
„Der Anfang in einem religiösen Verständnis ist der Glaube, der schließlich bei Gott endet. Der Anfang in einem wissenschaftlichen Verständnis ist die Vermutung von Ursprünglichkeit. Die Herkunft der Bausteine des Anfangs bleibt genauso nebulös wie der Glaube selbst. Was ist also das Ergebnis: ‚Glaube und Vermutung.‘ Das war’s! Und das klingt irgendwie ähnlich.“
Der Meister nimmt erst einmal die Grenze, die er nicht überwinden kann, als gegeben hin. Und er akzeptiert sein Ausgeliefertsein an einen Teil, den er nicht im Griff hat.
Mit einem Zeitsprung versucht er als Praktiker den Fragebereich wieder in den Bereich der Erfassbarkeit zu stellen.
Einem Schreinermeister hilft dabei, dass er in Traditionen denkt.
Seine erste Frage an den Anfang lautet deshalb konkreter: „Wann beginnt die Geschichte der Menschheit? Wann beginnt ihre Tradition?“
Mit dieser neuen Fragestellung beginnt der Streit von vorne.
Ein religiös motivierter Mensch würde hier sofort antworten: „Die Geschichte der Menschen beginnt im Paradies!“
Schon die Erwähnung des Wortes, „Paradies“, bringt die Gläubigen ins Schwärmen.
Kein Leid, kein Streit, keine bösen Worte, Verständnis, Liebe, Ruhe, frei von jeder Last und geschützt vor jeder Katastrophe, kein Nahrungsmangel, mit einem Wort: „Glückseligkeit“.
So könnte man das Paradies beschreiben.
Man könnte aber auch dazu sagen, dass das Paradies ein „Zoo all inclusive“ ist, ein Ort der totalen Langeweile, ein Nichts im Nichts, mit einem Höhepunkt am Tag, wenn die Banane durch die Gitterstäbe gereicht wird.
Der Meister hat mit diesem Kinderglauben aus der Phantasie- und Märchenwelt seine Schwierigkeiten:
„Das ist nicht die Geschichte der Menschen! Das ist die Geschichte Gottes, der mit seinen Figürchen und seiner Eisenbahn spielt.“
Und genau das ist völlig unmöglich:
„Ein ‚zeitlos allumfassender Gott‘ kann niemals eine eigene Geschichte haben. Gott ‚ist‘, er kann niemals ‚werden‘. Ansonsten ist dieser Gottesbegriff tot.“
Das bedeutet, dass aus dem Göttlichen nicht weniger entstehen kann als das Göttliche selbst. Jedes „Produkt“ des Göttlichen i s t immer schon Teil des Göttlichen und deshalb zeit- und geschichtslos.
Vollkommenheit oder Fehlerhaftigkeit sind innerhalb des Göttlichen keine gültigen Kategorien.
Aus der Sicht Gottes ist der Mensch deshalb ein göttlich zeitloses Produkt.
Der Mensch erlebt sich keineswegs als zeitloses Werkstück des Göttlichen, vielmehr erlebt er sich als getrennt von Gott lebendes Wesen. Sein Gefühl gibt ihm diese Gewissheit.
Deshalb rät der Meister allen religiös motivierten Menschen gegenüber ihrem Gott respektvoll zu sein:
„Wenn ihr schon in paradiesischen Vorstellungen denkt, dann richtet euer Augenmerk auf den Punkt, an dem eure eigene Geschichte beginnt. Eure Geschichte beginnt mit eurer ersten bekannten Handlung. Erst eure Handlung macht die Welt für euch zum ersten Mal konkret erfahrbar. Die Selbstverstrickung mit Gott ist eine Anmaßung, die das menschliche Fassungsvermögen übersteigt.
Eure Geschichte beginnt mit dem Sündenfall, mit Eva und der Schlange und dem Naschen vom Baum der Erkenntnis.“
„Jetzt geht es los!“
Es folgt die Vertreibung aus dem Paradies.
Das war der Startschuss für den erfassbaren Anfang in der religiösen Welt: „Der Beginn der Probleme!“
Mit den Problemen wird die Menschheitsgeschichte konkret erfahrbar.
Mit Gott als versteckter Prämisse ist dieser Begriff allerdings noch ganz im Glaubensbereich gefangen.
Um den Begriff „Problem“ in die erfahrbare Wirklichkeit des Schreinermeisters zu transformieren, tauchen wir noch einmal in die religiöse Vorstellungswelt ein, um seine Breite und Tiefe offenzulegen.
Unsere Vorstellungswelt des Göttlichen ist eine Aneinanderreihung von Superlativen:
Gott ist alles, deshalb ist er in sich fraglos.
Gott ist allmächtig, deshalb ist er ohne Bedürfnis.
Gott ist Gedanke und Gefühl, deshalb muss er weder denken noch fühlen.
Wer immer schon ist, steht jenseits von Entstehen und Werden.
Anders ist unsere menschliche Erfahrung:
Der Mensch ist nichts, er muss erst werden.
Der Mensch ist machtlos, er muss sich entwickeln.
Der Mensch ist kein Gefühl, er hat Gefühle.
Der Mensch hat nichts, deshalb muss er erschaffen.
Der Mensch braucht sein Erleben, um zu verstehen.
Der Standpunkt unserer Betrachtung entscheidet über unser Schicksal.