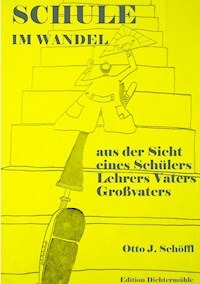
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gedanken eines ehemaligen Lehrers zu Schule, Schüler, Eltern, Lehrerkollegen, Direktoren, Schulaufsicht, Schulnoten, Lehrersprüche Lehrer- und Schulwitze, Kluge Menschen über die Schule Erziehung …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schule im Wandel
Gedanken eines ehemaligen Lehrers zu Schule, Schüler, Eltern, Lehrerkollegen, Direktoren, Schulaufsicht, Schulnoten Lehrersprüche Lehrer- und Schulwitze Kluge Menschen über die Schule Erziehung …
Gesammelt und geschriebenVon
OTTO SCHÖFFL
Edition Dichtermühle
Books on Demand
INHALT
MEINE EIGENE SCHULZEIT
SCHULREFORM
DER SCHULALLTAG
WER WIRD LEHRER UND WARUM?
MEINE DIREKTOREN
KLASSENVORSTAND
ELTERN
DER LEHRER
SCHÜLER UND LEHRER
LEHRER– ELTERN – SCHÜLER
SCHULINSPEKTOR
BILDUNG
AUFTRAG UND FUNKTION DER SCHULE
CHANCENGLEICHHEIT
GESCHICHTE DER ÖSTERREICHISCHEN SCHULE
ZEUGNISSE UND NOTEN
IMAGE DES LEHRERS
ARBEITSZEIT DER LEHRER
DER LEHRER IN DER LITERATUR
BERUFSWAHL
LEHRERAUSBILDUNG
DER ARBEITSPLATZ SCHULE
REGELN FÜR GUTEN UNTERRICHT
UNTERRICHTSMETHODEN
AUSSPRÜCHE BERÜHMTER UND BEKANNTER MENSCHEN ÜBER DIE SCHULE
VORTEILE EINER SCHULKLEIDUNG?
SCHULSCHWÄNZEN
LEHRERWITZE
Meine eigene Schulzeit
Schon meine Großmutter wollte Lehrerin werden. Der Wunsch blieb aus finanziellen Gründen unerfüllt. Meine Mutter wäre gerne und wie ich meine, eine vorzügliche Lehrerin geworden. Nach dem Tod ihres einzigen Bruders musste sie jedoch in der elterlichen Mühle helfen. So war auch ich schon bei meiner Geburt zum Lehrer bestimmt. Es war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wichtig.
1945, kurz nach Ende des Krieges - russische Soldaten waren in unserer Mühle noch einquartiert - begann meine Schullaufbahn in der Roseldorfer Volksschule. Es war dies eine zweiklassige Schule, wobei die ersten drei Schulstufen in einem Raum gemeinsam von einer ganz jungen Lehrerin, die fast monatlich durch eine neue ersetzt wurde, unterrichtet wurden. Die vierte bis zur achten Schulstufe wurden vom schon recht alten Herrn Direktor unterrichtet. Großen Einfluss hatte auch unser Pfarrer, der sich all zu gut mit unserer jungen Lehrerin verstand. Wenn jemand nicht „brav“ war, gab es Schlechtpunkte. An jedem Samstag gab die Frau Lehrerin dem Pfarrer den Zettel mit den Schandtaten der vergangenen Woche. Wir mussten uns in einer Reihe anstellen. Einer nach dem Anderen bekam dann seine „verdienten“ Schläge mit einer Rute auf den Hintern. Wer besonders viele Schläge zu erwarten hatte, kam am Samstag mit einem Polster in der Hose, um nicht zu viele Schmerzen zu spüren. Wenn jedoch der Pfarrer dies merkte, gab es doppelt so viele Schläge.
Auch sonst ging es ziemlich roh zu. Besonders die Mädchen hatten es nicht leicht. Vor Beginn des Unterrichtes und in den Pausen griffen die älteren Buben den Mädchen an die Brüste und unter die Kittel.
Es gab fast noch keine Hauptschüler in unserem Dorf. Auch körperlich und geistig behinderte Kinder waren in derselben Schule. So waren Vierzehnjährige mit Sechsjährigen in den ersten Schulstufen. Für mich war diese „niederorganisierte Schule“ von Vorteil, weil ich schon in der ersten Schulstufe mithörte, was man in den höheren Schulstufen zu lernen hatte.
Mit neun Jahren kam ich in die zweite Klasse zu den „Großen“. Unser Herr Direktor, der ab jetzt unser Lehrer war, war gutmütig, wenn er seine Ruhe hatte. Die Unterrichtszeit dauerte von 8 Uhr bis 11 und von 12 bis 14 Uhr. Am Vormittag wurde ein wenig unterrichtet und um 12 Uhr legte der Direktor täglich einen Stoß Zeichnungen von ehemaligen Schülern auf das Lehrerpult. Jeder sollte eine aussuchen und abzeichnen. Er selbst machte sein Mittagsschläfchen bis 14 Uhr. Wenn es laut wurde und er erwachte, war er wütend, schrie, schimpfte und schlug die Rädelsführer. Nach Weihnachten fragte er, wer von uns die Hauptschule besuchen wolle.
Wir waren drei mit diesem Ansinnen. Nun begann er uns all jenes zu lehren, was er eigentlich allen hätte beibringen sollen. Für das Landleben brauche man ja außer Lesen, Schreiben und einfaches Rechnen kein Wissen, war seine Meinung. Meine Eltern hatten damals ein Dienstmädchen aus dem Dorf einge stellt, das trotz acht Jahren Volksschulbesuch nicht Lesen und Schreiben konnte. Sie war nicht die Einzige Analphabetin.
Für mich war die Volksschulzeit die schönste Zeit in meinem Leben. In der Schule kein Lernstress, nach der Schule Freiheit. Wir Buben warfen unsere Schultaschen in eine Ecke und durchstreiften die dörfliche Freiheit. Jetzt meine ich zu ahnen, warum das Dorf mit seiner Umgebung „Freiheit“ heißt. Erst nach Einbruch der Dunkelheit liefen wir heim. Dort empfing man uns regelmäßig mit Schimpfen und Schlägen. Und war es gar zu spät, kein Abendessen und sofort ins Bett. Dazu die Drohung, uns sehr früh zu wecken, damit wir noch die Schulaufgaben machen könnten. Unser Dienstmädchen hatte jedoch Erbarmen und uns meist noch etwas zum Essen ins Bett geschmuggelt. Um mich mehr ans Haus zu binden, musste ich bereits mit sieben Jahren Klavierspielen lernen. Jede Woche fuhr ich mit einem viel zu großen Fahrrad in das vier km entfernte Röschitz, wo ich bei einer alten Klosterschwester Klavierunterricht bekam. Täglich war ich von nun an angehalten, eine Stunde lang auf dem nostalgischen Konzertflügel zu sitzen und zu üben. Der Lärm aus unserer Mühle war so laut, dass man nicht hörte, wenn ich statt zu spielen lieber dicke Bücher las… Am Ende meiner Volksschulzeit fuhr meine Großmutter mit mir in die Bezirksstadt Hollabrunn, um mich im Internat des Erzbischöflichen Seminars anzumelden. Ich sollte dort das Gymnasium besuchen. Unser Pfarrer musste für das Vorgespräch ein positives Zeugnis über mein religiöses Leben und auch über das meiner Eltern mitgeben. Der Rektor fragte mich über meinen Berufswunsch. Die Großmutter antwortete für mich: „Er will Lehrer werden.“ Damit war aber unser Besuch schon zu Ende, weil uns gesagt wurde, dass man in diesem Hause nur Priester werden könne. Als Ausbildungsweg für einen Lehrer empfahl man mir die Hauptschule Strebersdorf und anschließend die Lehrerbildungsanstalt ebendort. So wurde ich im 60 Kilometer entfernten Internat bei den Schulbrüdern eingegliedert. Als ich mit zehn Jahren aber aus meinem idyllischen Weinviertler Heimatdörfchen ins Internat übersiedeln musste, war ich nicht begeistert. In der Nachkriegszeit durften wir Zöglinge nur dreimal jährlich mit dem Zug nach Hause fahren.
Das Leben im Internat bestand aus einem streng geregelten Tagesablauf. Militärische Disziplin. Ich kam ja 1949, also in der unmittelbaren Nachkriegszeit dorthin. Wir begegneten ausschließlich Buben und Männern, letztere als Erzieher und Lehrer. In der Klassengemeinschaft musste man sich erst seinen Platz erobern und behaupten. Wir waren ja 24 Stunden täglich eng beisammen: 40 Buben aus den verschiedensten Gegenden Ostösterreichs. In der Nacht im Schlafsaal war hingegen noch eine zweite Klasse da. Ein unüberschaubarer Saal mit über siebzig Stahlrohrbetten mit je einem Sessel und an den Wänden siebzig schmale Spinde mit unseren Habseligkeiten. Es gab für niemanden einen persönlichen Ort, an dem man einmal alleine sein konnte. Auch nicht am WC. Man musste für die entsprechende Verrichtung auch in der „Freizeit“ an der Türe stehen, bis man die Erlaubnis bekam. Dann fasste man einige Stück Zeitungspapier aus und ging aufs Klosett. Verweilte allerdings jemand dort zu lange, wurde er geholt.
Die übertriebene Strenge bei der Internatserziehung machte mir zu schaffen. Es gab für alles drakonische Strafen. Für Reden auf den Gängen, Dialekt sprechen, Bett nicht mustergültig machen, Spind nicht exakt einräumen, Lesen in der Studierzeit, …
Noch jetzt, nach sechzig Jahren, bekomme ich ein ungutes Gefühl, wenn ich an die Chorstunden denke. Mit zehn Jahren wurde ich zum Schulchor eingeteilt. Wir sangen lateinische Messen. Als Bub hatte ich Probleme mit dem Lesen des lateinischen Textes. Gleichzeitig sollte ich aber stets zum Bruder Chorleiter schauen. Für mich unmöglich! So gab es oftmals Schelte und Ohrfeigen. Ich denke, viele Ge-und Verbote wurden nur erlassen, um strafen zu können, Macht auszuüben. Spaziergang in Dreierreihe.
Viel Freude machten mir die herrlichen Sportanlagen und die vielen Sportmöglichkeiten! Der Unterricht machte mir keine Probleme. Entsprach man bei einer Prüfung nicht, bekam der Erzieher, genannt Präfekt, Order und man musste nachlernen. Es war damals schon eine Form von Ganztagesschule.
Älter geworden, war das gänzliche Fehlen des Weiblichen sehr spürbar. Bis zu meinem 19. Lebensjahr hatte ich keine einzige Mitschülerin und keine Lehrerin. Aus finanziellen Gründen wurde sogar das weibliche Personal in der Küche und zum Reinigen gekündigt und wir mussten selbst den Küchendienst übernehmen.
Wir hatten unseren Klassenraum, gleichzeitig Aufenthaltsraum, im zweiten Stock. Wenn unten auf der Straße ein weibliches Wesen vorbeiging, stürzten wir alle zum Fenster und brüllten werbende und zotige Sprüche hinab. In den kurzen Ferien zu Hause mussten natürlich die Erfahrungen mit Mädchen eilends nachgeholt werden!
Ähnlich ist dieses Problem heutzutage in manchen öffentlichen Schulen. Im Kindergarten Kindergärtnerinnen, in den Volksschulen Lehrerinnen, in den höheren Schulen überwiegend weibliches Lehrpersonal. Wenn ich bedenke, dass ein großer Teil der Kinder von alleinerziehenden Müttern erzogen werden, kann ich nachvollziehen, dass das Männliche der heranwachsenden Jugend, vor allem aber den Buben, sehr fehlt.
Dass auch den Klosterbrüdern das Weibliche sehr fehlte, merkte man unter anderem daran, dass fast alle Glaubensstunden die Sexualität in irgendeiner Form zum Thema hatten. Oft wurde man vom Präfekt zur persönlichen Aussprache geholt, und auch dabei kam dieses Thema oft zur Sprache. Mir sind aber in meiner Internatszeit keine direkten sexuellen Übergriffe bekannt. Vielleicht deshalb, weil unser Präfekt eine Freundin in Wien hatte. Jeden Donnerstag tauschte er Kutte mit Anzug und parfümierte sich übertrieben, wenn er in die Wienerstadt zog. Ein Nachteil der Internatserziehung ist meines Erachtens, dass man in seiner engeren Heimat entwurzelt wird. Das innige Verhältnis zu den Eltern und Geschwistern leidet. Ich hatte oft das Gefühl, daheim nur Gast zu sein. Für die ehemaligen Freunde und Spielgefährten war ich auch nicht mehr der Gleiche wie früher. Das Leben im Heimatdorf wurde mir fremd, ich wurde meinen Freunden fremd.
Ein weiteres Problem machte mir zu schaffen: Meine Eltern mussten monatlich 400,--Schillinge für meine Schule bezahlen. Unser Dienstmädchen bekam 70,-- und der Müllergeselle 80,--Schilling monatlich. Für mein Internatsgeld hätten die Eltern sich fünf Müllergesellen leisten können und nicht so schwer arbeiten müssen.
Nach neun langen Jahren war ich endlich im Alter von neunzehn Jahren stolzer Pflichtschullehrer. Unsere Ausbildung war umfassend. Neben dem Maturastoff wurden wir in jedem Gegenstand auch zum Landlehrer ausgebildet. So wurde in Musikerziehung etwa verlangt, einen Chor leiten zu können und das Orgelspiel zu beherrschen. In Geschichte wurden wir zur Heimatforschung angeregt, in Deutsch lernten wir, eine Bibliothek anzulegen… In den letzten zwei Jahren waren wir wöchentlich je einen Tag in unserer Übungsschule, einer Volks- und einer Hauptschule, in der wir bereits Unterrichtsstunden zu halten hatten. Ich erinnere mich noch an meine erste Unterrichtsstunde als „Lehrer“. Es war eine Zeichenstunde in der dritten Klasse Volksschule. Ich hatte mit den Schülern den Wiener Stephansturm zu zeichnen. Dazu war nötig, vor den Augen der Schüler diese Kirche an die Tafel zu malen. Dabei aren meine 22 Schulkameraden, der Übungsschullehrer und mein Pädagogikprofessor kritische Beobachter. Nach jeder solchen Übungsstunde wurde das Gelungene oder auch weniger Gelungene bis ins kleinste Detail besprochen und benotet.
Als naturwissenschaftlich begabter Mensch hatte ich in meiner ganzen Schulzeit fast keine Zeichnung selber gemacht, sondern die Zeichnungen von begabten Schulkameraden für mich erledigen lassen. Diese bekamen dafür Mathematikbeispiele von mir. Wie sollte ich also jetzt den Stephansdom zeichnen, noch dazu auf der großen Tafel? Ein Freund zeichnete und malte für mich ein wunderschönes Bild.
Ich versuchte es selbst, aber ohne Erfolg. Da kam mir in der Geometriestunde die rettende Idee. Ich legte ein Koordinatensystem über die Zeichnung, merkte mir die Koordinaten der wichtigsten Eckpunkte der Kirche und musste die Punkte nur noch verbinden. Meine Zeichenstunde wurde ein Erfolg. Auch eine Religionsstunde in einer vierten Hauptschule ist mir noch in Erinnerung. In dieser hatte ich über die Kreuzzüge zu lehren. Die Schüler waren nur drei bis vier Jahre jünger als ich.
Für jede Unterrichtsstunde die wir zu halten hatten, musste eine exakte Vorbereitung geschrieben und dem Professor vorgelegt werden: Lehrziel, Methoden, Merkstoff, Tafelbild, Zusammenfassung,… Für mein späteres Lehrerleben am Gymnasium habe ich in dieser Übungsschule Vieles gelernt.
In den sogenannten Landschulwochen hatten wir in einer einklassigen Dorfschule gleichzeitig Schüler von sechs bis vierzehn Jahren zu unterrichten.





























