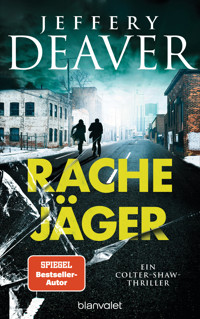8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kathryn-Dance-Thriller
- Sprache: Deutsch
Wenn Liebe zur Besessenheit wird, fühlt sie sich wie Hass an
Für die berühmte Sängerin Kayleigh Towne ist »Your Shadow« nur ihr neuester Hit. Für ihren glühendsten Fan enthält der Song jedoch eine geheime Botschaft – die sich ganz allein an ihn richtet. Um seinem Idol, seiner Angebeteten endlich nahe zu sein, muss er sich den Weg in ihr Herz erkämpfen und zerstören, was zwischen ihnen steht. Bereits mit dem ersten Mord steht für die psychologische Ermittlerin Kathryn Dance fest, dass es noch weitere Tote geben wird. Denn Stalker sind immer Wiederholungstäter ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jeffery Deaver
Die Angebetete
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Thomas Haufschild
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel»XO« bei Simon & Schuster, New York.
1. Auflage
© 2012 by Gunner Publications, LLC
© der deutschsprachigen Ausgabe 2013 by Blanvalet Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Umschlagmotiv: plainpicture/Mira
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-10156-5V003www.blanvalet.de
XO
Anmerkung des Verfassers
Die Texte aller Songs von Your Shadow, dem Countrymusic-Album im Zentrum dieses Romans, finden sich am Ende des Buches. Auf diese Lieder wird im Verlauf der Handlung immer wieder Bezug genommen, und sie können den einen oder anderen Hinweis auf den Gang der Ereignisse enthalten. Falls Sie sich den Titelsong oder die anderen Lieder des Albums gern mal anhören würden: Sie wurden vor Kurzem in Nashville aufgenommen. Auf www.jefferydeaver.com erfahren Sie Näheres über die Möglichkeit zum Download.
Für die meisten Hörer ist der Titelsong »Your Shadow – Dein Schatten« einfach ein Liebeslied.
Manch einer sieht das etwas anders.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Von:[email protected]:[email protected]:AW: Du bist die Beste!!!2. Januar, 10.32 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hallo, Edwin!
Danke für Deine E-Mail! Ich freue mich sehr, dass Dir mein neues Album gefällt! Deine Unterstützung bedeutet mir alles. Besuche auf jeden Fall mal meine Website und trage Dich für meinen Newsletter ein, dann bleibst Du über alle neuen Veröffentlichungen und Konzerttermine auf dem Laufenden. Vergiss auch nicht, mir bei Facebook und Twitter zu folgen.
Und schau regelmäßig in Deinen Briefkasten. Ich habe Dir das Autogrammfoto geschickt, um das Du gebeten hast.
XO, Kayleigh
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Von [email protected]: [email protected]: Unglaublich!!!!!3. September, 05.10 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hallo, Kayleigh!
Ich bin total hin und weg. Mir fehlen die Worte. Und Du kennst mich ja inzwischen ziemlich gut – es verschlägt mir nicht oft die Sprache!! Wie dem auch sei, es geht um Folgendes: Ich habe gestern Abend Dein neues Album heruntergeladen und mir »Your Shadow« reingezogen. Whoahhh! Das ist zweifellos der beste Song, den ich je gehört habe; der beste, der je geschrieben wurde. Er gefällt mir sogar noch besser als »It’s Going to Be Different This Time«. Ich habe Dir ja schon erzählt, dass niemand außer Dir so gut zum Ausdruck bringt, was ich über Einsamkeit, das Leben und einfach alles empfinde. Und dieser Song macht das total. Und was noch wichtiger ist, ich verstehe, was Du sagst, wie Du um Hilfe bittest. Es ist nun alles klar. Keine Sorge. Du bist nicht allein, Kayleigh!!
Ich werde Dein Schatten sein. Für immer.
XO, Edwin
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Von: [email protected]: [email protected]: WG: Unglaublich!!!!!3. September, 10.34 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sehr geehrter Mr. Sharp,
Miss Alicia Sessions, die persönliche Assistentin unserer Mandantin Kayleigh Towne und ihres Vaters, Bishop Towne, hat Ihre E-Mail vom heutigen Morgen an uns weitergeleitet. Sie haben mehr als 50 E-Mails und Briefe geschickt, seit wir uns vor zwei Monaten mit Ihnen in Verbindung gesetzt und Sie dringend gebeten haben, jegliche Kontaktaufnahme mit Miss Towne sowie ihren Freunden und Angehörigen zu unterlassen. Es erfüllt uns mit großer Sorge, dass Sie Miss Townes private E-Mail-Adresse in Erfahrung gebracht haben (wenngleich diese unterdessen geändert wurde), und wir prüfen derzeit, gegen welche Staats- und Bundesgesetze Sie dadurch verstoßen haben könnten.
Wir müssen Sie leider erneut darauf hinweisen, dass Ihr Verhalten unseres Erachtens vollkommen unangemessen ist und möglicherweise Anlass zu weiteren rechtlichen Schritten gibt. Wir legen Ihnen mit äußerstem Nachdruck nahe, diese Warnung ernst zu nehmen. Wie wir bereits mehrmals betont haben, wurden sowohl Miss Townes Sicherheitspersonal als auch die örtlichen Strafverfolgungsbehörden über Ihre wiederholten zudringlichen Kontaktversuche unterrichtet. Wir sind vollauf bereit, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um diesem beunruhigenden Verhalten ein Ende zu setzen.
Samuel King, Esq.
Crowell, Smith & Wendall, Rechtsanwälte
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Von: [email protected]: [email protected]: Bis bald!!!5. September, 23.43 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hallo, Kayleigh!
Ich habe Deine neue E-Mail-Adresse. Ich weiß, was die vorhaben, aber keine Sorge, es wird alles gut.
Im Moment liege ich im Bett und höre Dir zu. Ich fühle mich im wahrsten Sinne des Wortes wie Dein Schatten … Und Du bist meiner. Du bist so wunderbar!
Ich weiß nicht, ob Du schon Gelegenheit hattest, darüber nachzudenken – du bist sooooo beschäftigt, ich weiß! –, aber ich frage einfach noch mal: Es wäre echt cool, wenn Du mir eine Strähne von Deinem Haar schicken könntest. Ich weiß, dass Du es seit zehn Jahren und vier Monaten nicht mehr abgeschnitten hast (das ist eines der Dinge, die Dich so wunderschön machen!!!), aber vielleicht finden sich ja ein paar Haare in Deiner Bürste. Oder noch besser, auf Deinem Kissen. Ich werde sie für alle Zeit in Ehren halten.
Das Konzert nächsten Freitag kann ich kaum noch erwarten. Bis bald.
Auf ewig Dein,
XO, Edwin
SONNTAG
1
Das Herz eines Konzertsaals sind die Menschen.
Und wenn die riesige Halle – so wie hier gerade – dunkel und leer ist, verströmt sie eine fast greifbare Abneigung, eine Art Gleichgültigkeit.
Sogar Feindseligkeit.
Okay, reiß dich am Riemen, ermahnte Kayleigh Towne sich. Hör auf, dich wie ein Kind zu benehmen.
Sie stand auf der breiten verschrammten Bühne der Haupthalle des Fresno Conference Center, ließ den Blick ein weiteres Mal in die Runde schweifen und machte sich mit dem für sie typischen Perfektionismus an die Vorbereitung des für Freitag angesetzten Konzerts. Sie überdachte in immer neuen Variationen die Beleuchtung, die Bühnenshow und die Stellen, an denen die Bandmitglieder stehen und sitzen sollten. Wo sie sich am besten vorwagen, Fingerspitzen berühren und Kusshände verteilen konnte, ohne der Menge zu nahe zu kommen. Wo die beste Akustik für die Monitorboxen herrschen würde, damit die Band sich ohne Halleffekte und Rückkopplungen selbst hören konnte. Viele Künstler benutzten zu diesem Zweck mittlerweile In-Ear-Kopfhörer; Kayleigh mochte die Direktheit der traditionellen Bodenlautsprecher.
Es gab noch hundert andere Einzelheiten zu berücksichtigen. Sie war der Ansicht, dass jeder Auftritt perfekt sein sollte und dass jedes Publikum das Beste verdiente. Mehr als perfekt. Hundertzehnprozentig.
Immerhin war sie in Bishop Townes Schatten aufgewachsen.
Eine unpassende Wortwahl, merkte Kayleigh.
Ich werde Dein Schatten sein. Für immer …
Zurück zu der Planung. Diese Show musste sich von der letzten hier – vor etwa acht Monaten – unterscheiden. Ein neu gestaltetes Programm war deshalb so wichtig, weil viele der Fans die Konzerte in Kayleighs Heimatstadt regelmäßig verfolgt haben würden, und sie wollte die Leute unbedingt überraschen. Es zählte zu den Besonderheiten von Kayleigh Townes Musik, dass ihr Publikum nicht ganz so groß war wie manch ein anderes, aber dafür treu wie ein Golden Retriever. Die Fans kannten die Liedtexte auswendig, kannten Kayleighs Gitarrenlicks, kannten ihre Bewegungen auf der Bühne und lachten über ihre Scherze, bevor sie die Zeilen beenden konnte. Die Leute lebten und atmeten ihre Auftritte, hingen an ihren Lippen, kannten Kayleighs Lebenslauf, ihre Vorlieben und Abneigungen.
Und einige wollten noch viel mehr wissen …
Bei diesem Gedanken zogen sich ihr Herz und ihr Magen zusammen, als wäre sie mitten im Januar in den Hensley Lake gesprungen.
Bei dem Gedanken an ihn, natürlich.
Dann erstarrte sie und keuchte auf. Ja, da stand jemand am anderen Ende der Halle und beobachtete sie! Aus der Crew hatte niemand dort hinten zu tun.
Die Schatten bewegten sich.
Oder bildete sie sich das alles nur ein? Spielten ihre Augen ihr vielleicht einen Streich? Der liebe Gott hatte Kayleigh ein absolutes Gehör und eine engelsgleiche Stimme geschenkt. Dann hatte er beschlossen, dass das ausreichen musste, und mächtig bei ihrem Sehvermögen geknausert. Sie kniff die Augen zusammen und rückte die Brille zurecht. Ja, dahinten versteckte sich jemand. Er stand im Durchgang zum Lagerraum der Snackbar und wiegte sich vor und zurück.
Dann hörte die Bewegung auf.
Kayleigh kam zu dem Schluss, dass es wohl doch nichts gewesen war. Bloß ein Lichtreflex, ein Schattenspiel.
Andererseits hörte sie auch weiterhin ein beunruhigendes Klicken, Knacken und Knarren – von woher auch immer – und erschauderte in einem Anflug von Panik.
Er …
Der Mann, der ihr Hunderte von E-Mails und Briefen geschrieben hatte – in vertrautem Tonfall, völlig verblendet –, über das Leben, das sie gemeinsam führen könnten, und verbunden mit der Bitte, sie möge ihm Haarsträhnen oder abgeschnittene Fingernägel zusenden. Der Mann, dem es bei einem Dutzend Shows irgendwie gelungen war, Nahaufnahmen von Kayleigh zu schießen, ohne dass er dabei jemals jemandem aufgefallen wäre. Der Mann, der sich vermutlich – wenngleich es nie einen konkreten Beweis dafür gegeben hatte – während der Tour in die Bandbusse oder Wohnmobile geschlichen hatte, um einzelne Kleidungsstücke von Kayleigh zu stehlen, darunter auch Unterwäsche.
Der Mann, der ihr Dutzende Fotos von sich selbst geschickt hatte: struppiges Haar, fett, in Kleidung, die ungewaschen aussah. Die Bilder waren seltsamerweise nie obszön, sondern eher familiärer Natur, was sie nur umso verstörender machte. Sie wirkten wie die Schnappschüsse, die ein Junge von unterwegs an seine Freundin schicken würde.
Er …
Ihr Vater hatte vor Kurzem einen Leibwächter für sie engagiert, einen mächtigen Kerl mit rundem Kahlkopf, aus dessen Ohr gelegentlich ein Spiralkabel ragte und erkennen ließ, was seine Aufgabe war. Doch im Augenblick drehte Darthur Morgan draußen seine Runde und überprüfte die geparkten Fahrzeuge. Sein Sicherheitskonzept beinhaltete unter anderem die nette Idee, sich einfach regelmäßig zu zeigen, damit potenzielle Stalker lieber kehrtmachen und abhauen würden, als die Konfrontation mit einem Einhundertfünfzehn-Kilo-Mann zu riskieren, der wie ein mies gelaunter Rapper aussah (was er als Jugendlicher bestimmt auch gewesen war).
Kayleigh spähte abermals in den hinteren Teil der Halle – was die beste Stelle für ihn wäre, wenn er sie beobachten wollte. Dann biss sie die Zähne zusammen. Sie ärgerte sich über ihre Angst und noch mehr über ihr Unvermögen, die Beklemmung in den Griff zu bekommen und sich nicht länger ablenken zu lassen. Mach dich gefälligst wieder an die Arbeit, dachte sie.
Und wovor fürchtest du dich überhaupt? Du bist nicht allein. Die Band war zwar noch nicht in der Stadt – sie schloss gerade ein paar Studioaufnahmen in Nashville ab –, aber Bobby stand an dem riesigen Midas-XL8-Mischpult auf der Kontrollplattform im hinteren Teil der Halle, etwa sechzig Meter entfernt. Alicia bereitete die Probenräume vor. Zwei der bulligen Roadies aus Bobbys Truppe luden derweil die unzähligen Kisten aus dem Laster, um all die Werkzeuge und Requisiten und Sperrholzplatten und Ständer und Kabel und Verstärker und Instrumente und Computer und Stimmer zusammenzusetzen und aufzubauen – die paar Tonnen Ausrüstung eben, die auch eine mittelgroße Tourband wie die von Kayleigh benötigte.
Sie nahm an, dass einer der Jungs ihr zu Hilfe eilen würde, falls der Schatten dort tatsächlich er wäre.
Verdammt, hör endlich auf, mehr aus ihm zu machen, als er ist! Er, er, er – als hättest du Angst, auch nur seinen Namen auszusprechen. Als würdest du ihn dadurch heraufbeschwören.
Sie hatte schon andere besessene Fans gehabt, jede Menge sogar – welche großartige Singer-Songwriterin mit himmlischer Stimme würde nicht auch ein paar aufdringliche Bewunderer anziehen? Sie hatte zwölf Heiratsanträge von Männern erhalten, die ihr noch nie begegnet waren, und drei von Frauen. Ein Dutzend Paare wollten sie adoptieren, ungefähr dreißig halbwüchsige Mädchen wollten ihre beste Freundin sein, tausend Männer wollten sie zu einem Drink oder Abendessen einladen, manche in Ökorestaurants, andere in Luxushotels … und zahllose Offerten boten ihr die Freuden einer Hochzeitsnacht, ohne sich vorher der Mühe einer Eheschließung zu unterziehen. He Kayleigh denk drüber nach denn ich besorgs dir besser als dus je gekriegt hast und übrigens hier is ein Bild von dem was dich erwartet ja das bin wirklich ich nicht schlecht oder???
(Es war eine ziemlich blöde Idee, ein solches Foto an eine damals siebzehnjährige Kayleigh zu schicken.)
Für gewöhnlich fand sie es amüsant, so viel Aufmerksamkeit zu erregen. Aber nicht immer und definitiv nicht in diesem Moment. Kayleigh schnappte sich unwillkürlich ihre Jeansjacke von einem nahen Stuhl und zog sie über ihrem T-Shirt an, um allen neugierigen Blicken noch weniger Angriffsfläche zu bieten. Und das, obwohl Fresnos charakteristische Septemberhitze die dunkle Halle in einen großen Schmortopf verwandelt hatte.
Wieder dieses Klicken und Klopfen aus dem Nichts.
»Kayleigh?«
Sie fuhr herum und versuchte sich den Schreck nicht anmerken zu lassen, obwohl sie im selben Moment die Stimme erkannte.
Eine kräftige Frau von etwa dreißig Jahren blieb mitten auf der Bühne stehen. Sie hatte kurzes rotes Haar und diverse Tätowierungen auf Armen, Schultern und Rücken, die durch das enge Tanktop nur teilweise verdeckt wurden. Die ebenfalls enge und hüftbetonte Jeans steckte in modischen Cowboystiefeln. »Ich wollte dich nicht erschrecken. Alles okay?«
»Hast du nicht. Was gibt’s?«, fragte sie Alicia Sessions.
Ein Nicken in Richtung des iPads in ihrer Hand. »Die sind gerade reingekommen. Probeabzüge der neuen Poster. Wenn wir sie noch heute in die Druckerei geben, sind sie bis zur Show auf jeden Fall fertig. Gefallen sie dir?«
Kayleigh beugte sich über den Bildschirm und nahm die Poster in Augenschein. In der heutigen Musikbranche ging es natürlich nur zum Teil um Musik. Wahrscheinlich war das schon immer so gewesen, vermutete sie, doch es kam ihr so vor, als würde der geschäftliche Teil ihrer Karriere mit wachsender Popularität viel mehr Zeit in Anspruch nehmen als früher. Sie interessierte sich nicht besonders für diese Angelegenheiten und musste sich meistens auch nicht damit auseinandersetzen. Ihr Vater fungierte als ihr Manager, Alicia kümmerte sich um den täglichen Papierkram und die Termine, die Anwälte prüften die Verträge, und die Plattenfirma regelte die Details mit den Tonstudios, den CD-Presswerken, dem Einzelhandel und den Download-Portalen. Kayleighs langjähriger Produzent und Freund bei BHRC Records, Barry Zeigler, überwachte die technische Seite der Arrangements und Produktionen, und Bobby und die Crew übernahmen Aufbau und Durchführung der Shows.
Das alles geschah, damit Kayleigh Towne tun konnte, was sie am besten beherrschte: Lieder schreiben und sie singen.
Einer der wenigen geschäftlichen Aspekte, der ihr trotz allem wichtig war, betraf ihre Fans. Viele von ihnen waren jung oder besaßen nicht viel Geld, und damit sie den Abend des Konzerts in ganz besonderer Erinnerung behalten konnten, sollten sie dort preiswerte Andenken von angemessener Qualität erwerben können. Zum Beispiel Poster, T-Shirts, Schlüsselanhänger, Arm- oder Stirnbänder, Talismane, Songbooks, Rucksäcke … und Kaffeebecher – für all die Mütter und Väter, die ihre Kinder zu den Konzerten und wieder nach Hause fuhren und außerdem die Tickets bezahlten.
Kayleigh musterte die Probeabzüge. Das Motiv war sie selbst mit ihrer liebsten Martin-Gitarre – keine von den großen Dreadnoughts, sondern eine kleinere 000-18, schon alt, mit einer schmucklosen vergilbten Decke aus Fichtenholz und einer eigenen Stimme. Das Foto war zugleich das Innenbild ihres neuesten Albums Your Shadow.
Er …
Nein, hör auf.
Ihr Blick schweifte ein weiteres Mal über die Eingänge.
»Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist?«, fragte Alicia, in deren Stimme ein schwacher texanischer Akzent mitschwang.
»Ja.« Kayleigh widmete sich wieder den Postern, die alle das gleiche Foto mit unterschiedlicher Beschriftung und verschiedenen Hintergründen zeigten. Es war eine ungeschönte Aufnahme, die weitgehend dem Bild entsprach, das Kayleigh von sich selbst hatte: mit einem Meter achtundfünfzig kleiner, als es ihr lieb war, das Gesicht ein wenig lang, aber mit phänomenalen blauen Augen, vollen Wimpern und Lippen, hinter denen manche Reporter Kollagen vermuteten. Von wegen … Ihr Markenzeichen, das goldblonde, ein Meter zwanzig lange Haar – nein, nicht geschnitten, nur gestutzt, und zwar seit zehn Jahren und vier Monaten – wallte in der künstlichen sanften Brise des großen Ventilators im Fotostudio. Dazu Designerjeans und eine dunkelrote Bluse mit Stehkragen. Ein kleines diamantbesetztes Kruzifix.
»Du musst den Fans das volle Programm liefern«, pflegte Bishop Towne zu sagen. »Und damit meine ich auch die Optik. Für Männer gelten dabei andere Maßstäbe als für Frauen, und es rächt sich, wenn man das ignoriert.« Er wollte sagen, dass ein Mann sich in der Welt der Countrymusic einen Look erlauben konnte, wie er für Bishop selbst kennzeichnend war: dicker Bauch, Zigarette, ein faltiges, knorriges Gesicht mit Bartstoppeln, ein zerknittertes Hemd, verschrammte Stiefel und eine verwaschene Jeans. Eine Frau hingegen, predigte er – obwohl er eigentlich »ein Mädchen« meinte –, müsse sich wie für eine Abendverabredung zurechtmachen. Was in Kayleighs Fall natürlich den Besuch eines kirchlichen Tanztees bedeutet hätte: Sie hatte ihre Karriere auf dem Image des netten Mädchens von nebenan aufgebaut. Sicher, die Jeans durften ein wenig enger sein, und die Blusen und Pullover durften ihre weiblichen Rundungen betonen, aber sie blieben immer hochgeschlossen. Das Make-up war dezent und vorwiegend in Rosatönen gehalten.
»Gib die Poster frei.«
»Mach ich.« Alicia schaltete das iPad aus und hielt kurz inne. »Ich habe aber noch nicht das Einverständnis deines Vaters eingeholt.«
»Die sind prima«, versicherte Kayleigh.
»Ja. Ich lege sie ihm nur schnell vor. Du weißt schon.«
Nun hielt Kayleigh kurz inne. Dann: »Okay.«
»Ist die Akustik hier gut?«, fragte Alicia, die früher selbst als Künstlerin aufgetreten war. Sie hatte eine ziemlich gute Stimme und liebte die Musik, was zweifellos der Grund war, weshalb sie für jemanden wie Kayleigh Towne arbeitete, obwohl die tüchtige, selbstsichere Frau als persönliche Assistentin eines Firmenchefs leicht das Doppelte hätte verdienen können. Sie hatte ihre Stelle im letzten Frühling angetreten und die Band hier noch nie live erlebt.
»Oh, der Sound ist erstklassig«, sagte Kayleigh mit Blick auf die hässlichen Betonwände. »Würde man gar nicht vermuten.« Sie erklärte, die Konstrukteure der Halle hätten damals in den 1960er-Jahren offenbar ganze Arbeit geleistet. Es gab viele Konzertsäle – darunter auch besonders exklusive, die für klassische Musik gedacht waren –, deren Erbauer nicht daran geglaubt hatten, ein Musikinstrument oder eine Stimme könne ohne bauliche Unterstützung von der Bühne aus auch noch den hintersten Sitzplatz erreichen. Also hatten die Architekten winkelförmige Oberflächen und frei stehende Elemente hinzugefügt, um die Lautstärke der Musik zu erhöhen, was zwar gelang, aber die Schallwellen gleichzeitig in alle möglichen Richtungen ablenkte. Das Resultat war der akustische Albtraum eines jeden Künstlers, nämlich ein Widerhall, bei dem Echo auf Echo folgte, was dem Publikum einen breiigen, bisweilen sogar buchstäblich falschen Klang zu Gehör brachte.
Hier, im bescheidenen Fresno, erläuterte Kayleigh nun Alicia, so wie ihr Vater es zuvor schon einmal ihr erläutert hatte, hatten die Konstrukteure hingegen auf die Kraft und Reinheit der Stimme, des Trommelfells, des Resonanzbodens, der Rohrflöte und der Saite vertraut. Sie wollte ihre Assistentin soeben auffordern, den Refrain eines ihrer Songs mit ihr anzustimmen, um einen anschaulichen Beweis der Akustik zu liefern – Alicia sang großartig die zweite Stimme –, als ihr auffiel, dass die Frau zum hinteren Teil der Halle schaute. Vielleicht war sie von dem wissenschaftlichen Vortrag gelangweilt. Doch dann runzelte Alicia die Stirn.
»Was ist denn?«, fragte Kayleigh.
»Sind nicht nur wir beide und Bobby hier?«
»Wie meinst du das?«
»Ich dachte, ich hätte gerade jemanden gesehen.« Sie streckte den Arm aus. Ihre Fingernägel waren schwarz lackiert. »Dahinten, in dem Durchgang.«
Genau an der Stelle, an der auch Kayleigh vor wenigen Minuten einen Schatten entdeckt zu haben glaubte.
Mit feuchter Hand berührte sie geistesabwesend ihr Telefon und starrte auf die sich kontinuierlich verändernden Schemen im hinteren Teil der Halle.
Ja … nein. Sie konnte es einfach nicht sagen.
Dann zuckte Alicia die breiten Schultern, von denen eine von einer rot-grünen Schlangentätowierung geziert wurde. »Hm«, machte sie. »Wohl doch nicht. Was auch immer das war, es ist weg … Okay, dann bis später. Um eins im Restaurant?«
»Ja, da sehen wir uns.«
Kayleigh hörte, wie die Stiefelschritte sich entfernten, wandte den Blick aber nicht von den schwarzen Durchgängen ab.
Dann flüsterte sie plötzlich wütend: »Edwin Sharp.«
Da. Ich habe seinen Namen gesagt.
»Edwin, Edwin, Edwin.«
Und jetzt, da ich dich heraufbeschworen habe, hör gut zu: Verschwinde gefälligst aus meinem Konzertsaal. Ich habe zu tun.
Dann wandte sie sich von dem finster gähnenden Durchgang ab, aus dem sie natürlich keine Menschenseele belauerte. Sie ging in die Mitte der Bühne und begutachtete die Klebebandkreuze auf dem verstaubten Holzboden. Damit waren die Stellen markiert, an denen Kayleigh an verschiedenen Punkten des Konzerts stehen würde.
In diesem Moment rief jemand aus der Halle ihren Namen. »Kayleigh!« Es war Bobby, der nun hinter dem Mischpult zum Vorschein kam, dabei seinen Stuhl umwarf und sich gleichzeitig den Kopfhörer herunterriss. Er winkte ihr mit einer Hand zu und deutete mit der anderen auf einen Punkt über ihrem Kopf. »Vorsicht …! Nein, Kayleigh!«
Sie schaute nach oben und sah einen der Scheinwerferriegel – eine mehr als zwei Meter lange Colortran-Batterie – aus der Aufhängung fallen und an einem dicken Stromkabel in Richtung der Bühne schwingen.
Kayleigh wich instinktiv zurück und stolperte über einen Gitarrenständer, an den sie nicht gedacht hatte.
Mit rudernden Armen kämpfte sie keuchend um ihr Gleichgewicht …
Doch die junge Frau fiel hin und landete hart auf dem Steißbein. Die schwere Scheinwerferreihe schwang wie ein tödliches Pendel genau auf sie zu und wurde größer und größer. Kayleigh wollte sich panisch aufrappeln, wandte aber gleich wieder das Gesicht ab, weil die gleißenden Strahlen der Tausend-Watt-Birnen sie blendeten.
Dann wurde alles schwarz.
2
Kathryn Dance hatte mehrere Leben.
Verwitwete Mutter zweier Kinder, beide kurz vor dem Teenageralter.
Agentin beim California Bureau of Investigation, spezialisiert auf Verhöre und Kinesik – die Analyse der Körpersprache.
Gehorsame, wenngleich bisweilen respektlose und verärgerte Tochter, deren Eltern ganz in der Nähe wohnten.
In dieser Reihenfolge.
Und dann gab es noch Punkt Nummer vier, der für Kathryns seelisches Wohlbefinden beinahe genauso unentbehrlich war wie die ersten drei: Musik. Dance war eine Folkloristin, eine Liederjägerin, ähnlich wie Alan Lomax in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Hin und wieder nahm sie sich frei, stieg in ihren SUV – manchmal mit Kindern und Hunden, manchmal, wie jetzt, ganz allein – und machte sich auf die Pirsch nach Musik – so wie ein Jäger sich ins Unterholz schlagen würde, um ein Reh oder einen Truthahn zu erlegen.
Im Augenblick steuerte sie ihren Nissan Pathfinder den Highway 152 entlang, der von der Monterey-Halbinsel durch einen weitgehend kargen Landstrich Kaliforniens bis ins drei Stunden entfernte Fresno im San Joaquin Valley führte. Dies war das landwirtschaftliche Herz der Region, und eine endlose Kette von Zugmaschinen mit jeweils zwei offenen Anhängern voller Knoblauch, Tomaten und anderer Obst- und Gemüsesorten rollte auf die gewaltigen Lebensmittelfabriken am diesigen Horizont zu. Die Anbauflächen waren grün oder, sofern bereits abgeerntet, tiefschwarz. Alles andere hingegen war so trocken und braun wie verbrannter Toast.
Der Nissan zog eine Staubfahne hinter sich her, und auf seiner Windschutzscheibe zerplatzten Insekten.
Für die nächsten Tage hatte Dance sich vorgenommen, die hausgemachte Musik einer ortsansässigen Gruppe mexikanischer Künstler aufzuzeichnen, die alle in oder bei Fresno wohnten. Da die meisten von ihnen ihr Geld als Pflücker auf den Feldern verdienten, nannten sie sich Los Trabajadores, die Arbeiter. Dance wollte die Lieder mit ihrem Digitalrekorder aufnehmen, einem TASCAMHD-P2, der eigentlich etwas zu teuer für sie war, aber dafür erstklassige Ergebnisse lieferte. Nach entsprechender Bearbeitung würde Dance die Songs dann auf ihrer Internetseite namens American Tunes veröffentlichen. Dort konnten die Leute sie gegen eine geringe Gebühr herunterladen. Der größte Teil der so erzielten Einnahmen floss an die Musiker; Dance behielt lediglich genug zurück, um die Betriebskosten der Seite zu decken und mit den Kindern gelegentlich essen zu gehen. Durch diese Downloads wurde niemand reich, aber manche der Gruppen, die Kathryn und ihre Geschäftspartnerin Martine Christensen entdeckt hatten, waren zu regionaler oder gar landesweiter Bekanntheit gelangt.
Dance hatte bei der CBI-Dienststelle in Monterey, für die sie tätig war, gerade einen schwierigen Fall abgeschlossen und sich danach zu einer kurzen Auszeit entschieden. Die Kinder waren tagsüber in ihren Sommerlagern für Musik beziehungsweise Sport und übernachteten, ebenso wie ihre Hunde, bei den Großeltern. Kathryn hatte daher Gelegenheit, Los Trabajadores aufzunehmen und sich in Fresno, Yosemite und der Umgebung nach weiteren Talenten dieser musikalisch reichhaltigen Region umzusehen. Es gab hier nicht nur Latinomusik, sondern auch eine einzigartige Country-Spielart zu entdecken (nicht umsonst wird das Genre oft als Country-Western bezeichnet). Der Bakersfield-Sound, benannt nach der gleichnamigen Stadt einige Stunden südlich von Fresno, war sogar eine der bedeutendsten Country-Stilrichtungen gewesen und als Reaktion auf die – wie manche es empfanden – übermäßig glatten Nashville-Produktionen der Fünfzigerjahre entstanden. Künstler wie Buck Owens und Merle Haggard hatten damals die Bewegung in Gang gesetzt, und in letzter Zeit war sie durch Musiker wie Dwight Yoakam und Gary Allan wiederaufgelebt.
Dance nippte an ihrer Sprite und schaltete von einem Radiosender zum nächsten. Sie hatte in Erwägung gezogen, aus dieser Reise einen romantischen Kurzurlaub mit Jon Boling zu machen. Doch er hatte zugesagt, ein Start-up-Unternehmen der Computerbranche zu beraten, und würde für einige Tage unabkömmlich sein. Außerdem war es Dance aus irgendeinem Grund ganz recht, allein unterwegs zu sein. Der kürzlich abgeschlossene Entführungsfall hatte ihr zugesetzt; nur zwei Tage zuvor hatte sie an der Beisetzung des einen Opfers teilgenommen, das sie nicht hatten retten können. Die beiden anderen, die mehr Glück gehabt hatten, waren ebenfalls dabei gewesen.
Sie drehte die Klimaanlage höher. Auf der Monterey-Halbinsel war es zu dieser Jahreszeit angenehm, sogar bisweilen kühl, und Kathryn war entsprechend gekleidet. Nun war es ihr in ihrer langärmeligen grauen Baumwollbluse und der Bluejeans viel zu warm. Sie nahm die rosa geränderte Brille ab und putzte sie mit einer Serviette, während sie das Lenkrad zwischen den Knien hielt. Ein Schweißtropfen war ihr mitten über eines der Gläser gelaufen. Der Bordcomputer des Pathfinder meldete Sechsunddreißig Grad Außentemperatur.
September. Von wegen.
Dance freute sich noch aus einem anderen Grund auf die Reise – sie würde die einzige Berühmtheit unter ihren Freunden treffen, Kayleigh Towne, die inzwischen allseits bekannte Singer-Songwriterin. Kayleigh unterstützte schon seit Jahren Dance’ und Martines Internetseite und damit auch die dort präsentierten einheimischen Musiker. Sie hatte Dance zu ihrem großen Konzert am Freitagabend in Fresno eingeladen. Kayleigh war zwar ein Dutzend Jahre jünger als Kathryn, stand aber schon auf der Bühne, seit sie neun oder zehn war, und war bereits als Teenager ins Profilager gewechselt. Sie war witzig, klug und eine hervorragende Texterin und Unterhaltungskünstlerin, dabei aber völlig uneitel und deutlich reifer, als ihr Alter vermuten ließ. Dance war sehr gern mit ihr zusammen.
Außerdem war sie die Tochter der Countrymusic-Legende Bishop Towne.
Dance hatte bisher zwei oder drei von Kayleighs Auftritten verfolgt und sie in Fresno besucht. Dabei hatte sie auch die Bekanntschaft von Bishop gemacht, der mit bärenhafter Statur und gewaltigem Ego ins Zimmer getrampelt war und die Intensität eines Mannes verströmt hatte, der heutzutage ebenso leidenschaftlich abstinent lebte, wie er früher kokain- und alkoholabhängig gewesen war. Er hatte endlos über andere Leute in der Branche schwadroniert: Musiker, die er gut kannte (Hunderte), Musiker, von denen er gelernt hatte (nur die ganz Großen), Musiker, denen er ein Mentor gewesen war (die meisten der heutigen Superstars), und Musiker, mit denen er sich geprügelt hatte (von denen es ebenfalls jede Menge gab).
Er war laut, ungehobelt und unverblümt theatralisch aufgetreten; Dance war fasziniert gewesen.
Sein letztes Album hingegen hatte keinen Erfolg gehabt. Bishops Stimme hatte ihn im Stich gelassen, seine einstige Energie auch, und das waren genau die beiden Aspekte, an denen sogar die ausgefeilteste Digitaltechnik eines Aufnahmestudios kaum etwas ändern kann. Hinzu kamen die abgedroschenen Songs, die nichts mehr mit den brillanten Texten und Melodien zu tun hatten, denen er seinen früheren Erfolg verdankte.
Dessen ungeachtet besaß er eine treue Gefolgschaft und behielt Kayleighs Karriere fest im Griff; wehe jedem Produzenten, Plattenboss oder Veranstalter, der Bishops Tochter nicht anständig behandelte.
Dance erreichte nun die Stadtgrenze von Fresno. Das hundertsechzig Kilometer westlich gelegene Salinas Valley mochte als die Salatschüssel der Nation bekannt sein, doch das San Joaquin Valley war größer und ertragreicher, und Fresno war sein Zentrum. Es handelte sich um eine schmucklose Arbeiterstadt, etwa eine halbe Million Einwohner groß. Es gab ein paar Gangs und die gleiche Mischung von Straftaten wie derzeit in allen mittelgroßen Städten: häusliche Gewalt, Überfälle, Morde und sogar vereinzelte Terrordrohungen. Insgesamt lag die Verbrechensrate leicht über dem landesweiten Durchschnitt. Der Grund dafür, vermutete Dance, war die hohe Arbeitslosenquote von ungefähr achtzehn Prozent. Ihr fielen mehrere junge Männer auf, die wie lebende Beweise dieser Statistik wirkten. Sie lungerten an den Straßenecken herum, trugen ärmellose T-Shirts und ausgebeulte Shorts oder Jeans und schauten den vorbeifahrenden Autos hinterher oder plauderten und lachten und tranken aus Flaschen in braunen Papiertüten.
Von dem glühend heißen Asphalt stieg Staub auf, und die Luft flimmerte. Hunde saßen auf Veranden und starrten ins Leere, und Dance erhaschte kurze Blicke auf Kinder in den Gärten hinter den Häusern, wo sie fröhlich über die laufenden Rasensprenger hüpften, was im fortwährend von Dürre geplagten Kalifornien zwar nicht illegal, aber zumindest bedenkenswert war.
Dank des Navigationsgeräts fand sie mühelos zum Mountain View Motel am Highway 41. Trotz des Namens gab es dort keinen solchen Ausblick, aber das mochte am Dunst liegen. Dance kniff die Augen zusammen und spähte nach Osten und Norden. Es ließen sich allenfalls ein paar bescheidene Gebirgsausläufer erkennen, die sich erst viele Meilen später zum majestätischen Yosemite aufschwingen würden.
Dance stieg aus in die brütende Hitze und fühlte sich tatsächlich benommen. Das Frühstück mit den Kindern und Hunden lag schon lange zurück.
Ihr Zimmer war noch nicht fertig, aber das spielte keine Rolle, denn sie war in einer halben Stunde – um dreizehn Uhr – mit Kayleigh und einigen Freunden verabredet. Sie deponierte ihr Gepäck an der Rezeption und stieg wieder in den Pathfinder, in dem es bereits heiß wie in einem Backofen war.
Dann gab sie eine andere Adresse in das Navi ein, fuhr los und folgte pflichtgetreu den Richtungsanweisungen. Sie fragte sich, wieso die einprogrammierten Stimmen dieser Geräte meistens weiblich waren.
An einer roten Ampel nahm sie ihr Telefon und überprüfte die Liste der eingegangenen Anrufe und Textnachrichten.
Leer.
Gut, dass niemand aus dem Büro oder den Lagern der Kinder sie zu erreichen versucht hatte.
Aber seltsam, dass nichts von Kayleigh dabei war, die eigentlich im Laufe des Vormittags hatte anrufen wollen, um das Treffen zu bestätigen. Das war nämlich einer der Punkte, die Dance an der Künstlerin stets beeindruckt hatten: Ungeachtet ihrer Berühmtheit vernachlässigte sie nie die Kleinigkeiten. Sowohl im »normalen« Leben als auch auf der Bühne wirkte sie vollauf verantwortungsbewusst.
Dance wählte Kayleighs Nummer.
Und landete direkt bei der Mailbox.
Kathryn Dance musste lachen.
Die Eigentümer des Cowboy Saloon besaßen Humor. Der dunkle, in Holz gehaltene und erfreulich gut klimatisierte Laden hatte kein einziges Cowboy-Utensil vorzuweisen. Das Leben im Sattel wurde dennoch ausgiebig repräsentiert – durch die Frauen, die in diesem Beruf ritten, mit Lasso und Brandeisen umzugehen wussten und das Vieh trieben … und auch den Revolver schwangen, wenn man dem Poster glauben durfte, auf dem eine Wildwestversion von Rosie der Nieterin Flaschen von der Querlatte eines Zaunes schoss.
Laut der Filmplakate, vergrößerten Buchumschläge, Butterbrotdosen, Spielzeuge, Gemälde und Fotos musste es im Wilden Westen von langhaarigen, vollbusigen Mädchen gewimmelt haben, die Hüte mit breiter Krempe trugen, neckische Halstücher, Wildlederröcke und bestickte Blusen sowie einige der herrlichsten Stiefel, die je angefertigt wurden. Kathryn Dance hatte eine Schwäche für Schuhe und besaß zwei Paar hochwertige Noconas. Doch keines von beiden konnte sich auch nur annähernd mit den Prachtexemplaren messen, die Dale Evans – Roy Rogers’ Costar in seiner Fernsehshow der Fünfzigerjahre – hier auf einem verblassten Poster trug.
Kathryn ging zum Tresen, bestellte ein Glas Eistee, leerte es durstig und bestellte ein weiteres. Dann setzte sie sich an einen der runden, vielfach überlackierten und zerkratzten Tische und musterte die Kundschaft. Zwei ältere Paare, drei erschöpfte Arbeiter in Overalls der Stadtwerke, deren Dienst vermutlich schon im Morgengrauen begonnen hatte, ein schlanker junger Mann in Jeans und Karohemd, der die altmodische Jukebox betrachtete, und einige Geschäftsleute mit weißen Hemden und dunklen Krawatten, aber ohne Jacketts.
Kathryn freute sich darauf, Kayleigh zu sehen und die Songs der Trabajadores aufzunehmen. Und sie freute sich auf das Mittagessen. Sie hatte einen Mordshunger.
Außerdem machte sie sich Sorgen.
Es war jetzt zwanzig nach eins. Wo blieb ihre Freundin?
Aus der Jukebox ertönte ein Lied. Dance lachte auf. Es war ein Song von Kayleigh Towne – und angesichts dieses Ortes auch noch ein besonders gut gewählter: »Me, I’m Not a Cowgirl.«
In dem Lied ging es um eine gewöhnliche Hausfrau und Mutter, deren Leben nichts mit dem Dasein eines Cowgirls zu tun zu haben scheint, bis ihr am Ende klar wird, dass womöglich doch eine Geistesverwandtschaft besteht. Es war ein typischer Kayleigh-Song, fröhlich und unbeschwert, aber dennoch mit einer Aussage.
In diesem Moment öffnete sich die Vordertür, und ein gleißender Sonnenstrahl fiel auf den verschrammten Linoleumboden, über den geometrische Formen tanzten, die Schatten der Eintretenden.
Dance stand auf. »Kayleigh!«
Umgeben von vier weiteren Leuten betrat die junge Sängerin das Restaurant, zwar lächelnd, aber mit einem schnellen Blick in die Runde. Dance merkte sofort, dass ihr irgendwas zu schaffen machte. Nein, mehr als das. Kayleigh Towne hatte Angst.
Doch was auch immer sie hier vorzufinden befürchtet hatte, war nicht da, und ihre Anspannung ließ nach. Sie trat vor und schloss Dance fest in die Arme. »Kathryn, hallo. Das ist so großartig!«
»Ich konnte es kaum erwarten herzukommen.«
Die Sängerin trug Jeans und seltsamerweise eine dicke Denim-Jacke, trotz der Hitze. Ihr herrliches Haar fiel offen herab; es war fast so lang, wie sie groß war.
»Ich hab zweimal versucht, dich zu erreichen«, fügte Dance hinzu.
»Es gab … äh, ein kleines Problem im Konzertsaal. Nichts Wichtiges. He, Leute, das ist meine Freundin Kathryn Dance.«
Dance begrüßte Bobby Prescott, den sie seit einigen Jahren kannte. Mitte dreißig, gut aussehend wie ein Schauspieler, mit zurückhaltendem Lächeln und braunem Lockenschopf. Ebenfalls dabei war der dickliche und überaus schüchterne Tye Slocum mit seiner langen roten Mähne, die dringend mal gestutzt werden musste. Er war für die Instandhaltung und Reparatur der Gitarren der Band zuständig. Die ernste, muskulöse Alicia Sessions, die für Dance so aussah, als gehöre sie in einen Punkrock-Club in Downtown Manhattan, war Kayleighs persönliche Assistentin.
Und dann war da noch jemand. Ein Afroamerikaner, etwa eins neunzig groß und um die hundertfünfzehn Kilo schwer.
Ein Aufpasser.
Die Tatsache, dass Kayleigh einen Leibwächter hatte, war keine Überraschung, wenngleich Dance besorgt registrierte, dass der Mann auch hier drinnen aufmerksam alles im Blick behielt. Er nahm jeden der Anwesenden genau in Augenschein – den jungen Mann bei der Jukebox, die Arbeiter, die Geschäftsleute und sogar die älteren Paare und den Barkeeper. Er hielt eindeutig Ausschau nach einer potenziellen Gefahr.
Was war der Grund dafür?
Offenbar fand er zunächst keine Anzeichen einer Bedrohung und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf Kayleigh, ohne jedoch in seiner Konzentration nachzulassen. Das war charakteristisch für Leute wie ihn – deshalb waren sie so gut. Er ging in Wartestellung. »Sieht okay für mich aus.«
Sein Name war Darthur Morgan. Als er Dance die Hand gab, sah er sie durchdringend an, und in seinem Blick flackerte Erkennen auf. Als Kinesik-Expertin wusste Dance, dass ihre Körpersprache den Cop in ihr verriet, auch wenn sie das gar nicht beabsichtigte.
»Essen Sie mit uns«, forderte Kayleigh den großen Mann auf.
»Nein, vielen Dank, Ma’am. Ich warte draußen.«
»Nein, es ist zu heiß.«
»Draußen ist es sinnvoller.«
»Nun, dann holen Sie sich wenigstens einen Eistee oder eine Limo. Und kommen Sie herein, falls Ihnen zu warm wird.«
Doch er bestellte kein Getränk, sondern ging nur langsam durch das halbdunkle Restaurant zur Tür und mit einem kurzen Blick auf die Wachsfigur eines lassoschwingenden Cowgirls weiter nach draußen.
Der hagere Barkeeper brachte die Speisekarten und konnte seinen bewundernden Blick kaum von Kayleigh Towne abwenden. Sie lächelte dem jungen Mann mütterlich zu, obwohl sie ungefähr im gleichen Alter war.
Kayleigh schaute zur Jukebox. Es war ihr sichtlich peinlich, dass ihre eigene Stimme ihnen ein Ständchen sang.
»Also, was ist passiert?«, fragte Dance.
»Okay, ich werd’s dir verraten.« Sie erklärte, dass sich während der Vorbereitungen für das bevorstehende Konzert eine lange Scheinwerferbatterie über der Bühne gelöst hatte und heruntergefallen war.
»Mein Gott. Geht es dir gut?«
»Ja, sicher. Abgesehen von einem blauen Fleck am Hintern.«
Bobby, der neben Kayleigh saß, legte ihr eine Hand auf den Arm und sah sie besorgt an. »Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte«, sagte er leise. »Es war ein fest installierter Scheinwerferriegel. Die werden nicht je nach Bedarf an- und abmontiert, sondern hängen immer da.«
»Und außerdem hast du sie doch überprüft, Bobby«, fügte der große Tye Slocum mit scheu gesenktem Blick hinzu. »Ich hab dich gesehen. Zweimal. Sämtliche Scheinwerfer. Bobby ist der beste Roadie, den es gibt. Ein solcher Unfall ist noch nie passiert.«
»Wenn das Ding sie getroffen hätte, wär’s das wohl gewesen«, fügte Alicia wütend hinzu. »Sie hätte tot sein können.«
»Die Strahler sind mit Tausend-Watt-Birnen bestückt«, erläuterte Bobby. »Wenn die zerbrochen wären, hätte ein Feuer ausbrechen können. Ich habe vorläufig den Strom abgeschaltet für den Fall, dass es doch eine Beschädigung gegeben hat. Heute Abend, wenn ich zurück bin, sehe ich mir das genauer an. Aber vorher muss ich noch nach Bakersfield und eine neue Verstärker- und Lautsprecherbank abholen.«
Dabei beließen sie es und widmeten sich den Speisekarten. Dance war nach dem Entführungsfall in Topform – sie hatte vier Kilo abgenommen – und beschloss, sich eine Portion Pommes frites zu ihrem Sandwich mit gegrilltem Hühnchen zu gönnen. Kayleigh und Tye bestellten Salate. Alicia und Bobby wählten Tostadas und dazu Kaffee, trotz der Hitze. Das Gespräch drehte sich nun um Dance’ musikalisches Interesse, und sie erzählte ein wenig von ihren eigenen gescheiterten Versuchen, als Sängerin in San Francisco Fuß zu fassen.
»Kathryn hat eine tolle Stimme«, sagte Kayleigh und ließ dabei fünf oder sechs kinesische Reaktionen erkennen, die auf eine Irreführung hindeuteten. Dance lächelte.
»Verzeihung«, ertönte die Stimme eines Mannes. »Hallo, Kayleigh.«
Es war der junge Mann von der Jukebox. Lächelnd nickte er Dance und den anderen zu und sah dann Kayleigh an.
»Hallo.« Der Tonfall der Sängerin hatte sich schlagartig geändert. Sie klang freundlich, aber zurückhaltend.
»Ich wollte nicht lauschen, aber ich habe mitbekommen, dass es irgendein Problem gegeben hat. Bist du in Ordnung?«
»Aber ja, danke.«
Es herrschte kurz Stille, und zwar die Sorte, die zu besagen schien: Danke für dein Interesse, aber du kannst jetzt gehen.
»Bist du ein Fan?«, fragte Kayleigh.
»Na klar.«
»Nun, dann danke für deine Unterstützung. Und deine Sorge. Kommst du am Freitag zum Konzert?«
»Oh, aber sicher. Ich werde da sein. Das würde ich um alles in der Welt nicht verpassen wollen. Geht es dir wirklich gut?«, hakte der Mann nach.
Wieder eine Pause, fast schon peinlich. Vielleicht dachte Kayleigh über die letzte Frage nach.
»Ja, ganz bestimmt.«
»Okay, Kumpel«, sagte Bobby. »Machen Sie’s gut. Wir würden jetzt gern zu Mittag essen.«
Der Mann lachte leise auf. »Du erkennst mich nicht, oder?«, fragte er, als wäre der Roadie gar nicht anwesend.
»Tut mir leid«, sagte die Sängerin.
»Gönnen Sie Miss Towne doch bitte etwas Privatsphäre«, stellte Alicia mit entschiedener Stimme fest.
»Hallo, Alicia«, sagte der junge Mann zu ihr.
Die persönliche Assistentin war sichtlich verblüfft. Sie kannte den Mann nicht und fragte sich, woher er ihren Namen wusste.
Der Mann ignorierte sie nun und lachte erneut, diesmal mit hoher, unheimlicher Stimme. »Ich bin’s, Kayleigh! Edwin Sharp. Dein Schatten.«
3
Ein lauter Knall hallte durch das Restaurant, als Kayleighs Eistee ihr aus den Fingern glitt und am Boden zerschellte.
Das große Glas traf dabei in einem solchen Winkel auf, dass das Geräusch wie ein Schuss klang. Dance ertappte sich dabei, dass sie unwillkürlich nach der Glock griff – aber die Pistole lag gegenwärtig bei ihr zu Hause, eingeschlossen in der Metallkassette neben dem Bett.
»Du … du bist … Edwin?«, stammelte Kayleigh keuchend und mit großen Augen.
Ihre Reaktion war fast schon panisch, doch er runzelte mitfühlend die Stirn und sagte: »He, Kayleigh, alles in Ordnung. Kein Problem.«
»Aber …« Ihr Blick huschte zur Tür, auf deren anderer Seite sich Darthur Morgan befand – mitsamt seiner Waffe, wie Dance glaubte.
Kathryn versuchte sich einen Reim auf die Situation zu machen. Der Kerl konnte kein Exfreund von Kayleigh sein, sonst hätte sie ihn früher erkannt. Also wohl ein aufdringlicher Fan. Kayleigh war genau die Art von Künstlerin, die Stalker anziehen würde: hübsch, Single, talentiert.
»Ich kann verstehen, dass du mich nicht gleich erkannt hast«, sagte Edwin Sharp, um sie bizarrerweise zu trösten, ohne zu begreifen, dass er es war, der ihr Angst einjagte. »Seit ich dir das letzte Mal ein Foto von mir geschickt habe, bin ich etwas dünner geworden. Ich hab ganze dreiunddreißig Kilo abgenommen.« Er klopfte sich auf den Bauch. »Das habe ich dir absichtlich nicht geschrieben. Es sollte eine Überraschung sein. Ich lese regelmäßig die Country Week und Entertainment Weekly und habe die Fotos von dir und einigen dieser Jungs gesehen. Ich weiß, dass du schlanke Männer bevorzugst, keine rundlichen Typen. Und ich hab mir einen Fünfundzwanzig-Dollar-Haarschnitt verpassen lassen! Du weißt ja, dass viele Männer ständig davon reden, sie würden sich ändern, ohne dass je etwas daraus wird. Wie in deinem Song. Ich wollte kein Mr. Morgen für dich sein. Ich bin ein Mr. Heute.«
Kayleigh bekam kein Wort heraus. Sie hyperventilierte beinahe.
Aus manchen Winkeln sah Edwin gar nicht so schlecht aus – dichtes Haar, konservativ frisiert wie bei einem Politiker und mit viel Spray fixiert, wache dunkelbraune Augen, glatte Haut, wenngleich etwas blass. Aber sein Gesicht war auch sehr lang und kantig, mit deutlich hervorstehenden Brauenwülsten. Er war in guter Form, ja, aber groß – größer als sie es zunächst wahrgenommen hatte, bestimmt eins fünfundachtzig oder mehr, und trotz des Gewichtsverlustes wog er etwa neunzig Kilo. Seine Arme waren lang, die Hände auffallend groß und von seltsamer und beunruhigender rosa Färbung.
Bobby Prescott sprang auf und stellte sich dem Mann in den Weg. Auch er hatte eine massige Statur, war aber eher breit als hoch, sodass Edwin ihn überragte. »He«, sagte Edwin fröhlich. »Bobby, der Roadie. Verzeihung – Chef der Roadcrew.«
Und dann richtete sein Blick sich wieder schmachtend auf Kayleigh. »Es wäre mir eine Ehre, wenn wir ein Glas Eistee zusammen trinken könnten. Gleich da drüben in der Ecke. Ich hab ein paar Sachen, die ich dir zeigen möchte.«
»Woher hast du …?«
»Gewusst, dass du hier sein würdest? Mensch, jeder weiß doch, dass dies dein Lieblingsladen ist. Steht doch in allen Blogs. Hier hast du ›Me, I’m Not a Cowgirl‹ geschrieben.« Er nickte in Richtung der Jukebox, aus der gerade genau jenes Lied erklang – inzwischen zum zweiten Mal, registrierte Dance.
The suburbs and the cities, that’s what I’m about.Me, I’m not a cowgirl, unless maybe you count:Looking people in the eye and talking to them straight.Not putting up with bigots or cheaters or with hate.Remembering everything my mom and daddy saidabout how to treat my family, my country and my friends.Didn’t think I was a cowgirl, but I guess that all depends.
(Die Stadt und die Vororte, das ist meine Welt.Ich bin kein Cowgirl, es sei denn, du meinst damit,dass ich den Leuten ins Gesicht sehe und offen mit ihnen rede,dass ich Fanatiker, Betrüger und Hass nicht ausstehen kann.Ich beherzige, was meine Mutter und mein Vater mich gelehrt haben,wie ich meine Familie, mein Land und meine Freunde behandeln soll.Ich hätte mich nie als Cowgirl bezeichnet, aber womöglich kommt es nur auf die Betrachtungsweise an.)
»Ich liebe diesen Song«, schwärmte er. »Ich liebe ihn einfach. Aber das weißt du ja. Ich hab es dir bestimmt schon hundertmal geschrieben.«
»Ich … ich …« Kayleigh war wie ein Reh im Scheinwerferlicht.
Bobby legte Edwin eine Hand auf die Schulter. Nicht unbedingt feindselig, nicht unbedingt freundlich. Dance fragte sich, ob dies der Anfang einer Prügelei sein würde, und griff nach ihrer einzigen Waffe – ihrem Mobiltelefon –, um gegebenenfalls den Notruf zu wählen. Doch Edwin wich einfach ein Stück zurück und kümmerte sich nicht um Bobby. »Na los, lass uns Eistee bestellen. Ich weiß, dass du den hier für den besten der Stadt hältst. Du bist eingeladen. Mr. Heute, weißt du noch? He, dein Haar ist wirklich wunderschön. Zehn Jahre, vier Monate.«
Dance hatte keine Ahnung, was er meinte, aber er setzte Kayleigh damit eindeutig noch mehr zu. Ihr Unterkiefer bebte.
»Kayleigh möchte ihre Ruhe haben«, sagte Alicia streng. Die Frau schien ebenso kräftig wie Bobby Prescott zu sein, und ihr wütender Blick war sogar noch bohrender.
»Gefällt es Ihnen, für die Band zu arbeiten, Alicia?«, fragte er, als würde er mit ihr auf einer Cocktailparty plaudern. »Sie sind jetzt wie lange dabei? Fünf, sechs Monate, richtig? Sie haben ebenfalls Talent. Ich hab Sie auf YouTube gesehen. Sie können richtig gut singen. Wow.«
Alicia beugte sich bedrohlich vor. »Was, zum Teufel, ist das hier? Woher kennen Sie mich?«
»Hören Sie, Kumpel«, murmelte Bobby. »Sie sollten jetzt gehen.«
Dann schob Tye Slocum langsam seinen Stuhl zurück und ging mit großen Schritten zur Tür. Edwins Blick folgte ihm, und auf seinem Gesicht lag dabei immer noch dasselbe unerschütterliche Lächeln, das er vom ersten Moment an zur Schau gestellt hatte. Aber etwas hatte sich geändert; es war, als hätte er tatsächlich erwartet, dass Kayleigh sich zu ihm gesellen würde, und wäre nun verblüfft, dass sie es nicht tat. Ferner schien es ihn zu ärgern, dass Tye den Leibwächter holte. »Kayleigh, bitte. Ich wollte dich hier nicht stören, aber du hast ja nie auf meine E-Mails geantwortet. Ich möchte nur mit dir plaudern. Es gibt viel zu besprechen.«
»Ich kann wirklich nicht.«
Bobby griff abermals nach Edwins Arm, bevor Dance einschreiten konnte. Doch erneut wich der Mann einfach zurück. Er schien keinerlei Interesse an einer Konfrontation oder gar an einer tätlichen Auseinandersetzung zu haben.
Licht blitzte auf, und der Tisch wurde in Helligkeit getaucht, als die Tür sich öffnete. Dann schob sich ein Schatten dazwischen. Darthur Morgan nahm die Pilotenbrille ab und eilte herbei. Er sah Edwin ins Gesicht, und Dance erkannte, wie die Muskeln um seinen Mund sich anspannten; er ärgerte sich, weil der neuerdings schlanke Stalker ihm entgangen war.
»Sie sind Edwin Sharp?«
»Ganz recht, Mr. Morgan.«
Es war heutzutage nicht schwierig, Informationen über andere Leute zu sammeln, vor allem, wenn sie zum Umfeld einer sogenannten öffentlichen Person wie Kayleigh Towne gehörten. Aber den Namen ihres Leibwächters in Erfahrung zu bringen?
»Ich muss Sie bitten, Miss Towne in Ruhe zu lassen. Sie möchte, dass Sie gehen. Sie sind ein Sicherheitsrisiko.«
»Nun, gemäß Giles gegen Lohan bin ich das keineswegs, Mr. Morgan. Von mir geht nicht mal eine unterschwellige Gefahr aus. Aber wie dem auch sei – ich möchte wirklich niemanden verletzen oder in Bedrängnis bringen. Ich bin nur hier, um einer Freundin von mir mein Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen, weil ihr etwas Traumatisches zugestoßen ist. Und um ihr einen Eistee zu spendieren. Ihnen auch, falls Sie möchten.«
»Ich denke, das reicht jetzt«, sagte Morgan unbeeindruckt.
»Sie sind lediglich eine Privatperson«, stellte Edwin ruhig fest. »Sie könnten mich nur festnehmen, falls Sie mich bei der Begehung einer Straftat erwischen würden. Und ich habe nichts Illegales getan. Wären Sie ein Polizeibeamter, sähe das anders aus, aber da Sie …«
Tja, das musste wohl so kommen, dachte Dance, stand auf und zeigte ihren CBI-Dienstausweis vor.
»Ah.« Edwin nahm das Dokument übertrieben lange in Augenschein, als würde er es sich einprägen. »Mir war doch gleich so, als hätten Sie was Offizielles an sich.«
»Können Sie sich irgendwie ausweisen?«
»Natürlich.« Er gab ihr seinen Führerschein, ausgestellt im Staat Washington. Edwin Stanton Sharp. Mit einer Adresse in Seattle. Das Foto zeigte in der Tat einen wesentlich schwereren Mann mit langen strähnigen Haaren.
»Wo wohnen Sie hier in Fresno?«, fragte Dance.
»In einem Haus am Woodward Park. Einer dieser Neubauten. Gar nicht mal so schlecht.« Ein Lächeln. »In Fresno wird es ganz schön heiß.«
»Sie sind hergezogen?«, flüsterte Alicia ungläubig.
Kayleighs Augen wurden noch größer, und ihre Schultern hoben sich.
»Nein, ich wohne bloß zur Miete. Für eine Weile. Ich bin wegen des Konzerts in der Stadt. Das wird das beste des ganzen Jahres. Ich kann es kaum noch erwarten.«
Wieso mietete jemand ein ganzes Haus, um ein einziges Konzert zu besuchen?
»Nein, Sie wollten Kayleigh weiter belästigen«, platzte es aus Bobby heraus. »Die Anwälte haben Sie doch ausdrücklich gewarnt.«
Anwälte?, wunderte Dance sich.
Edwin ließ den Blick über die Anwesenden schweifen. Sein Lächeln verblasste. »Ich würde sagen, so wie Sie alle sich hier aufführen, bringen Sie Kayleigh nur noch mehr aus der Fassung.« Er wandte sich an sie. »Es tut mir leid. Ich weiß, womit du dich herumplagen musst. Aber keine Sorge, es wird alles gut.« Er ging zur Tür, hielt inne und drehte sich noch einmal um. »Auch Ihnen noch einen schönen Tag, Agent Dance. Gott segne Sie für all die Opfer, die Sie den Bürgern dieses Staates bringen.«
4
Als Dance sagte: »Raus damit!«, legten sie los. Alle auf einmal.
Erst nachdem sie den Schwall an Informationen etwas geordnet hatte, gewann sie allmählich den Überblick. Letzten Winter war ein Fan zu der Überzeugung gelangt, Kayleighs automatisch versandte Formbriefe und E-Mails, die stets mit einem »XO, Kayleigh« endeten – also dem Buchstabenpiktogramm für einen Kussmund und eine Umarmung –, seien wörtlich aufzufassen. Da die Songs ihm angeblich so viel bedeuteten und seine Sicht auf das Leben perfekt ausdrückten, war er zu dem Schluss gelangt, er und Kayleigh seien Seelenverwandte. Von da an hatte er sie mit Nachrichten bombardiert – per E-Mail, Facebook und Twitter sowie handschriftlich per Brief – und ihr Geschenke geschickt.
Kayleigh und ihre Mitarbeiter folgten dem Rat, den Mann zu ignorieren, und reagierten nicht mehr auf ihn; nur die Geschenke schickten sie zurück. Edwin Sharp ließ sich davon nicht beirren. Anscheinend glaubte er, Kayleighs Vater und ihre Betreuer fühlten sich durch die Verbindung zwischen ihm und der Sängerin bedroht und wollten sie auseinanderbringen.
Er wurde verwarnt, Dutzende Male. Die Anwälte Kayleighs und ihres Vaters drohten ihm rechtliche Schritte sowie eine Anzeige für den Fall an, dass er sein Verhalten nicht unterließ.
Er unterließ es nicht.
»Das war so gruselig«, sagte Kayleigh nun mit zitternder Stimme und trank einen Schluck Tee. Der Barkeeper hatte ihr ein neues Glas gebracht, als er gekommen war, um die Scherben einzusammeln und die Pfütze aufzuwischen. »Er wollte eine Haarsträhne, einen abgeschnittenen Fingernagel, den Abdruck meiner Lippen auf einem Stück Papier. Er hatte Fotos von mir an Orten, an denen ich niemanden sonst bemerkt hatte. Backstage oder auf Parkplätzen.«
»Das ist ja das wirklich Schlimme bei einer solchen Straftat«, sagte Dance. »Man weiß nie so genau, wo der Stalker sich aufhält. Vielleicht meilenweit weg, vielleicht draußen vor deinem Fenster.«
»Und dann seine Nachrichten!«, fuhr Kayleigh fort. »Hunderte von Briefen und E-Mails. Wenn ich meine E-Mail-Adresse gewechselt habe, dauerte es nur wenige Stunden, und er kannte die neue.«
»Glaubst du, er könnte etwas mit dem Scheinwerfer zu tun gehabt haben, der heute heruntergefallen ist?«, fragte Dance.
Kayleigh sagte, sie habe am Vormittag im Kongresszentrum mehrmals den Eindruck gehabt, irgendwas »Komisches« gesehen zu haben, womöglich nur irgendwelche Schatten, womöglich auch gar nichts. Sie hatte jedenfalls niemanden erkannt.
Alicia Sessions war sich da sicherer. »Ich hab auch was gesehen, hundertprozentig.« Sie zuckte die breiten Schultern, wodurch kurz ihre Tätowierungen aufblitzten, die ansonsten weitgehend durch den Stoff verdeckt wurden. »Leider nichts Konkretes. Kein Gesicht, keine Gestalt.«
Die Band war noch nicht in der Stadt, und der Rest der Crew hatte sich während des Vorfalls außerhalb der Halle aufgehalten. Bobby hatte ebenfalls nichts bemerkt, nur den Scheinwerferriegel, als dieser sich aus der Aufhängung gelöst hatte.
»Wissen die hiesigen Behörden über Sharp Bescheid?«, fragte Dance.
»O ja, allerdings«, antwortete die Sängerin. »Die wussten, dass er vorhatte, das Konzert am Freitag zu besuchen – obwohl die Anwälte ihm eine Unterlassungsverfügung angedroht hatten. Uns gegenüber haben sie aber bezweifelt, dass wir eine würden durchsetzen können; dafür hatte er wohl noch nicht genug angerichtet. Aber der Sheriff wollte ihn im Auge behalten, falls er tatsächlich auftauchen würde. Und dafür sorgen, dass Sharp von der Überwachung wusste.«
»Ich rufe im Sheriff’s Office an und teile denen mit, dass er hier ist«, sagte Alicia. »Und wo er wohnt.« Sie lachte überrascht auf. »Er hat ja nun wirklich kein Geheimnis daraus gemacht.«
Kayleigh schaute sich bekümmert um. »Das hier war immer mein Lieblingsrestaurant in Fresno. Nun hat er es mir gründlich verdorben. Ich habe keinen Hunger mehr. Und ich möchte gehen. Tut mir leid.«
Sie winkte nach der Rechnung und zahlte.
»Warte noch kurz.« Bobby ging zur Vordertür, öffnete sie einen Spalt, sprach mit Morgan und kehrte zum Tisch zurück. »Er ist nicht mehr da. Darthur hat gesehen, wie er in sein Auto gestiegen und weggefahren ist.«
»Lasst uns trotzdem den Hinterausgang nehmen«, schlug Alicia vor. Tye bat Morgan, mit dem Wagen nach hinten auf den Parkplatz zu kommen. Dance begleitete die kleine Gruppe durch einen nach Bier stinkenden Lagerraum und vorbei an einer dreckigen Toilette. Draußen auf dem bröckelnden Asphalt standen ein paar verstaubte Fahrzeuge. Aus einigen Rissen wuchs verdorrtes Unkraut.
Dance bemerkte, dass Kayleigh nach rechts schaute und aufkeuchte. Sie folgte dem Blick der Sängerin.
In sechs Metern Entfernung parkte ein riesiger alter leuchtend roter Straßenkreuzer. Hinter dem Steuer saß Edwin Sharp. »He, Kayleigh!«, rief er durch das offene Fenster. »Sieh dir meinen Schlitten an! Es ist zwar kein Cadillac, sondern nur ein Buick, aber gefällt er dir?« Er schien keine Antwort zu erwarten und fügte hinzu: »Keine Angst, mein Auto wird mir nie wichtiger sein als du!«
»My Red Cadillac« hieß einer von Kayleighs größten Hits. Es ging darin um ein Mädchen, dem sein alter Wagen viel bedeutet … und das jeden Mann in die Wüste schickt, der dem großen verbeulten Vehikel nichts abgewinnen kann.
Bobby Prescott stürmte vor. »Verpiss dich, du Arschloch!«, brüllte er. »Und wage ja nicht, uns zu verfolgen, um herauszufinden, wo Kayleigh wohnt. Falls du das versuchst, rufe ich die Cops.«
Edwin nickte lächelnd und fuhr weg.
Die Sonne schien sehr grell, sodass Dance das Gesicht des Mannes nicht genau hatte sehen können. Sie hatte den Mann nur kurz erlebt und war sich hinsichtlich seiner persönlichen kinesischen Norm nicht sicher, aber sie hatte den Eindruck, dass das Gesicht des Stalkers bei Bobbys Worten leicht verwirrt gewirkt hatte – als wüsste er selbstverständlich, wo Kayleigh wohnte. Wieso auch nicht?
5
Es ist kaum überraschend, dass Kalifornien seit jeher Latino-Musik hervorgebracht hat, darunter manche mit salvadorianischen, honduranischen oder nicaraguanischen Wurzeln. Der größte Teil jedoch zählt zu den Mexicana: traditionelle Mariachi, Banda, Ranchera, Norteño und Sones. Außerdem jede Menge Pop und Rock und sogar mexikanische Spielarten von Ska und Hip-Hop.
Diese Klänge wurden von zahlreichen spanischsprachigen Sendern überall im Central Valley in die Wohnungen und Büros und auf die Felder übertragen. Sie nahmen die Hälfte der Radiofrequenzen in Anspruch; der Rest entfiel auf angloamerikanische Musik, Talksender und religiöse Scharlatane, die um Geld bettelten und ihre wirre Theologie unter die Leute brachten.
Es war nun kurz vor einundzwanzig Uhr, und Dance erhielt in José Villalobos’ drückend heißer Garage am Rande von Fresno soeben eine unmittelbare Kostprobe dieser musikalischen Tradition. Die beiden Toyotas der Familie waren aus dem kleinen frei stehenden Gebäude verbannt worden. Normalerweise fungierte es als Proberaum, heute Abend aber diente es als Aufnahmestudio. Los Trabajadores beendeten gerade die letzte Nummer für Dance’ digitalen Rekorder. Die sechs Männer im Alter von fünfundzwanzig bis sechzig spielten schon seit einigen Jahren zusammen, und zwar sowohl herkömmliche mexikanische Volksmusik als auch eigenes Material.
Die Session war gut verlaufen, wenngleich die Männer anfangs etwas unkonzentriert gewesen waren – hauptsächlich wegen Dance’ Begleitung: Kayleigh Towne, das Haar zu einem kunstvollen Zopfknoten geflochten, mit verwaschener Jeans, T-Shirt und Denim-Weste.
Die Musiker waren eingeschüchtert gewesen, und zwei von ihnen waren ins Haus gelaufen, um die Frauen und Kinder zu holen und sich dann Autogramme geben zu lassen. Eine der Frauen hatte unter Tränen gesagt: »Wissen Sie, Ihr Song ›Leaving Home‹ bedeutet uns allen sehr viel. Gott segne Sie dafür, dass Sie dieses Lied geschrieben haben.«
Es handelte sich um die Ballade über eine ältere Frau, die ihre Habseligkeiten zusammenpackt und das Haus verlässt, in dem sie und ihr Mann ihre Kinder großgezogen haben. Der Zuhörer fragt sich, ob sie wohl gerade zur Witwe geworden ist oder ob die Bank das Haus zwangsversteigern lässt.
Now I’m starting over, starting over once again,to try to make a new life, without family or friends.In all my years on earth, there’s one thing that I know:Nothing can be harder than to leave behind your home.
(Ich fange jetzt von vorn an, fange noch einmal von vorn anund versuche, mir ein neues Leben aufzubauen, ohne Familie oder Freunde.In all meinen Jahren auf dieser Erde habe ich eines gelernt:Nichts kann härter sein, als dein Zuhause zu verlassen.)
Erst am Ende wird klar, dass sie illegal im Land war und nun abgeschoben wird, obwohl sie ihr ganzes Leben in den Vereinigten Staaten verbracht hat. Als sie dann allein an einer Bushaltestelle in Mexiko steht, singt die Frau als Coda »America, The Beautiful«. Es war Kayleighs umstrittenster Song und hatte ihr den Zorn all jener eingehandelt, die für härtere Einwanderungsbestimmungen plädierten. Doch er war auch ungeheuer beliebt und zu einer Hymne der arbeitenden Latino-Bevölkerung und all jener geworden, die für eine weichere Linie eintraten.
Während sie nun ihre Sachen zusammenpackten, erläuterte Dance, dass die Titel bald auf ihrer Internetseite zur Verfügung stehen würden. Sie könne zwar nichts garantieren, aber die Band sei sehr gut und würde vermutlich eine ansehnliche Downloadquote erzielen. Angesichts der landesweit wachsenden Zahl von spezialisierten Radiosendern und unabhängigen Plattenlabels sei es durchaus möglich, dass auch irgendein Produzent oder Agent auf sie aufmerksam wurde.
Merkwürdigerweise waren die Männer nicht im Mindesten daran interessiert, erfolgreich zu werden. Oh, sie hätten nichts dagegen, mit ihrer Musik etwas Geld zu verdienen, aber nur über die Downloads. »Dieses Leben auf Tour wäre einfach nichts für uns«, erklärte Villalobos. »Wir reisen nicht. Wir haben Jobs, Familien, bebés. Jesus hier hat Zwillinge – er muss jetzt los und ihnen die Windeln wechseln.« Ein Blick zu dem gut aussehenden jungen Mann, der gerade grinsend seine alte verschrammte Gitarre der Marke Gibson Hummingbird in ihrem Koffer verstaute.
Sie verabschiedeten sich, und Dance und Kayleigh stiegen in den Wagen. Kathryn hatte ihren Pathfinder am Mountain View stehen gelassen und war mit Kayleigh in deren dunkelgrünem SUV hergekommen. Darthur Morgan nickte ihnen wortlos zu und machte sich auf den Rückweg zu Dance’ Motel. Er hatte draußen im Wagen gewartet, um die Straße im Auge zu behalten. Auf dem Beifahrersitz lagen sechs oder sieben kleine, in Leder gebundene Bücher mit goldener Prägeschrift auf den Rücken. Klassiker, vermutete Dance. Doch er schien nicht darin zu lesen, wenn er im Dienst war. Vielleicht waren sie sein Freizeitvergnügen abends auf dem Zimmer. Eine kleine Flucht vor der ständigen Begegnung mit dem Bösen.
Kayleigh schaute zum Fenster hinaus auf die schwach beleuchtete oder schwarze Landschaft. »Ich beneide die Leute«, sagte sie.
»Wieso denn?«
»Das gilt für viele Musiker auf eurer Website. Sie spielen abends oder an den Wochenenden für ihre Freunde und Angehörigen. Es geht ihnen nicht ums Geld. Manchmal wünschte ich, ich wäre nicht so gut. Achtung, Bescheidenheitsalarm. Aber du weißt, was ich meine. Ich wollte nie wirklich ein Star sein. Ich wollte einen Ehemann haben und« – sie nickte über die Schulter in Richtung des Hauses der Familie Villalobos – »Babys und denen und unseren Freunden etwas vorsingen … Es hat sich alles irgendwie verselbstständigt.«
Sie verstummte, und Dance ahnte, dass sie gerade dachte: Wenn ich nicht berühmt wäre, gäbe es auch keinen Edwin Sharp in meinem Leben.
Dance konnte im Fenster Kayleighs Spiegelbild erkennen. Ihr fiel auf, dass sie die Zähne zusammenbiss und wahrscheinlich Tränen in den Augen hatte. Dann wandte Kayleigh sich wieder zu ihr um, schob offenbar die finsteren Gedanken beiseite und lächelte schelmisch. »Also«, sagte sie. »Jetzt erzähl mal. Was machen die Kerle?«
»Männer?«
»Klar!«, sagte Kayleigh. »Hast du nicht einen Jon Soundso erwähnt?«
»Der großartigste Mann auf der Welt«, sagte Dance. »Ein schlauer Kopf. Er hat früher im Silicon Valley gearbeitet, aber inzwischen ist er Dozent und übernimmt Beratungsaufträge. Am wichtigsten ist, dass Wes und Maggie ihn mögen.« Sie fügte hinzu, ihr Sohn habe sonst immer große Probleme damit gehabt, dass seine Mutter gelegentlich mit Männern ausging. Vor Boling habe er keinen einzigen der anderen Kandidaten akzeptiert.
»Es war natürlich auch wenig hilfreich, dass einer der Männer, die ich den beiden vorgestellt habe, sich später als Killer entpuppt hat.«
»Nein!«