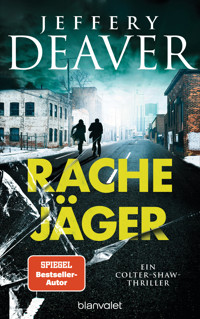Inhaltsverzeichnis
Inschrift
13. September 1999
... Montag
... Eins
... Zwei
... Drei
…Vier
... Fünf
... Sechs
... Sieben
... Acht
... Neun
... Zehn
... Elf
... Zwölf
... Dreizehn
... Vierzehn
... Fünfzehn
... Sechzehn
... Siebzehn
... Achtzehn
... Neunzehn
... Zwanzig
... Dienstag
... Einundzwanzig
... Zweiundzwanzig
... Dreiundzwanzig
... Vierundzwanzig
... Fünfundzwanzig
... Sechsundzwanzig
... Mittwoch
... Siebenundzwanzig
... Achtundzwanzig
... Neunundzwanzig
... Dreißig
... Einunddreißig
... Zweiunddreißig
... Dreiunddreißig
... Vierunddreißig
... Fünfunddreißig
... Sechsunddreißig
... Siebenunddreißig
... Achtunddreißig
...Donnerstag
… Neununddreißig
...Vierzig
...Einundvierzig
...Zweiundvierzig
...Dreiundvierzig
...Vierundvierzig
...Fünfundvierzig
...Sechsundvierzig
...Siebenundvierzig
...Achtundvierzig
...Neunundvierzig
...Fünfzig
...Zweiundfünfzig
...Dreiundfünfzig
...Vierundfünfzig
...Fünfundfünfzig
...Sechsundfünfzig
...Siebenundfünfzig
...Freitag
...Achtundfünfzig
...Neunundfünfzig
...Sechzig
...Samstag
...Einundsechzig
...Zweiundsechzig
...Dreiundsechzig
Anmerkung des Verfassers
Copyright
After changes upon changes, we are more or less the same, after changes we are more or less the same.1
Paul Simon, »The Boxer«
13. September 1999
»Mansons Sohn« des Mordes an der Familie Croyton für schuldig befunden
SALINAS, KALIFORNIEN – Daniel Raymond Pell, 35, wurde heute wegen vierfachen Mordes sowie Totschlags verurteilt. Die Geschworenen in Monterey County berieten sich nur fünf Stunden lang.
»Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan«, ließ der leitende Anklagevertreter James J. Reynolds nach dem Schuldspruch gegenüber der Presse verlauten. »Dies ist ein äußerst gefährlicher Täter, der entsetzliche Verbrechen begangen hat.«
Pell wurde als »Mansons Sohn« bekannt, weil es Parallelen zwischen seinem Leben und dem des verurteilten Mörders Charles Manson gibt. Manson war 1969 in Südkalifornien dafür verantwortlich gewesen, dass die Schauspielerin Sharon Tate und mehrere andere Personen zu Opfern von Ritualmorden wurden. Im Anschluss an Pells Verhaftung fand die Polizei in seinem Haus eine Vielzahl von Büchern und Artikeln über Manson.
Das heute gefällte Urteil bezieht sich auf die am 7. Mai verübten Morde an William Croyton, seiner Frau und zwei ihrer drei Kinder in Carmel, Kalifornien, knapp zweihundert Kilometer südlich von San Francisco. Die Anklage wegen Totschlags ergab sich aus dem Tod von James Newberg, 24, der mit Pell zusammengewohnt und ihn am Tatabend zum Haus der Croytons begleitet hat. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Newberg habe sich anfangs an den Morden beteiligen wollen, sich dann aber geweigert, woraufhin Pell ihn getötet habe.
Croyton, 56, war ein wohlhabender Elektroingenieur und Computer-Trendsetter aus dem Silicon Valley. Seine im kalifornischen Cupertino ansässige Firma stellt hochmoderne Software her, die sich in den meisten der weltweit beliebtesten PC-Programme wiederfindet.
Aufgrund von Pells Interesse an Manson kamen Spekulationen auf, die Morde könnten – wie seinerzeit bei Manson – ideologisch motiviert sein, aber laut Staatsanwalt Reynolds hatte der Täter es höchstwahrscheinlich auf das Eigentum der Familie Croyton abgesehen. Pells Strafregister reicht zwanzig Jahre zurück und umfasst Dutzende von Laden- und Einbruchdiebstählen sowie zahlreiche Raubüberfälle.
Ein Kind der Croytons, die neunjährige Tochter Theresa, hat überlebt. Sie lag schlafend im Bett und wurde von Pell übersehen, weil sie durch ihre Spielzeuge und Stofftiere verdeckt war. Dieser Umstand hat ihr später den Beinamen Schlafpuppe eingebracht.
Genau wie der von ihm bewunderte Charles Manson besaß auch Pell eine düstere Ausstrahlung und konnte eine Gruppe ergebener und fanatischer Anhänger um sich scharen, die er seine Familie nannte – ein ebenfalls dem Manson-Clan entlehnter Begriff – und über die er absolute Kontrolle ausübte. Zur Zeit der Croyton-Morde bestand diese Gruppe aus Newberg und drei Frauen, die alle gemeinsam in einem ärmlichen Haus in Seaside wohnten, nördlich von Monterey, Kalifornien. Im Einzelnen handelt es sich um Rebecca Sheffield, 26, Linda Whitfield, 20, und Samantha McCoy, 19. Whitfield ist die Tochter von Lyman Whitfield, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Santa Clara Bank and Trust, der viertgrößten Bankgesellschaft des Staates, mit Hauptsitz in Cupertino.
Die Frauen wurden zwar nicht in der Strafsache Croyton/Newberg angeklagt, aber ihnen konnten zahlreiche Fälle von Diebstahl, Hausfriedensbruch, Betrug und Hehlerei nachgewiesen werden. Whitfield hatte sich zudem der Behinderung der Ermittlungen, des Meineides und der Zerstörung von Beweismitteln schuldig gemacht. Infolge einer Absprache zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft wurden Sheffield und McCoy zu je drei Jahren Haft verurteilt, Whitfield zu viereinhalb.
Sogar Pells Verhalten vor Gericht glich dem von Charles Manson. Er saß reglos am Tisch der Verteidigung und starrte die Geschworenen und Zeugen an, um sie offenbar einzuschüchtern. Gerüchten zufolge glaubte er, übersinnliche Kräfte zu besitzen. Einmal wurde der Angeklagte aus dem Gerichtssaal entfernt, nachdem eine Zeugin unter seinem Blick zusammengebrochen war.
Vom morgigen Tag an beraten die Geschworenen über das Strafmaß. Pell könnte zum Tode verurteilt werden.
... Montag
... Eins
Die Vernehmung begann wie jede andere.
Kathryn Dance betrat das Verhörzimmer. An einem Metalltisch saß in Ketten ein dreiundvierzigjähriger Mann und blickte ihr aufmerksam entgegen. Das taten die Verdächtigen natürlich immer, aber bisher noch nie mit so erstaunlichen Augen. Ihr Blau ähnelte weder dem Himmel noch dem Meer oder gar kostbaren Edelsteinen.
»Guten Morgen«, sagte Dance und nahm auf der anderen Seite des Tisches Platz.
»Ihnen auch«, erwiderte Daniel Pell, der vor acht Jahren vier Mitglieder einer Familie erstochen und den Grund dafür niemals preisgegeben hatte. Seine Stimme war sanft.
Der klein gewachsene, sehnige Mann verzog das Gesicht zu einem leichten Lächeln und lehnte sich entspannt zurück. Sein Kopf mit dem langen grauschwarzen Haar war zur Seite geneigt. Die meisten Verhöre im Gefängnis wurden von einem stetigen Klirren der Ketten begleitet, weil die Verdächtigen mit ausholenden, berechenbaren Gesten ihre Unschuld beteuerten. Daniel Pell hingegen saß vollkommen still.
Für Dance, spezialisiert auf Vernehmungen und Kinesik – Körpersprache -, signalisierte Pell durch sein Verhalten und seine Pose vorsichtige Zurückhaltung, aber auch Selbstbewusstsein und sogar Belustigung. Er trug einen orangefarbenen Overall, auf dessen Brust »Strafanstalt Capitola« geschrieben stand. Auf dem Rücken prangte überflüssigerweise das Wort »Häftling«.
Gegenwärtig befanden Pell und Dance sich jedoch nicht in Capitola, sondern sechzig Kilometer entfernt in einem gesicherten Verhörraum des Bezirksgerichts von Salinas.
Pell setzte seine Begutachtung fort. Zuerst nahm er sich nunmehr Dances Augen vor – ein Grün, das gut zu seinem Blau passte, eingerahmt durch eine Brille mit rechteckigem schwarzem Gestell. Dann widmete er sich ihrem dunkelblonden, zu einem festen Zopf geflochtenen Haar, dem schwarzen Jackett und darunter der dicken, blickdichten weißen Bluse. Auch das leere Holster am Gürtel entging ihm nicht. Er war gewissenhaft und ließ sich Zeit. (Bei einer Vernehmung sind beide Beteiligten aufeinander neugierig. »Der Verdächtige nimmt Sie genauso gründlich in Augenschein wie Sie ihn«, ermahnte Dance die Teilnehmer ihrer Seminare. »Für gewöhnlich sogar noch gründlicher, denn er hat mehr zu verlieren.«)
Dance suchte in ihrer blauen Handtasche nach ihrem Dienstausweis und ließ sich nichts anmerken, als sie eine kleine Spielzeugfledermaus vom letztjährigen Halloween entdeckte. Der zwölfjährige Wes oder seine jüngere Schwester Maggie, vermutlich aber beide gemeinsam, hatten sich mal wieder einen Streich für sie ausgedacht. Ist das nicht ein herrlicher Kontrast?, dachte Dance. Noch vor einer Stunde hatte sie mit ihren Kindern in der Küche ihres gemütlichen viktorianischen Hauses im idyllischen Pacific Grove gefrühstückt, während zu ihren Füßen zwei übermütige Hunde um Speck bettelten, und nun saß sie hier, an einem ganz anderen Tisch, einem verurteilten Mörder gegenüber.
Sie fand den Ausweis und zeigte ihn vor. Pell kniff die Augen zusammen und musterte ihn eindringlich. »Dance. Interessanter Name. Wo der wohl herkommt? Und das California Bureau … was steht da?«
»Bureau of Investigation. Wie ein FBI auf Staatsebene. Also, Mr. Pell, Sie sind sich bewusst, dass diese Unterredung aufgezeichnet wird?«
Er schaute zu dem Spiegel, hinter dem eine Videokamera summte. »Glaubt ihr eigentlich allen Ernstes, wir würden annehmen, diese Dinger seien dafür gedacht, dass wir uns die Frisur richten können?«
Verhörzimmer sind nicht mit Spiegeln versehen, um dahinter Kameras und Zeugen zu verstecken – zu diesem Zweck gibt es weitaus bessere technische Lösungen -, sondern weil Menschen weniger zum Lügen neigen, wenn sie sich selbst sehen.
Dance lächelte matt. »Und Sie wissen, dass Sie dieses Gespräch jederzeit beenden können und das Recht auf einen Anwalt haben?«
»Ich kenne mich mit den Strafrechtsbestimmungen besser aus als der ganze Abschlussjahrgang einer juristischen Fakultät. Was ein ziemlich trauriges Licht auf unsere Universitäten wirft, wenn Sie mich fragen.«
Wortgewandter als Dance erwartet hatte. Und schlauer.
Eine Woche zuvor war Daniel Raymond Pell, der im Jahre 1999 William Croyton, dessen Frau und zwei ihrer Kinder ermordet hatte und dafür zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, an einen Mitgefangenen herangetreten, dessen Entlassung unmittelbar bevorstand, und hatte ihm Geld für die Erfüllung eines Auftrags angeboten. Pell erzählte ihm von einigen Beweisstücken, die er vor vielen Jahren in einen Brunnenschacht in Salinas geworfen habe, und erklärte, er sei besorgt, die Gegenstände könnten ihn mit dem ungelösten Mord an einem wohlhabenden Farmeigentümer in Verbindung bringen. Er habe kürzlich gelesen, Salinas wolle das städtische Leitungsnetz überholen. Daraufhin habe er sich an diese alte Sache erinnert und fürchte nun, die Beweise könnten entdeckt werden. Der andere Häftling sollte sie finden und beseitigen.
Aber Pell hatte sich den Falschen ausgesucht. Der Mann verriet ihn an die Gefängnisdirektorin, und die wiederum verständigte das Monterey County Sheriff’s Office. Die Ermittler fragten sich, ob Pell die unaufgeklärte Ermordung des Farmeigentümers Robert Herron meinte, der vor zehn Jahren erschlagen worden war. Das Tatwerkzeug, mutmaßlich ein Klauenhammer, konnte nie gefunden werden. Nun ließ die Polizei alle Brunnenschächte in dem betreffenden Stadtteil absuchen. Und tatsächlich – man fand ein zerlumptes T-Shirt, eine leere Brieftasche mit den eingeprägten Initialen R. H. und einen Klauenhammer. Zwei Fingerabdrücke auf dem Hammer stammten von Daniel Pell.
Die Staatsanwaltschaft von Monterey County beschloss, den Fall zwecks Anklageerhebung einer Grand Jury in Salinas vorzulegen, und bat die CBI-Agentin Kathryn Dance, den Verdächtigen zu verhören und ihm möglichst ein Geständnis zu entlocken.
»Wie lange haben Sie in der Nähe von Monterey gewohnt?«, fragte Dance nun.
Er schien überrascht zu sein, dass sie nicht von vornherein versuchte, ihn unter Druck zu setzen. »Ein paar Jahre.«
»Wo genau?«
»In Seaside.« Eine Stadt mit ungefähr dreißigtausend Einwohnern, hauptsächlich junge Arbeiterfamilien und Ruheständler, nördlich von Monterey am Highway 1 gelegen. »Da hat man mehr für sein schwer verdientes Geld bekommen«, erklärte Pell. »Nicht so wie in Ihrem feinen Carmel.« Er sah ihr ins Gesicht.
Grammatik und Satzbau waren gut, registrierte sie, ohne auf seinen Versuch einzugehen, ihren Wohnort in Erfahrung zu bringen.
Dance stellte ihm noch einige Fragen über sein Leben in Seaside und im Gefängnis und ließ ihn dabei nicht aus den Augen: wie er sich benahm, wenn sie die Fragen stellte, und wie er sich benahm, wenn er antwortete. Sie war nicht auf den Inhalt der Antworten aus – sie hatte ihre Hausaufgaben gemacht und kannte diese Fakten bereits -, sondern sie verschaffte sich einen grundlegenden Eindruck von seinem Verhalten.
Um Lügen zu enttarnen, berücksichtigen Verhörspezialisten drei Faktoren: das nonverbale Verhalten (die Körpersprache respektive Kinesik), die verbale Qualität (die Tonlage einer Stimme oder das kurze Zögern vor den Antworten) und den verbalen Inhalt (das Gesagte). Die ersten beiden Faktoren sind bei weitem verlässlichere Indikatoren für einen Täuschungsversuch, weil wir viel einfacher kontrollieren können, was wir sagen, als wie wir es sagen oder wie unser Körper derweil reagiert.
Der Ersteindruck des Vernehmungsbeamten basiert stets auf dem Verhalten des Verdächtigen bei wahrheitsgemäßen Aussagen. Diesen Standard vergleicht er später mit dem Benehmen des Befragten, wenn dieser Anlass zu einer Lüge haben könnte. Falls Unterschiede auftreten, deutet das auf eine Irreführung hin.
Nach einer Weile hatte Dance ein gutes Profil des aufrichtigen Daniel Pell vorliegen und wandte sich in diesem modernen, sterilen Gerichtsgebäude an einem nebligen Junimorgen dem schwierigen Teil ihrer Aufgabe zu. »Ich würde Ihnen gern ein paar Fragen über Robert Herron stellen.«
Er sah ihr kurz in die Augen und präzisierte seine Untersuchung: die Halskette mit dem Schneckenhaus, die ihre Mutter angefertigt hatte. Dann Dances kurze, rosa lackierte Fingernägel. Der graue Perlenring an ihrem linken Ringfinger erhielt zwei Blicke.
»Wo haben Sie im Januar 1996 gewohnt?«
»In Monterey.«
»In welcher Straße?«
Er schürzte die Lippen. »Weiß ich nicht mehr. Im Norden der Stadt, glaube ich.«
Interessant. Wer eine Täuschung versucht, vermeidet es meistens, konkrete und überprüfbare Angaben zu machen, die später vor Gericht zudem gegen den Beklagten verwendet werden können, falls er dort eine abweichende Aussage zu Protokoll gibt. Und es war ungewöhnlich, dass jemand sich nicht an seine frühere Adresse erinnerte. Wie dem auch sei, seine kinesische Reaktion war unverdächtig.
»Wie haben Sie Robert Herron kennengelernt?«
»Das unterstellen Sie mir zwar, aber nein, ich habe ihn im ganzen Leben nie getroffen. Ich schwöre.«
Der letzte Satz war typisch für eine versuchte Irreführung, doch auch jetzt ließ Pells Körpersprache nicht erkennen, ob er log.
»Aber Sie haben den Häftling in Capitola gebeten, er solle den Hammer und die Brieftasche aus dem Brunnenschacht holen.«
»Nein, das hat er der Direktorin erzählt.« Pell verzog das Gesicht erneut zu einem belustigten Lächeln. »Warum reden Sie nicht mal mit ihm über die Sache? Sie haben scharfe Augen, Officer Dance. Mir ist nicht entgangen, wie Sie mich gemustert haben, um herauszufinden, ob ich die Wahrheit sage. Ich wette, Sie würden innerhalb kürzester Zeit feststellen, dass der Junge lügt.«
Sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, dachte aber daran, wie selten es war, dass ein Verdächtiger es merkte, wenn er kinesisch analysiert wurde.
»Aber woher wusste er denn von den Beweisen in dem Schacht?«
»Oh, das habe ich mir inzwischen zusammengereimt. Jemand hat meinen Hammer gestohlen, damit Herron ermordet und die Sachen dann in dem Brunnen deponiert, um mich zu belasten. Dabei hat er Handschuhe getragen. Diese Gummidinger, wie sie bei CSI auch immer alle anhaben.«
Er war weiterhin entspannt. Die Körpersprache hatte sich nicht verändert. Er vollführte lediglich die üblichen Bewegungen, die so gut wie jede Unterredung begleiten, zum Beispiel Achselzucken oder kleine Gesten. Nichts wies auf Anspannung oder andere Gefühlsregungen hin.
»Aber falls der Täter das vorgehabt hat, wieso hat er nicht damals die Polizei gerufen und ihr den Fundort des Hammers verraten?«, wandte Dance ein. »Warum sollte er mehr als zehn Jahre warten?«
»Weil er ziemlich gerissen ist, schätze ich. Er hat auf den richtigen Augenblick gewartet und dann die Falle zuschnappen lassen.«
»Und weshalb hat der wahre Mörder den Häftling in Capitola benutzt? Wieso hat er nicht direkt die Polizei verständigt?«
Ein Zögern. Dann ein Lachen. Seine blauen Augen funkelten vor offenbar aufrichtiger Erregung. »Weil die ebenfalls darin verwickelt ist. Die Polizei. Na klar... Die Cops können den Fall Herron nicht aufklären und wollen irgendjemandem die Schuld zuschieben. Warum nicht mir? Ich sitze ja bereits im Knast. Ich wette, die Bullen haben den Hammer selbst deponiert.«
»Sehen wir uns das etwas genauer an. Sie sagen hier zwei verschiedene Dinge. Erstens, jemand hat Ihren Hammer vor Herrons Tod gestohlen, ihn damit ermordet und will Sie nun, nach all der langen Zeit, ans Messer liefern. Doch Ihre zweite Version lautet, die Polizei habe sich Ihren Hammer besorgt und ihn zu Ihrer Belastung in dem Brunnen platziert, nachdem Herron von jemand völlig anderem ermordet worden war. Das widerspricht sich. Es geht nur entweder das eine oder das andere. Was halten Sie für wahrscheinlicher?«
»Hm.« Pell überlegte einige Sekunden lang. »Okay. Ich nehme Nummer zwei. Die Polizei. Es ist ein abgekartetes Spiel. Das muss es gewesen sein.«
Sie sah ihm in die Augen, Grün in Blau. Nickte zustimmend. »Nehmen wir mal an, es trifft zu. Erstens, woher sollte die Polizei den Hammer haben?«
Er dachte nach. »Aus der Zeit, als ich wegen dieser Carmel-Sache verhaftet wurde.«
»Die Croyton-Morde 1999?«
»Genau. In meinem Haus in Seaside wurde jede Menge Kram sichergestellt.«
Dance runzelte die Stirn. »Das bezweifle ich. Beweisstücke werden zu gründlich dokumentiert. Nein, ich halte es für wesentlich glaubwürdiger, dass der Hammer erst kürzlich gestohlen worden ist. Wo könnte man heutzutage einen Hammer von Ihnen finden? Haben Sie hier im Staat irgendwelchen Grundbesitz?«
»Nein.«
»Könnten Verwandte oder Freunde Werkzeuge von Ihnen besitzen?«
»Eigentlich nicht.«
Was keine Antwort auf eine Ja-oder-nein-Frage war; es war sogar noch ausweichender als »Ich kann mich nicht erinnern«. Dance fiel außerdem auf, dass Pell bei dem Wort »Verwandte« seine Hände mit den langen, sauberen Fingernägeln auf die Tischplatte gelegt hatte. Das war eine Abweichung von seinem bisherigen Verhalten. Es bedeutete nicht, dass er log, aber er empfand eindeutig Stress. Die Fragen brachten ihn aus der Fassung.
»Daniel, leben einer oder mehrere Ihrer Angehörigen in Kalifornien?«
Er zögerte, musste bemerkt haben, dass Dance zu der Sorte gehörte, die jedes seiner Worte auf die Goldwaage legte – was zutraf -, und sagte dann: »Es ist nur noch meine Tante übrig. Unten in Bakersfield.«
»Heißt sie auch Pell?«
Wieder eine Pause. »Ja... Das ist gar keine so üble Idee, Officer Dance. Ich wette, die Deputies, die den Fall Herron versiebt haben, haben den Hammer aus ihrem Haus gestohlen und in dem Schacht deponiert. Diese Kerle stecken hinter der ganzen Sache. Warum sprechen Sie nicht mal mit denen?«
»Also gut. Kommen wir jetzt zu der Brieftasche. Woher könnte die stammen?... Wie wär’s damit? Was ist, falls es sich überhaupt nicht um Robert Herrons Brieftasche handelt? Was ist, wenn dieser hinterhältige Cop, von dem wir hier reden, einfach irgendeine Brieftasche gekauft und die Initialen R. H. in das Leder hat prägen lassen? Dann hat er die Brieftasche und den Hammer in dem Brunnen versteckt. Vielleicht letzten Monat. Oder sogar erst letzte Woche. Was halten Sie davon, Daniel?«
Pell senkte den Kopf – sie konnte seine Augen nicht sehen – und sagte nichts.
Alles lief genau so, wie sie es geplant hatte.
Dance hatte ihn dazu veranlasst, die glaubwürdigere der beiden Erklärungen für seine Unschuld auszuwählen – und hatte ihm dann dargelegt, dass diese Erklärung keineswegs glaubwürdig war. Keine geistig gesunde Jury würde glauben, dass die Polizei Beweise gefälscht und Werkzeuge aus einem Haus gestohlen hätte, das Hunderte von Meilen vom Tatort entfernt lag. Pell begriff nun, welchen Fehler er begangen hatte. Er saß in der Falle.
Schachmatt...
Ihr Herz schlug ein wenig schneller, und sie rechnete damit, dass er nun womöglich um eine Absprache mit der Staatsanwaltschaft bitten würde.
Sie irrte sich.
Sein Kopf ruckte hoch, und sein Blick bohrte sich voller Bösartigkeit in ihre Augen. Pell sprang so weit vor, wie er konnte. Nur die Ketten, die an dem mit Bolzen am Fliesenboden gesicherten Stuhl befestigt waren, hielten ihn davon ab, seine Zähne in Dances Fleisch zu vergraben.
Sie keuchte erschrocken auf und zuckte zurück.
»Du verdammte Schlampe! Oh, jetzt wird mir alles klar. Natürlich, du steckst auch mit drin! Ja, ja, schiebt alles ruhig auf Daniel. Ich bin an allem schuld! Ich bin ein einfaches Opfer. Und du kommst hier rein und tust ganz freundlich und stellst mir ein paar Fragen. Herrje, du bist genau wie die anderen!«
Ihr Herz klopfte jetzt wie wild, und sie hatte Angst. Aber sie merkte schnell, dass die Fesseln halten würden und er sie nicht erreichen konnte. Sie wandte sich zu dem Spiegel um, hinter dem der Beamte bei der Videokamera mit Sicherheit aufgestanden war, um ihr zu helfen. Doch Dance sah in seine Richtung und schüttelte den Kopf. Der Fortgang der Sitzung war wichtig.
Dann wich Pells Wut schlagartig einer kalten Ruhe. Er lehnte sich zurück, atmete tief durch und betrachtete sie erneut. »Sie sind Mitte dreißig, Officer Dance, und eigentlich ganz hübsch. Wie eine Lesbe sehen Sie nicht aus, also dürfte es einen Mann in Ihrem Leben geben. Oder gegeben haben.« Ein dritter Blick auf den Perlenring.
»Falls meine Theorie Ihnen nicht gefällt, Daniel, lassen Sie uns doch eine neue aufstellen. Darüber, was wirklich mit Robert Herron passiert ist.«
Es war, als hätte sie kein Wort gesagt. »Und Sie haben Kinder, richtig? Na klar, haben Sie. Das kann ich sehen. Erzählen Sie mir von ihnen. Erzählen Sie mir von den Kleinen. Noch nicht allzu alt und wenige Jahre auseinander, möchte ich wetten.«
Das ging ihr nahe, und sie dachte sofort an Maggie und Wes. Aber sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Er weiß natürlich nicht, dass ich Kinder habe. Das ist unmöglich. Aber er verhält sich, als sei er sich sicher. Ist ihm an meinem Verhalten etwas aufgefallen? Etwas, das ihm verraten hat, dass ich Mutter bin?
Der Verdächtige nimmt Sie genauso gründlich in Augenschein wie Sie ihn...
»Hören Sie, Daniel«, sagte sie besänftigend, »ein solcher Ausbruch hilft uns allen nicht weiter.«
»Wissen Sie, ich habe Freunde draußen. Die sind mir noch was schuldig. Die würden Ihnen gern mal einen Besuch abstatten. Oder etwas Zeit mit Ihrem Mann und den Kindern verbringen. Ja, das Leben als Cop ist hart. Die Kleinen sind oft allein, nicht wahr? Bestimmt freuen sie sich über ein paar neue Spielkameraden.«
Dance hielt seinem Blick stand, ohne mit der Wimper zu zucken. »Könnten Sie mir erzählen, in welcher Verbindung Sie zu dem Häftling in Capitola stehen?«, fragte sie.
»Ja, könnte ich. Werde ich aber nicht.« In seinem unterkühlten Tonfall lag Spott, weil er andeuten wollte, dass sie als Vernehmungsspezialistin ihre Frage nachlässig formuliert hatte. »Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich in meine Zelle zurückkehre«, fügte er ruhig hinzu.
... Zwei
Alonzo »Sandy« Sandoval, der leitende Staatsanwalt von Monterey County, war ein gut aussehender, rundlicher Mann mit dichtem schwarzem Haar und einem stattlichen Schnurrbart. Er saß eine Etage über den Haftzellen in seinem Büro hinter einem Schreibtisch voller Akten. »Hallo, Kathryn. Also, unser Freund … Hat er sich auf die Brust geschlagen und mea culpa gerufen?«
»Nicht ganz.« Dance setzte sich und warf einen verstohlenen Blick in die Kaffeetasse, die sie vor fünfundvierzig Minuten auf dem Tisch zurückgelassen hatte. An der Oberfläche trieb geronnener Kaffeeweißer. »Ich würde sagen, das war, äh, eines der erfolglosesten Verhöre aller Zeiten.«
»Du siehst mitgenommen aus, Boss«, sagte ein kleiner, drahtiger junger Mann mit Sommersprossen und lockigem rotem Haar, der Jeans, T-Shirt und ein kariertes Sakko trug. Für einen Ermittlungsbeamten des CBI – der konservativsten Strafverfolgungsbehörde von ganz Kalifornien – war TJs Kleidung ziemlich unkonventionell, aber das traf auch auf den Rest seiner Person zu. TJ Scanlon war um die dreißig und Single und wohnte in den Hügeln von Carmel Valley. Sein baufälliges Haus hätte als Diorama des kalifornischen Lebens der sechziger Jahre in ein Museum für Gegenkultur gepasst. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten des CBI arbeitete TJ meistens allein, vornehmlich im Bereich Überwachung und verdeckte Ermittlung. Aber da Dances eigentlicher Partner in Mexiko war und auf die Auslieferung eines Gefangenen wartete, hatte TJ sich sofort auf die Gelegenheit gestürzt, Mansons Sohn zu Gesicht zu bekommen.
»Nicht mitgenommen. Bloß neugierig.« Sie schilderte, wie die Vernehmung zunächst reibungslos verlaufen war, bis Pell seinen Wutanfall bekommen hatte. »Okay, ich bin ein bisschen mitgenommen«, räumte sie unter TJs skeptischem Blick ein. »Man hat mich schon vorher bedroht. Aber das hier waren die schlimmstmöglichen Drohungen.«
»Schlimmstmöglich?«, fragte Juan Millar, ein hochgewachsener, dunkelhäutiger junger Detective aus der Ermittlungsabteilung des MCSO – des Monterey County Sheriff’s Office -, dessen Zentrale unweit des Gerichtsgebäudes lag.
»Ruhige Drohungen«, sagte Dance.
»Freundliche Drohungen«, warf TJ ein. »Man weiß, dass man in Schwierigkeiten steckt, wenn sie aufhören zu schreien und anfangen zu flüstern.«
Die Kleinen sind oft allein...
»Was ist passiert?«, fragte Sandoval, der anscheinend eher wegen seines Falls besorgt war als wegen der Drohungen gegen Dance.
»Als er abstritt, Herron gekannt zu haben, gab es bei ihm keinerlei Stressreaktion. Erst als ich ihn so weit hatte, über ein Polizeikomplott zu reden, wurden bei ihm Abwehr und Zurückweisung spürbar. Und ein paar Bewegungen der Gliedmaßen, die vom bisherigen Verhalten abgewichen sind.«
Kathryn Dance wurde oft als menschlicher Lügendetektor bezeichnet, aber das traf es nicht ganz; in Wahrheit war sie – wie alle erfolgreichen kinesischen Analytiker und Verhörspezialisten – ein Stressdetektor. Das war der Schlüssel zu jeder Irreführung; sobald Dance Stress wahrnahm, ging sie näher auf das auslösende Thema ein und grub immer tiefer, bis der Verdächtige einknickte.
Kinesik-Experten unterscheiden zwischen mehreren Arten von Stress. Der Stress, der hauptsächlich auftritt, wenn jemand nicht die vollständige Wahrheit sagt, wird »Täuschungsstress« genannt.
Doch Menschen können auch ganz allgemein Stress empfinden, wenn sie verunsichert oder nervös sind. Das hat dann nichts mit Lügen zu tun. Es ist, was jemand verspürt, der beispielsweise zu spät zur Arbeit kommt, eine Rede in der Öffentlichkeit halten muss oder Angst vor körperlichen Schmerzen hat. Dance hatte gelernt, dass jede Art von Stress von verschiedenen kinesischen Verhaltensweisen begleitet wurde.
Sie erklärte dies und fügte hinzu: »Ich hatte den Eindruck, dass er das Gespräch nicht wieder unter Kontrolle bekommen konnte. Also ist er ausgerastet.«
»Obwohl die von Ihnen angebotene Theorie seine Verteidigung gestützt hätte?« Der schlaksige Juan Millar kratzte sich geistesabwesend an der linken Hand. Auf der Haut zwischen Zeigefinger und Daumen war eine Narbe zu sehen, das Überbleibsel einer entfernten Bandentätowierung.
»Genau.«
Dann vollführte Dances Verstand einen seiner sonderbaren Sprünge. Von A nach B nach X. Sie konnte sich nicht erklären, wie es dazu kam. Aber sie schenkte diesen Eingebungen stets Beachtung. »Wo wurde Robert Herron ermordet?« Sie ging zu einer Karte von Monterey County, die an Sandovals Wand hing.
»Hier.« Der Staatsanwalt deutete auf einen Punkt in dem gelben Trapez.
»Und der Brunnenschacht, in dem der Hammer und die Brieftasche gefunden wurden?«
»Ungefähr hier.«
Etwa vierhundert Meter vom Tatort entfernt, in einer Wohngegend.
Dance starrte die Karte an.
Sie fühlte TJs Blick auf sich ruhen. »Was ist los, Boss?«
»Haben Sie ein Foto des Brunnens?«, fragte sie.
Sandoval wühlte in der Akte. »Juans Leute von der Spurensicherung haben jede Menge Bilder geschossen.«
»Nimm einem dieser Jungs die Kamera weg, und er ist nackt«, sagte Millar, was aus dem Mund eines so jungen Beamten seltsam klang. Er lächelte verlegen. »Das hab ich irgendwo gehört.«
Der Staatsanwalt holte einen Stapel Farbfotos hervor und blätterte sie durch, bis er fand, wonach er suchte.
Dance sah sich die Bilder an. »Wir hatten dort vor sechs oder acht Monaten einen Fall, erinnerst du dich noch?«, fragte sie TJ.
»Klar, die Brandstiftung. In dem Neubaugebiet.«
Dance klopfte auf die entsprechende Stelle der Karte. »Da wird immer noch gebaut. Und das« – sie nickte in Richtung eines der Fotos – »ist ein Felsbrunnen.«
Jeder in der Gegend wusste, dass Wasser in diesem Teil Kaliforniens ein kostbares Gut war und dass Felsbrunnen aufgrund ihres niedrigen und unzuverlässigen Wasserstandes nie für landwirtschaftliche Bewässerungsvorhaben genutzt wurden, sondern nur für private Haushalte.
»Scheiße.« Sandoval schloss kurz die Augen. »Vor zehn Jahren, als Herron ermordet wurde, war das alles noch Ackerland. Den Brunnen hat es damals noch gar nicht gegeben.«
»Es hat ihn noch nicht mal vor einem Jahr gegeben«, murmelte Dance. »Deshalb stand Pell so unter Stress. Ich habe mich der Wahrheit genähert – es hat tatsächlich jemand den Hammer von seiner Tante aus Bakersfield geholt, eine falsche Brieftasche besorgt und beides vor kurzem dort deponiert. Nur dass es nicht darum ging, Pell etwas anzuhängen.«
»O nein«, flüsterte TJ.
»Was ist?«, fragte Millar und schaute von Dance zu ihrem Kollegen.
»Pell hat die ganze Sache selbst inszeniert.«
»Warum?«, fragte Sandoval.
»Weil eine Flucht aus Capitola unmöglich war.« Die Strafanstalt, genau wie Pelican Bay im Norden des Staates, war ein modernes Hochsicherheitsgefängnis und für die gefährlichsten Verbrecher reserviert. »Aber hier könnte es ihm gelingen.«
Kathryn Dance lief zum Telefon.
... Drei
Daniel Pell saß in einer von den anderen Gefangenen abgesonderten Einzelzelle und musterte die Gitter und den Korridor dahinter, der zum Gerichtsgebäude führte.
Nach außen hin wirkte er gelassen, aber in seinem Innern herrschte Aufruhr. Die Polizistin, die ihn verhört hatte, hatte ihm mit ihren ruhigen grünen Augen hinter dem schwarzen Brillengestell und ihrer unbeirrbaren Stimme einen mächtigen Schreck eingejagt. Er hatte nicht damit gerechnet, dass jemand so tief und so schnell in seinen Verstand vordringen würde. Es war, als könne sie seine Gedanken lesen.
Kathryn Dance …
Pell wandte sich wieder zu Baxter um, dem Wärter vor dem Gitterkäfig. Er war ein anständiger Kerl, nicht wie Pells Aufpasser aus Capitola, ein stämmiger Mann, schwarz und hart wie Ebenholz, der schweigend an der gegenüberliegenden Tür saß und alles beobachtete.
»Was ich sagen wollte«, setzte Pell nun das Gespräch mit Baxter fort. »Jesus hat mir geholfen. Ich habe bis zu drei Schachteln am Tag geraucht. Und Er hat sich trotz seines vollen Terminkalenders die Zeit genommen, mir zu helfen. Ich habe es mir praktisch von einem Tag auf den anderen abgewöhnt.«
»Die Hilfe könnte ich auch gebrauchen«, gestand der Aufseher.
»Glauben Sie mir«, sagte Pell, »mit dem Qualmen aufzuhören war schwieriger als mit dem Saufen.«
»Ich hab’s mal mit diesen Pflastern versucht, die man sich auf den Arm klebt. Das lief nicht so gut. Vielleicht sollte ich auch um Hilfe beten. Meine Frau und ich beten sowieso jeden Morgen.«
Pell war nicht überrascht. Er hatte den Anstecker am Hemd des Mannes gesehen: ein kleiner Fisch. »Das ist gut.«
»Letzte Woche konnte ich meinen Autoschlüssel nicht finden, und wir haben eine Stunde lang gebetet. Dann hat Jesus mir verraten, wo der Schlüssel lag. Da kommt mir ein Gedanke, Daniel: An den Verhandlungstagen werden Sie hier unten sein. Falls Sie möchten, könnten wir gemeinsam beten.«
»Sehr gern.«
Baxters Telefon klingelte.
Einen Augenblick später gellte eine Alarmsirene so laut los, dass es in den Ohren wehtat. »Was, zum Teufel, geht hier vor?«
Der Wärter aus Capitola sprang auf.
In diesem Moment loderte auf dem Parkplatz ein gewaltiger Feuerball auf. Das Fenster der Zelle war zwar vergittert, aber geöffnet, und eine Flammenzunge schoss herein. Pell ließ sich zu Boden fallen und rollte sich zusammen. »Um Gottes willen.«
Baxter war erstarrt und schaute ungläubig auf die züngelnden Flammen, die den gesamten Platz hinter dem Gerichtsgebäude einhüllten. Er nahm den Hörer ab, aber die Leitung war offenbar tot. Dann hob er sein Funkgerät und meldete das Feuer. Daniel Pell senkte den Kopf und fing an, ein Vaterunser zu murmeln.
»He, Pell!«
Der Häftling öffnete die Augen.
Der kräftige Beamte aus Capitola stand vor der Zelle und hatte einen Taser in der Hand. Er warf Pell die Fußfesseln zu. »Leg sie an. Wir gehen den Gang hinunter, zur Vordertür hinaus und steigen in den Wagen. Du wirst...« Es schossen wieder Flammen in die Zelle. Die drei Männer duckten sich. Der Tank des nächsten Autos war explodiert. »Du wirst direkt neben mir bleiben. Verstanden?«
»Ja, sicher. Lassen Sie uns abhauen! Bitte!« Er ließ die Fesseln einrasten.
»Was war das?«, fragte Baxter schwitzend und nervös. »Ein Terroranschlag?«
Der Wärter aus Capitola ignorierte den in Panik geratenen Aufseher und ließ Pell nicht aus den Augen. »Falls du nicht genau machst, was ich sage, jage ich dir fünfzigtausend Volt durch den Arsch.« Er richtete den Taser auf den Gefangenen. »Und falls ich dann keine Lust habe, dich zu tragen, lasse ich dich hier verbrennen. Alles klar?«
»Ja, Sir. Bitte lassen Sie uns gehen. Ich möchte nicht, dass Sie oder Mr. Baxter wegen mir zu Schaden kommen. Ich mache alles, was Sie wollen.«
»Öffnen!«, herrschte der Beamte nun Baxter an, der einen Knopf drückte. Die Tür schwang mit einem Summen nach außen auf. Die drei Männer gingen den Korridor entlang, durch eine zweite Sicherheitstür und bogen auf einen schwach beleuchteten Gang ein, der sich mit Rauch füllte. Die Sirene dröhnte noch immer.
Halt, Moment mal, dachte Pell. Das hier war ein zweiter Alarm – der erste war vor den Explosionen losgegangen. Hatte etwa jemand seinen Plan durchschaut?
Kathryn Dance...
Als sie an einer Brandschutztür vorbeikamen, warf Pell einen Blick über die Schulter. Überall um sie herum wallten dichte Rauchschwaden empor. »Es ist zu spät«, rief er Baxter zu. »Das ganze Gebäude geht in die Luft! Wir müssen hier raus.«
»Er hat recht.« Baxter griff nach der Notentriegelung des Ausgangs.
Der Aufpasser aus Capitola blieb vollkommen ruhig. »Nein«, sagte er mit fester Stimme. »Zur Vordertür hinaus und in den Gefangenentransporter.«
»Sie sind verrückt!«, rief Pell. »Um Himmels willen. Wir werden alle sterben.« Er stieß die Stahltür auf.
Den Männern schlug eine Woge aus enormer Hitze, Rauch und Funken entgegen. Die Feuerwand draußen verschlang Fahrzeuge, Sträucher und Mülltonnen. Pell fiel auf die Knie und riss beide Hände vor das Gesicht. »Meine Augen...«, schrie er. »Es tut so weh!«
»Pell, verdammt noch mal...« Der Aufpasser trat vor und hob den Taser.
»Nehmen Sie das Ding weg. Er geht nirgendwohin«, sagte Baxter verärgert. »Er ist verletzt.«
»Ich kann nichts sehen!«, stöhnte Pell. »Hilf mir doch jemand!«
Baxter ging zu ihm und bückte sich.
»Nicht!«, rief der andere Beamte.
Dann taumelte der Aufseher mit verblüffter Miene zurück, weil Pell ihm mehrfach ein Filetiermesser in Bauch und Brust stieß. Baxter sank auf die Knie und griff nach dem Pfefferspray. Das Blut schoss in Strömen aus seinem Leib hervor. Pell packte ihn an den Schultern und duckte sich hinter ihn, als der andere Wärter den Taser abfeuerte. Die beiden Sonden gingen fehl.
Pell stieß Baxter beiseite und stellte sich dem Aufpasser, der den nun nutzlosen Taser fallen ließ.
Der große Mann erstarrte und musterte das Messer. Pells blaue Augen richteten sich auf sein verschwitztes schwarzes Gesicht.
»Tu das nicht, Daniel.«
Pell griff an.
Der Aufpasser ballte die riesigen Fäuste. »Okay, du hast es so gewollt.«
Pell sagte nichts. Wer die Kontrolle besaß, brauchte weder zu erniedrigen noch zu drohen oder zu spotten. Er sprang vor, wich den Schlägen des Mannes aus und verpasste ihm ein Dutzend harte Treffer. Die Waffe steckte in seiner geballten rechten Faust, mit der Klinge nach unten und der Schneide nach außen. Gegen einen starken, kampfbereiten Gegner setzte man ein Messer am effektivsten ein, indem man damit in schneller Folge zuschlug.
Der Mann verzog das Gesicht und fiel auf die Seite. Seine Beine strampelten, und er griff sich an Brust und Kehle. Dann hörte er auf, sich zu bewegen. Pell nahm ihm die Schlüssel ab und öffnete die eisernen Fesseln.
Baxter kroch langsam weg und versuchte immer noch, mit vor Blut rutschigen Fingern das Reizgas aus dem Holster zu ziehen. Als Pell zu ihm ging, riss er die Augen auf. »Bitte. Tun Sie mir nichts. Ich hab doch bloß meine Arbeit gemacht. Wir sind beide gute Christen! Ich war freundlich zu Ihnen. Ich …«
Pell packte ihn an den Haaren. Er war versucht zu sagen: Du hast Gottes Zeit damit verschwendet, für deinen Autoschlüssel zu beten?
Aber man sollte nicht erniedrigen oder drohen oder spotten. Pell bückte sich und schnitt ihm zügig die Kehle durch.
Als Baxter tot war, ging Pell wieder zu dem Hinterausgang. Er schützte seine Augen, öffnete die Tür und nahm den feuerfesten Beutel aus Metallgewebe, der draußen unmittelbar vor der Schwelle lag und das Messer enthalten hatte.
Pell griff erneut hinein und spürte plötzlich eine Pistolenmündung im Genick.
»Keine Bewegung.«
Pell erstarrte.
»Weg mit dem Messer.«
Er zögerte kurz. Die Pistole zitterte nicht; Pell merkte, dass sein Gegner bereit war, den Abzug zu drücken. Er seufzte. Das Messer fiel klappernd zu Boden. Dann warf er dem Mann einen Blick zu. Es war ein junger Latino in Zivil, der nun ein Funkgerät an den Mund hob, ohne Pell aus den Augen zu lassen.
»Juan Millar hier. Kathryn, sind Sie da?«
»Sprechen Sie«, erklang die verzerrte Stimme der Frau. Kathryn...
»Ich bin elf-neun-neun, brauche dringend Verstärkung, an der Brandschutztür, Erdgeschoss, kurz vor dem Zellentrakt. Zwei Aufseher am Boden. Schwer verletzt. Neun-vier-fünf, benötigen Krankenwagen. Wiederhole, ich bin elf-neun...«
In diesem Moment explodierte draußen der Tank des nächstgelegenen Wagens, und eine orangefarbene Flamme schoss zur offenen Tür herein.
Der Beamte duckte sich.
Pell nicht. Sein Bart loderte auf, die Flammen züngelten über seine Wange, aber er wankte nicht.
Sei standhaft...
…Vier
»Juan, wo ist Pell?«, rief Kathryn Dance in das Funkgerät. »Juan, bitte melden. Was ist da unten los?«
Keine Antwort.
Der Elf-neun-neun war eigentlich ein Funkcode der Highway Patrol, aber in Kalifornien kannte ihn jeder Beamte. Er bedeutete, dass ein Kollege sofortige Unterstützung anforderte.
Und nun meldete er sich nach seinem ersten Funkspruch nicht mehr.
Der Sicherheitschef des Gerichtsgebäudes, ein ehemaliger Cop mit grauem Bürstenhaarschnitt, steckte seinen Kopf zur Tür herein. »Wer leitet die Suche? Wer hat hier das Sagen?«
Sandoval sah zu Dance. »Sie sind die ranghöchste Beamtin.«
Eine solche Situation hatte Dance noch nie erlebt – eine Brandbombe und die Flucht eines Mörders wie Daniel Pell; andererseits gab es wohl niemanden auf der gesamten Halbinsel, der über entsprechende Erfahrungen verfügte. Sie konnte die Suche koordinieren, bis jemand vom MCSO oder der Highway Patrol übernahm. Es war von entscheidender Bedeutung, schnell und zielstrebig vorzugehen.
»Okay«, sagte sie und wies den Sicherheitschef an, sofort mehr Leute nach unten zu beordern und die Ausgänge zu überwachen.
Von draußen hörte man Schreie. Menschen liefen über den Flur. Funksprüche wechselten hin und her.
»Seht euch das an«, sagte TJ und nickte in Richtung des Fensters, vor dem schwarzer Rauch vollständig die Sicht verdeckte. »O Mann.«
Trotz des Feuers, das mittlerweile auch in das Gebäude vorgedrungen sein konnte, beschloss Kathryn Dance, in Alonzo Sandovals Büro zu bleiben. Sie würde keine Zeit mit einem Ortswechsel oder einer Evakuierung verschwenden. Falls das Haus in Flammen aufging, konnten sie aus dem Fenster auf die Dächer der Wagen springen, die auf dem vorderen Parkplatz standen, drei Meter unter ihnen. Dance versuchte erneut, Juan Millar zu erreichen, aber er ging weder an sein Telefon noch an sein Funkgerät. »Das Gebäude muss Raum für Raum abgesucht werden«, sagte sie zu dem Sicherheitschef.
»Ja, Ma’am.« Er lief los.
»Für den Fall, dass er abhaut, will ich vorsorglich Straßensperren«, sagte Dance zu TJ. Sie zog das Jackett aus und warf es über einen Stuhl. Unter ihren Achseln bildeten sich Schweißflecke.
»Hier, hier, hier...« Ihre kurzen Fingernägel klopften laut auf die laminierte Straßenkarte von Salinas.
TJ merkte sich die Stellen und verständigte die California Highway Patrol – Kaliforniens Staatspolizei – und das MCSO.
Sandoval, der Staatsanwalt, schaute grimmig und erschüttert ebenfalls zu dem rauchverhangenen Parkplatz. Auf der Fensterscheibe spiegelten sich blinkende Signalleuchten. Er sagte nichts. Weitere Meldungen kamen herein. Keine Spur von Pell, weder im Gebäude noch draußen.
Von Juan Millar auch nicht.
Einige Minuten später kehrte der Sicherheitschef zurück. Er hatte Ruß im Gesicht und hustete laut. »Das Feuer ist unter Kontrolle. Hat praktisch nur draußen gebrannt.« Er atmete tief durch. »Aber, Sandy...«, fügte er mit bebender Stimme hinzu. »Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Jim Baxter tot ist. Der Wärter aus Capitola auch. Erstochen. Wie es aussieht, ist Pell irgendwie an ein Messer gelangt.«
»Nein«, flüsterte Sandoval. »O nein.«
»Und Millar?«, fragte Dance.
»Wir können ihn nirgendwo entdecken. Vielleicht hat Pell ihn als Geisel genommen. Wir haben ein Funkgerät gefunden. Vermutlich seines. Aber wir können nicht sagen, wohin Pell verschwunden ist. Jemand hat die hintere Brandschutztür geöffnet, aber bis vor ein paar Minuten hat es da überall gebrannt. Da entlang kann er nicht geflohen sein. Der einzige andere Weg führt durch das Gebäude, und dort wäre er in seinem Häftlingsoverall sofort aufgefallen.«
»Es sei denn, er hat Millars Sachen angezogen«, sagte Dance.
TJ sah sie verunsichert an; sie wussten beide, was das bedeuten würde.
»Sagen Sie allen Bescheid, dass er einen dunklen Anzug mit weißem Hemd tragen könnte.« Millar war viel größer als Pell. »Die Hosenbeine wären hochgekrempelt«, fügte sie hinzu.
Der Sicherheitschef drückte die Sendetaste seines Funkgeräts und gab die Nachricht durch.
TJ blickte von seinem Telefon auf. »Die ersten Straßen werden gesperrt«, rief er und wies auf die Karte. »Die CHP hat ein halbes Dutzend Streifenwagen und Motorräder zusammengerufen. In fünfzehn Minuten dürften die wichtigsten Highways abgeriegelt sein.«
Zum Glück war Salinas keine allzu große Stadt – nur etwa hundertfünfzigtausend Einwohner – und lag zudem mitten in einem ausgedehnten Agrargebiet (ihr Spitzname lautete »Salatschüssel der Nation«), das nur von wenigen Straßen (und damit möglichen Fluchtrouten) durchzogen wurde. Falls Pell es zu Fuß und querfeldein versuchte, würde er weithin sichtbar sein, da man dort in erster Linie niedrig wachsende Feldfrüchte wie Kopfsalat, Beeren, Rosenkohl, Spinat und Artischocken anbaute.
Dance wies TJ an, er solle dafür sorgen, dass Pells Foto an das Sheriff’s Office und sämtliche Straßensperren weitergeleitet wurde.
Was gab es noch zu tun?
Sie griff sich an den Zopf, der in dem roten elastischen Band endete, das die energische Maggie ihr an jenem Morgen um das geflochtene Haar geschlungen hatte. So war es bei ihnen Brauch; jeden Morgen wählte das Kind die Farbe für Haarband, -spange oder -klammer des jeweiligen Tages aus. Dance erinnerte sich, wie die braunen Augen ihrer Tochter hinter dem Metallgestell der Brille gefunkelt hatten, als sie der Mutter von dem bevorstehenden Tag im Musiklager erzählte und vorschlug, welche Snacks es auf der morgigen Geburtstagsfeier von Kathryns Vater geben sollte. (Vermutlich hatte Wes genau diese Gelegenheit genutzt, um ihr die Stofffledermaus in die Handtasche zu stecken.)
Und sie dachte daran, wie gespannt sie gewesen war, einen so berüchtigten Verbrecher zu verhören.
Mansons Sohn...
Das Funkgerät des Sicherheitschefs erwachte knisternd zum Leben. »Wir haben einen Verletzten«, rief eine aufgeregte Stimme. »Ziemlich schlimm. Dieser Monterey County Detective. Anscheinend hat Pell ihn mitten ins Feuer gestoßen. Die Sanitäter haben einen Rettungshubschrauber angefordert. Er ist bereits auf dem Weg.«
Nein, nein... Dance und TJ sahen sich an. Seine sonst so unbezwingbar fröhliche Miene verzog sich bestürzt. Dance war klar, dass Millar unter entsetzlichen Schmerzen litt, aber sie musste wissen, ob er ihnen irgendeinen Hinweis auf Pells Fluchtweg geben konnte. Sie deutete auf das Funkgerät. Der Sicherheitschef gab es ihr. »Hier spricht Agent Dance. Ist Detective Millar bei Bewusstsein?«
»Nein, Ma’am. Es... es sieht nicht gut aus.« Eine Pause.
»Trägt er Kleidung?«
»Ob er... wie bitte?«
»Hat Pell ihm die Kleidung abgenommen?«
»Oh, nein, hat er nicht. Ende.«
»Was ist mit der Waffe?«
»Keine Waffe.«
Scheiße.
»Geben Sie an alle durch, dass Pell bewaffnet ist.«
»Roger.«
Dance fiel noch etwas ein. »Ich möchte, dass der Rettungshubschrauber vom ersten Moment an bewacht wird. Pell könnte vorhaben, als blinder Passagier mitzufliegen.«
»Roger.«
Sie gab das Funkgerät zurück, nahm ihr Telefon aus der Tasche und drückte die Kurzwahltaste vier.
»Herzstation«, meldete sich Edie Dances leise, sanfte Stimme.
»Mom, ich bin’s.«
»Was ist los, Katie? Ist irgendwas mit den Kindern?« Dance sah die untersetzte Frau mit dem kurzen grauen Haar und dem alterslosen Gesicht vor sich, wie sie nun besorgt durch die große runde Brille mit dem grauen Gestell blickte. Und sie würde sich ein Stück vorbeugen – ihre unwillkürliche Reaktion auf Anspannung.
»Nein, uns geht’s gut. Aber einer von Michaels Detectives hat schlimme Verbrennungen erlitten. Es gab einen Brandanschlag auf das Gerichtsgebäude, als Teil eines Fluchtplans. Du wirst es in den Nachrichten hören. Wir haben zwei Aufseher verloren.«
»Oh, das tut mir leid«, murmelte Edie.
»Der Detective heißt Juan Millar. Du hast ihn ein paarmal getroffen.«
»Ich kann mich nicht an ihn erinnern. Ist er hierher unterwegs?«
»Bald. Per Hubschrauber.«
»So schlimm?«
»Habt ihr eine Abteilung für Brandwunden?«
»Eine kleine, als Teil der Intensivstation. Zur weiteren Behandlung dürfte er so bald wie möglich nach Alta Bates, zur Uniklinik in Davis oder nach Santa Clara verlegt werden. Vielleicht auch nach Grossman.«
»Könntest du von Zeit zu Zeit nach ihm sehen und mich wissen lassen, wie es ihm geht?«
»Aber natürlich, Katie.«
»Und falls es irgendwie möglich ist, möchte ich mit ihm sprechen. Was auch immer er gesehen hat, könnte uns weiterhelfen.«
»Ist gut.«
»Ich werde heute den ganzen Tag zu tun haben, sogar falls wir den Kerl gleich wieder einfangen. Könntest du Dad bitten, die Kinder abzuholen?« Stuart Dance, ein pensionierter Meeresbiologe, arbeitete gelegentlich im berühmten Monterey Aquarium, war aber stets gern bereit, die Kinder zu fahren.
»Ich rufe ihn gleich an.«
»Danke, Mom.«
Dance unterbrach die Verbindung und sah, dass Staatsanwalt Alonzo Sandoval wie betäubt auf die Karte starrte. »Wer hat ihm geholfen?«, flüsterte er. »Und wo, zum Teufel, steckt Pell?«
Auch Kathryn Dance stellte sich immer wieder diese beiden Fragen.
Und dazu noch eine dritte, in verschiedenen Variationen: Was hätte ich tun können, um ihn besser zu analysieren? Was hätte ich tun können, um diese ganze Tragödie zu verhindern?
... Fünf
Der Rotor wirbelte die Rauchfahnen in einem eleganten Muster vom Parkplatz, als der Hubschrauber abhob, um Juan Millar ins Krankenhaus zu bringen.
Vaya con Dios...
Dance erhielt einen Anruf. Schaute auf das Display des Telefons. Sie war erstaunt, dass Overby so lange gebraucht hatte, um sie zurückzurufen. »Charles«, begrüßte sie ihren Chef, den Leiter der CBI-Dienststelle für den Westen von Zentralkalifornien.
»Ich bin auf dem Weg zum Gerichtsgebäude. Was haben wir, Kathryn?«
Sie brachte ihn auf den neuesten Stand, einschließlich der beiden Toten und Millars Verfassung.
»Tut mir leid, das zu hören... Gibt es schon irgendwelche Anhaltspunkte, die wir weitergeben können?«
»An wen?«
»An die Presse.«
»Lieber nicht, Charles. Wir haben kaum Informationen. Er könnte überall sein. Ich habe Straßensperren angeordnet und lasse das ganze Gebäude absuchen.«
»Genaueres wissen wir nicht? Nicht mal eine Richtung?«
»Nein.«
Overby seufzte. »Okay. Ach, übrigens, Sie leiten die Operation.«
»Was?«
»Ich möchte, dass Sie die Fahndung übernehmen.«
»Ich?« Sie war überrascht. Als oberste Strafverfolgungsbehörde des Staates konnte das CBI natürlich die Zuständigkeit für sich beanspruchen, und Kathryn Dance war zweifellos erfahren und qualifiziert genug, um die Aufgabe zu bewerkstelligen, aber das CBI war eine Ermittlungseinheit und verfügte über keine große Belegschaft. Die California Highway Patrol und das Sheriff’s Office würden Personal für die Suche abstellen müssen.
»Warum nicht jemand von der CHP oder dem MCSO?«
»Dieser Fall sollte von zentraler Stelle aus koordiniert werden. Das scheint mir mehr als angebracht. Außerdem ist es bereits beschlossene Sache. Ich habe das mit allen Beteiligten geregelt.«
So schnell? Sie fragte sich, ob er auf ihren Anruf deswegen nicht sofort reagiert hatte – um für das CBI einen Fall mit hoher Medienresonanz an Land zu ziehen.
Nun, ihr sollte es nur recht sein. Sie hatte ein persönliches Interesse daran, Pell zu fangen.
Sie sah seine gebleckten Zähne vor sich, hörte seine beklemmenden Worte.
Ja, das Leben als Cop ist hart. Die Kleinen sind oft allein, nicht wahr? Bestimmt freuen sie sich über ein paar neue Spielkameraden...
»Okay, Charles. Ich mache es. Aber ich möchte Michael mit an Bord haben.«
Wenn Dance mit dem MCSO zusammenarbeitete, dann meistens mit Michael O’Neil. Sie und der sympathische Detective, der sein ganzes Leben in Monterey zugebracht hatte, kannten sich schon seit Jahren. Als sie zum CBI gegangen war, hatte er sogar als ihr Mentor fungiert.
»In Ordnung.«
Gut, dachte Dance. Denn sie hatte ihn schon angerufen.
»Ich bin bald da. Vor der Pressekonferenz halten wir noch eine Lagebesprechung ab.« Overby unterbrach die Verbindung.
Dance wollte zur Rückseite des Gerichtsgebäudes gehen, als ihr ein sich näherndes Einsatzfahrzeug auffiel. Sie erkannte einen Ford Taurus des CBI. Die Signallichter hinter dem Kühlergrill blinkten rot und blau.
Rey Carraneo, der Neuzugang ihrer Abteilung, hielt neben Dance am Bordstein und stieg aus dem Wagen. Der schlanke Mann, dessen schwarze Augen tief unter dichten Brauen lagen, war erst seit zwei Monaten dabei. Dennoch war er nicht so unbedarft, wie er aussah, und hatte unweit von Reno in einer schwierigen Gegend drei Jahre als Polizist gearbeitet, bevor er und seine Frau auf die Halbinsel gezogen waren, damit sie sich um seine kranke Mutter kümmern konnten. Er musste sich noch ein wenig zurechtfinden und mehr Erfahrung sammeln, aber er war ein tüchtiger, zuverlässiger Kollege. Und das war schon viel wert.
Carraneo war nur sechs oder sieben Jahre jünger als Dance, aber im Leben eines Cops waren das wichtige Jahre, und er konnte sich nicht dazu durchringen, sie Kathryn zu nennen, wie sie es ihm häufig anbot. Normalerweise begrüßte er sie mit einem Nicken. Diesmal fiel es besonders respektvoll aus.
»Kommen Sie mit.« Dance musste an die Beweise im Fall Herron und die Benzinbombe denken. »Er hat wahrscheinlich einen Komplizen, und wir wissen, dass er bewaffnet ist«, fügte sie hinzu. »Also Augen auf.« Sie gingen hinter das Gebäude, wo Brandstiftungsexperten und die Spurensicherung des MCSO den Tatort untersuchten. Es sah hier aus wie in einem Kriegsgebiet. Vier Fahrzeuge waren vollständig ausgebrannt, die beiden anderen zur Hälfte. Die rückwärtige Fassade war rußgeschwärzt, die Mülltonnen geschmolzen. Ein blaugrauer Dunst hing in der Luft. Es stank nach verbranntem Gummi – und nach etwas anderem, das sehr viel widerwärtiger war.
Dance ließ den Blick über den Parkplatz schweifen. Dann musterte sie die offene Hintertür.
»Da ist er auf keinen Fall rausgekommen«, sprach Carraneo aus, was Dance bereits dachte. Durch die zerstörten Wagen und Brandspuren auf dem Pflaster war klar, dass die Flammen die Tür umschlossen hatten; das Feuer war ein Ablenkungsmanöver gewesen. Aber wo war er rausgekommen?
»Wissen wir, wem die Autos gehören?«, fragte sie einen Feuerwehrmann.
»Ja, den Angestellten.«
»He, Kathryn, wir haben die Bombe«, sagte ein Mann in Uniform zu ihr. Er war der oberste Branddirektor des Bezirks.
Sie nickte ihm zu. »Was ist es gewesen?«
»Ein großer Koffer mit Rollen, gefüllt mit Plastikmilchflaschen voller Benzin. Der Täter hat ihn unter dem Saab dort platziert. Mit einer langsam brennenden Zündschnur.«
»Ein Profi?«
»Vermutlich nicht. Wir haben die Rückstände der Lunte gefunden. Man kann sie aus einer Wäscheleine und Chemikalien herstellen. Ich würde sagen, die Anleitung stammt aus dem Internet. So wie Kinder sie sich besorgen, um irgendwas in die Luft zu jagen. Leider oft auch sich selbst.«
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Sleeping Doll« bei Simon & Schuster, Inc., New York
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage © 2007 by Jeffery Deaver © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN : 978-3-894-80426-8
www.blanvalet-verlag.de
www.randomhouse.de