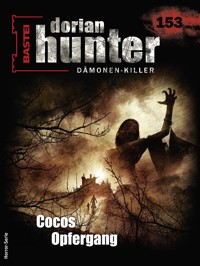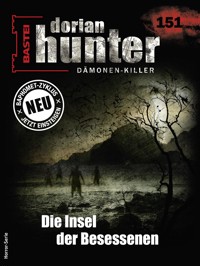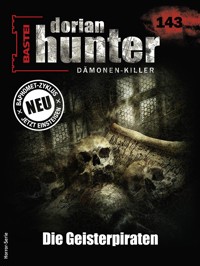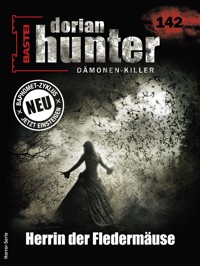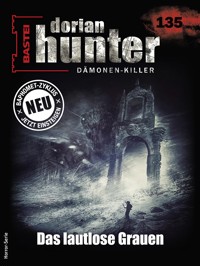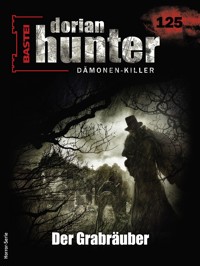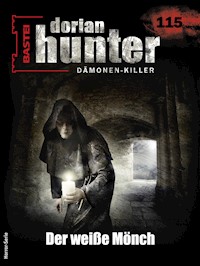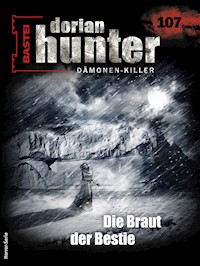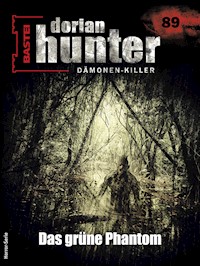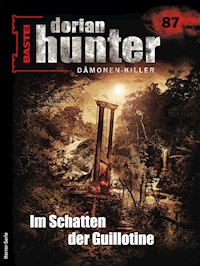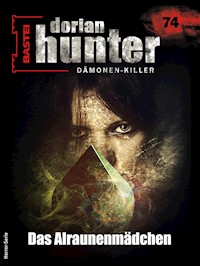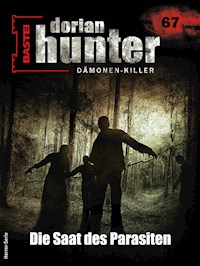Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Die in Lee befindliche spanische Kriegsgaleone drehte mit ihrem zerschossenen Ruder nach Luv hoch und rammte das Achterschiff der anderen Kriegsgaleone. Ihr Bugspriet bohrte sich durch eins der Fenster der Seitengalerie und verhakte sich dort. Im Nu war der Teufel los. Die Bugsprietstenge der Galeone ging zu Bruch, und die Galionsfigur, ein Einhorn, erschien in der Kammer des Schiffsarztes, der fluchtartig und voller Panik an Deck stürzte. Er dachte wohl, der Teufel habe sich in ein Einhorn verwandelt - mit der Absicht, ihn aufzuspießen. Eine hübsche weibliche Galionsfigur wäre dem Schiffsarzt bestimmt willkommener gewesen, aber bei dem grimmigen Einhorn gingen ihm die Nerven durch...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2307
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2018 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.ISBN: 978-3-95439-780-8Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Nr. 401
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 402
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 403
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 404
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 405
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 406
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 407
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 408
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 409
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 410
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 411
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 412
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 413
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 414
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 415
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 416
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 417
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 418
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 419
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 420
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
1.
Karl von Hutten wußte nicht, wie oft er den Ratsfelsen schon erklommen hatte. Hundertmal? Vielleicht, aber es spielte keine Rolle. Von Bedeutung war hingegen, daß ihn der Ausblick, der sich von hier oben, bot, immer wieder aufs neue faszinierte. So auch an diesem Vormittag des 19. Juli 1594: Das Bild war beeindruckend, er ließ es auf sich einwirken.
Einige Minutenlang stand er still und sah auf die Bucht mit den darin ankernden Schiffen, den Strand, die Hütten und den majestätischen Felsendom hinunter. Tiefblau war das Wasser, weiß der Sand. Die unterschiedlichen Farben der Felsen bildeten einen reizvollen Kontrast dazu. Diese Insel schien – wie er und die Freunde schon oft festgestellt hatten – das Paradies schlechthin zu sein, ein Hort der Ruhe und Unveränderlichkeit. Und doch täuschte der scheinbare Zustand des Friedens und der Sorglosigkeit über die wahren Tatsachen hinweg.
Aufgerüstet wurde auf der Schlangen-Insel, und das schon seit Tagen. Verdruß hatte sich angekündigt, der Bund der Korsaren rüstete zum Kampf. Das große Geheimnis existierte nicht mehr, der Schleier war gelüftet: Die Spanier wußten jetzt, wo die Schlangen-Insel lag, die Black Queen hatte ihnen die Position verraten.
Von Hutten verschränkte die Arme vor der Brust. Mußten sie den Gegner wirklich fürchten? War er so stark, wie sie annahmen? Die Nachrichten aus Havanna ließen keinen Zweifel und keine Fehldeutung zu. Die Insel war bedroht, ihre Bewohner schwebten in höchster Lebensgefahr – und das galt nicht nur für die Schlangen-Insel, sondern wahrscheinlich auch für Coral Island, wenn es dem Gegner einfiel, ein wenig die Umgebung abzusuchen, um weitere „Piraten“ aufzustöbern.
Von Huttens Blick wanderte nach Westen, weit über die See hinaus. Aber noch zeigten sich keine Mastspitzen an der Kimm, noch ließ sich der Feind nicht blicken. Die Späher und Ausguckposten waren auf der Hut, sie würden jede Bewegung auf dem Meer unverzüglich melden.
Prüfend schaute er zum Himmel auf – aber auch dort rührte sich nichts, nur ein paar weiße Wolkenfetzen glitten träge dahin. Keine Brieftaube erschien, neue Hinweise aus Havanna ließen auf sich warten.
Ein Geräusch hinter seinem Rücken ließ ihn herumfahren. Hesekiel Ramsgate trat zu ihm und lächelte.
„Was ist?“ fragte er. „Glaubst du, daß die Spanier sich irgendeinen Trick einfallen lassen, um heimlich zu landen?“
„Der Trick muß erst noch erfunden werden“, erwiderte Karl von Hutten. „Aber, unter uns gesagt, ein bißchen zappelig bin ich inzwischen doch.“
Ramsgate trat zwischen die Kanonen, die auf dem Ratsfelsen postiert worden waren, und fuhr mit der Hand über eins der Rohre. „Jede Art von Vorsorge ist getroffen worden, und es wird immer noch fieberhaft geschanzt und am Ausbau der Inselverteidigung gearbeitet.“
„Mit anderen Worten, wir haben nichts zu befürchten?“
„Die Kampfkraft der Spanier dürfte überragend sein.“
„Also müssen wir damit rechnen, daß sie es schaffen, unsere Abwehr zu durchbrechen und tatsächlich zu landen“, sagte von Hutten. „Herrgott, wir sprechen darüber, als handle es sich um eine ganz normale, alltägliche Angelegenheit. Sind wir nicht alle ein bißchen übergeschnappt?“
„Vielleicht. Aber du darfst nicht Vergessen, daß wir uns, was die Befestigung der Insel betrifft, gewissermaßen im Vorsprung befinden.“
„Weil Siri-Tong durch die Anlagen, die sie schon seinerzeit geschaffen hat, ein erhebliches Stück Arbeit geleistet hat, ich weiß“, sagte von Hutten. „Wir haben ihr viel zu verdanken, sie hat vorausschauend gehandelt. Aber glaubst du wirklich, daß wir an alles gedacht haben?“
„Die strategisch wichtigen Punkte sind mit Geschützen bestückt“, entgegnete der Alte. „An Munition mangelt es nirgends, und die Sperren sind ebenfalls eine harte Nuß, die der Gegner knacken muß, wenn er seine Invasionspläne in die Tat umsetzen will.“
„Die Schlangen-Insel ist also uneinnehmbar?“
„Wie denkst du darüber?“
„Wir können sie halten“, erwiderte von Hutten. „Wir kämpfen mit Zähnen und Krallen, bis zum Letzten, das ist klar. Aber ich denke auch an die Frauen und Kinder. Und dieses Warten und die Ungewißheit zehren an meinen Nerven.“
„Nun, wenn ich ehrlich bin – mir ist es auch lieber, wenn ich weiß, woran ich bin“, brummte der Alte. „Aber wir sind nun mal dazu verdammt, hier zu hocken und den Lauf der Dinge abzuwarten. Was meinst du, ob sich das Wetter noch ändert?“
„Donegal sagt, es bleibt so, wie es ist. Er muß es Wissen, denn vor einem Umschwung meldet sich stets sein Beinstumpf.“
„Am besten fragen wir ihn noch mal, wenn er zurückkommt. Vielleicht zieht doch ein Sturm herauf.“
„Malst du jetzt den Teufel an die Wand?“
„Nein, das liegt nicht in meiner Art“, erwiderte Ramsgate und grinste. „Ich denke immer nur an das Positive. Aber, übrigens – Donegal ist auch schon überfällig, nicht wahr?“
„Hoffen wir, daß er bald einläuft“, sagte von Hutten, dann ließ er wieder seinen Blick schweifen.
Die Aktivitäten auf der Schlangen-Insel brachen nicht mehr ab, ständig herrschte rege Betriebsamkeit. Zwischen den Schiffen und dem Ufer glitten die Jollen hin und her, die Schiffe wurden fix und fertig ausgerüstet. Es herrschte ständige Alarm- und Gefechtsbereitschaft – seit der Täuberich Dragan am 10. Juli Arnes Hiobsbotschaft aus Havanna gebracht hatte, daß die Position der Insel von der Black Queen an den Gouverneur Don Antonio de Quintanilla verraten worden wäre.
Ferner war am 13. Juli der Täuberich Omar mit Arnes Nachricht gefolgt, daß Don Juan flüchtig sei und von den Schergen des Gouverneurs wegen Mordes an einer Dame der Gesellschaft gesucht würde. Seitdem wartete der Bund der Korsaren auf neue Botschaften von Arne von Manteuffel, und die Spannung wuchs von Tag zu Tag.
Von Old Donegal Daniel O’Flynn, der noch am 10. Juni nach dem Eintreffen der Brieftaube Dragan mit der „Empress of Sea II.“ nach Westen zur Aufklärung in See gegangen war, hatte man in der Zwischenzeit nichts mehr gehört. Ramsgates Bedenken bezüglich der „Wettervorhersage“ des Alten mochten daher begründet sein, denn nunmehr waren immerhin neun Tage vergangen.
Am späten Vormittag gab es endlich aber doch wieder Neuigkeiten. Karl von Hutten sah die Brieftaube, die sich der Insel näherte, in dem Augenblick, in dem auch einer der Posten ihr Auftauchen meldete. Von Hutten hatte sich ein Spektiv besorgt und verfolgte den Anflug des Tieres.
Kurze Zeit darauf senkte sich der Täuberich Achmed in langgezogenen, kreisförmigen Bahnen auf die Insel und fiel in seinen Schlag ein. Das Glöckchen geriet in Bewegung, Achmeds „Gattin“ Fatima begann in dem Nebenschlag zu flattern und aufgeregt auf und ab zu hüpfen. Dann erschien Gotlinde und erleichterte Achmed um die neue Botschaft, die wie üblich von Jussuf in Havanna unter den Schwanzfedern befestigt worden war.
Am Strand der Bucht versammelten sich alle um Karl von Hutten, der die Nachricht auseinanderrollte und verlas: „6 Kriegsgaleonen, 4 Kriegskaravellen 18. 7. 17.00 Uhr Kurs Osten ausgelaufen. An Bord von Flaggschiff Gouverneur. Verfolge Verband mit Don Juan und Schebecke, um bereits zuzuschlagen – Arne.“
„Großartig“, sagte Hasard mit grimmigem Gesicht. „Jetzt wissen wir es endlich. Die Unsicherheit und das Warten sind vorbei. Kurs Osten – das bedeutet Ziel Schlangen-Insel. Freunde, der Bund der Korsaren tritt sofort zur Beratung zusammen.“
„Eins ist mir nicht ganz klar“, sagte der Wikinger, als er sich mit Hasard, Siri-Tong, Jean Ribault, Jerry Reeves und Arkana auf dem Ratsfelsen eingefunden hatte. „Was hat diese Bemerkung zu bedeuten, daß Arne mit Don Juan die Verfolgung aufgenommen hat, um schon mal zuzuschlagen?“
„Eben das, was sie aussagt“, erwiderte Hasard trocken. „Sie folgen dem Verband als Fühlungshalter.“
„Aber – wenn dem so ist, da muß es Arne ja gelungen sein, Don Juan auf die Seite des Bundes zu ziehen“, sagte Ribault. „Donnerwetter, das ist ein tolles Stück! Aber Arne hat schon lange geplant, den guten Don Juan auf unsere Seite zu bringen.“
„Es muß ihn einiges gekostet haben“, sagte der Seewolf. „Don Juan kann nicht leicht zu überreden gewesen sein. Aber es müssen die jüngsten Ereignisse in Havanna gewesen sein, die ihn davon überzeugt haben, daß er bislang auf der falschen Seite gekämpft hat.“
„Eine positive Nachricht“, meinte Siri-Tong. „Sie besagt aber nicht nur, daß Don Juan de Alcazar künftig nicht mehr als Gegner zu betrachten ist, sondern vor allen Dingen, daß er und Arne offenbar auch gewillt sind, dem Kampfverband der Dons von Anfang an Schaden zuzufügen.“
„Recht so!“ stieß Thorfin Njal hervor. „Und da Arne und Don Juan harte und erprobte Kämpfer sind und über die schnelle und kampfkräftige Schebecke verfügen, steht zu erwarten, daß sie dem Verband ziemlich zusetzen werden. Richtig?“
„Richtig“, erwiderte die Rote Korsarin lachend. „Oder besser – wir wollen es hoffen und den beiden die Daumen drücken.“
„Dennoch besteht bei uns kein Grund zum Frohlocken“, sagte Hasard. „Denn zehn Kriegsschiffe als Gegner sind ein ziemlich harter Brocken. Das wissen wir alle, und es ist auch klar, daß wir den Feind auf keinen Fall unterschätzen dürfen.“
„Es wird hart auf hart gehen, und wir werden viel Glück brauchen.“
Der Wikinger hob die geballte Rechte. „Wetzt die Messer! Schärft die Spitzen! Bei Odin, es wäre doch gelacht, wenn wir diesen Verband nicht zerschlagen und den Dons ein Höllenfeuerchen unter ihren Hintern entfachen würden! Wir laufen mit allen Schiffen aus und segeln ihnen mit voller Formation entgegen.“
Hasard schüttelte den Kopf. „Nein, ausgeschlossen“, sagte er.
Der Wikinger blickte ihn aus geweiteten Augen und mit geöffnetem Mund an. Langsam sank seine Faust nach unten. Er glaubte, nicht richtig gehört zu haben.
„Was? Wie – wie meinst du das?“ stammelte er verwirrt. „Bist du von allen guten Geistern verlassen?“
Hasards Mund verzog sich zu einem halb spöttischen, halb amüsierten Grinsen. „Das hoffe ich nicht. Aber wir können auf keinen Fall mit allen Schiffen auslaufen, das muß auch dir einleuchten. Ein Schiff muß hierbleiben.“
„Aber – die Insel ist durch ihre Befestigungsanlagen und Kanonen ausreichend gesichert!“ begehrte der Nordmann mit dröhnender Stimme auf.
„Es gibt noch einen anderen wichtigen Grund, mindestens ein Schiff hier zurückzulassen“, sagte der Seewolf ruhig.
„Ja, das sehe auch ich ein“, sagte Siri-Tong.
„Ich aber nicht!“ stieß Thorfin Njal trotzig hervor. Mit beiden Händen griff er sich an den Kupferhelm, als wolle er ihn zurechtrücken. „Wir sind den Dons ohnehin zahlenmäßig unterlegen! In dieser Lage auch noch ein Schiff abzuziehen, das ist – das … Hölle und Donnerwetter, das will mir nicht in den Kopf!“
Die Rote Korsarin legte ihm mit einer beschwichtigenden Geste die Hand auf den Unterarm. „Denk doch mal genau nach, Thorfin. Hasard hat völlig recht. Nehmen wir einmal an, dem Gegner gelingt es, den Bund der Korsaren zu zerschlagen.“
„Niemals! Lieber versenke ich mein eigenes Schiff, als daß ich das zulasse!“
„Du sollst ja auch nur rein theoretisch daran denken“, sagte sie.
„Theo … was? Nein, ich will’s nicht wahrhaben“, brummte er störrisch.
„Das ist eben dein Fehler“, sagte Hasard beharrlich. „Man muß jeden Eventualfall in Betracht ziehen, um gerüstet zu sein. Hört gut zu: Wenn wir unterliegen, dann muß hier wenigstens ein Schiff zur Stelle sein, um die Überlebenden samt einem Teil der in den Höhlen gehorteten Schatzbeute evakuieren zu können.“ Er beugte sich etwas vor und fixierte den Wikinger. „Oder was soll deiner Meinung nach mit unseren Freunden geschehen, wenn die Dons landen?“
„Die Insel räumen“, murmelte Thorfin, „alles aufgeben? Nein. Das überleb’ ich nicht. Sleipnir soll mich zertrampeln, Geri und Freki sollen mich zerreißen und Hugin und Munin mir die Augen auspicken – nur das nicht!“
„Nun mach’s doch nicht so dramatisch“, sagte Siri-Tong. „Wir dürfen einfach nicht riskieren, daß die Schlangen-Insel im Sturm genommen wird und dabei alle drauf gehen. Das ist genau der Punkt. Folglich lassen wir ein Schiff hier zurück, Punktum und basta!“
Sie diskutierten noch eine Weile herum, aber schließlich mußte sich auch der Wikinger diesem Argument beugen. Die Zweckmäßigkeit einer solchen Maßnahme ließ sich nicht von der Hand weisen.
Er knirschte kräftig mit den Zähnen und stieß einen Fluch aus, dann sagte er: „Und welches Schiff soll zurückbleiben, wenn man fragen darf? Doch wohl nicht der Schwarze Segler? Das lasse ich nur über meine Leiche zu.“
Jean Ribault lachte. „Hasard hatte gehofft, du würdest dich freiwillig melden. Denk doch auch an Gotlinde und die Kinder.“
„Laß Thyra und Thurgil aus dem Spiel!“ brüllte der Wikinger. „Ich bin nicht der einzige, der hier Familie hat!“ Er konnte fuchsteufelswild werden, wenn er bei Beratungen an seine „privaten Pflichten“ erinnert wurde.
„Schon gut, Väterchen, reg dich nicht auf“, sagte Ribault.
„Warum bleibst du nicht mit deiner ‚Vengeur‘ hier?“ fragte der Wikinger plötzlich lauernd. „Nun? Das wär’ doch was, oder?“
„Ich kann nicht Däumchen drehen, während die Kameraden kämpfen.“
„Ich auch nicht.“
„Wenn die ‚Empress‘ rechtzeitig zurückkehrt, kann sie in der Bucht ankern, und wir laufen aus“, sagte Renke Eggens, der mit Oliver O’Brien zusammen etwas verspätet den Ratsfelsen betreten hatte. „Damit wäre das Problem gelöst.“
„Auch Donegal läßt sich darauf freiwillig nicht ein“, sagte Arkana. „Und die ‚Empress‘ dürfte wohl auch zu klein sein, um im Fall eines Falles alle Inselbewohner aufzunehmen.“
„Richtig“, sagte Hasard. „Im übrigen können wir mit Donegal und seiner Crew nicht rechnen, solange sie nicht tatsächlich wieder zurück sind. Wir werden die Angelegenheit anders regeln. Lassen wir das Los entscheiden.“
Damit erklärten sich alle einverstanden. Kurze Zeit darauf ließ der Seewolf jeden Schiffskapitän ein dünnes Stück Holz aus seiner geschlossenen Hand ziehen, von denen er eins vorher markiert hatte. Das Los fiel auf Renke Eggens, und somit stand es fest: Er würde mit der „Wappen von Kolberg“ in der Bucht der Schlangen-Insel bleiben.
Eggens hob die Schultern und ließ sie wieder sinken. „Es läßt sich nicht ändern. Aber ihr könnt beruhigt sein, ich halte die ‚Wappen‘ gefechtsbereit und versehe meine Pflichten, wie es sich gehört. Wenn die Dons erscheinen, verwandeln wir die Insel in eine feuerspuckende Festung.“
„Daran zweifelt keiner von uns“, sagte Hasard. „Also, du behältst einen Teil von Arnes Crew, die anderen übernehmen unter dem Kommando von O’Brien die ‚Pommern‘, die mit uns ausläuft.“
Alle Einzelheiten des bevorstehenden Kampfes wurden noch einmal genau durchgesprochen. Jeder wußte, was er zu tun hatte, aber er mußte auch von den anderen wissen, wie sie eingesetzt werden sollten. Jedes Detail mußte festgelegt und durfte nicht dem Zufall überlassen werden, soweit sich das vermeiden ließ.
Arkana und ihre Krieger und Kriegerinnen würden die Insel verteidigen und gegebenenfalls bei einem Lande- und Besetzungsmanöver des Feindes versteckt von den Höhlen aus den Kampf fortsetzen, und zwar mit einem harten Kern des Stammes. Alle anderen sollten zunächst zu den Timucuas auf Coral Island evakuiert werden, wo sie sicher waren, solange sich der Angriff der Spanier auf die Schlangen-Insel konzentrierte.
Karl von Huttens Aufgabe stand ebenfalls fest. Er würde zusammen mit Arkana die Verteidigung der Insel leiten, zumal er sich seit Beginn der Verteidigungsbauten intensiv um alles gekümmert hatte.
Ihm zur Seite standen Hesekiel Ramsgate als Techniker und Baumeister sowie noch ein paar Männer der Werftbelegschaft. Alle waren ausreichend bewaffnet und verstanden, sowohl mit Musketen und Pistolen als auch mit Blankwaffen umzugehen.
Der Rat beendete seine Tagung, die Männer und Frauen schritten zur Tat. Da alle Schiffe seit den letzten Tagen auslaufklar waren, gab es jetzt keine Verzögerungen mehr. Kapitäne und Mannschaften begaben sich an Bord, und bald darauf wurden die Anker gelichtet.
Am frühen Nachmittag – der Mahlstrom war günstig – gingen die Schiffe in See und segelten auf westlichem Kurs davon: die „Isabella IX.“ mit Hasard und den Seewölfen, der Schwarze Segler des Wikingers, die „Caribian Queen“ mit Siri-Tong, die „Le Vengeur III.“ unter dem Kommando von Jean Ribault, die „Tortuga“ mit Jerry Reeves und die „Pommern“ unter dem Kommando von Oliver O’Brien.
Geeinigt hatte man sich auf folgende Taktik: Der Verband der spanischen Kriegsschiffe sollte gestellt und geschlossen angegriffen werden. Danach aber sollten Einzelkämpfe stattfinden, die darauf abgezielt waren, den Gegner daran zu hindern, zur Schlangen-Insel durchzubrechen.
Je weiter westlich entfernt man den Feind stellte, desto besser war es, darüber waren sich alle einig. Größere Distanz zur Schlangen-Insel bedeutete mehr Zeit und Raum für die Einzelgefechte.
An diese bevorstehenden Kämpfe dachten die Männer an Bord der Schiffe, an nichts anderes mehr. Die „Isabella“, „Eiliger Drache“, die „Caribian Queen“, die „Le Vengeur“, die „Tortuga“ und die „Pommern“ segelten unter Vollzeug und mit vollem Preß. Der Wind fiel aus Nordosten ein, also günstig für sie. Sie liefen gute Fahrt, und bald war die Schlangen-Insel an der östlichen Kimm verschwunden.
2.
Bei einem Etmal von nahezu einhundertvierzig Seemeilen pro Tag standen die sechs Schiffe am Nachmittag des 21. Juli, nach zwei vollen Tagen also, südlich der Columbus-Bank beim Cay Santo Domingo am östlichen Ausgang des Alten Bahama-Kanals und harkten in auseinandergezogener Dwarslinie nach Westen die See ab.
An Bord der „Isabella“ hatten zu diesem Zeitpunkt Gary Andrews und Sam Roskill die Ausguckposten inne. Gary, der Fockmastgast, war es, der als erster den kleinen Dreimaster sichtete, der sich aus westlicher Richtung näherte.
„Mastspitzen!“ meldete er, dann richtete er sein Spektiv auf die Erscheinung, die sich wie ein rumpfloses Gerüst aus den sanften Wogen hob. Er drehte am Okular und stellte die Schärfe richtig ein, dann stieß er einen Pfiff aus.
„Da brat mir doch einer einen Barsch“, sagte er. „Das ist ja – Donegal!“ Er ließ das Rohr sinken, beugte sich über die Segeltuchumrandung des Vormars und schrie: „Der Teufel soll mich holen – es ist die ‚Empress‘!“
Tatsächlich hatte er sich nicht getäuscht, es war wirklich die „Empress of Sea II.“ die in der breitgefächerten „Harken“-Formation der sechs Schiffe hängenblieb. Sie drehten bei, und die Mannschaften geiten die Segel auf. Kurze Zeit darauf hatte Old O’Flynn mit seiner „Empress“ zur „Isabella“ herangeschlossen, drehte ebenfalls bei und ging auf eine Distanz von knapp zwanzig Yards an sie heran.
„Holla!“ rief der Alte. „Das ist mal eine Überraschung! Was treibt ihr denn hier?“
„Dreimal darfst du raten!“ entgegnete Hasard, der ein Stück in den Lee-Besanwanten aufgeentert war und sich mit einer Hand in den Webeleinen festhielt. „Wir sind ganz auf Kampf eingestellt! Was bringst du für Neuigkeiten?“
Der Alte schien jetzt sehr erregt zu sein. „Du glaubst ja nicht, was wir erlebt haben! In der Nacht des 19. – im westlichen Bereich des Nicolas-Kanals!“
„Was?“ rief der Seewolf. „Spann mich nicht auf die Folter!“
„Wir sind auf die Schebecke von Don Juan gestoßen!“
„Und wer war an Bord?“ fragte Hasard. Seine Männer begannen bereits zu grinsen und sich untereinander mit den Ellenbogen anzustoßen. Die Zwillinge waren die ersten an Bord der „Empress“, die es bemerkten, aber sie hüteten sich, den Alten darauf aufmerksam zu machen.
„Na, halt dich mal schön fest!“ brüllte Old O’Flynn. „Du kommst nicht drauf, beim Henker nicht!“
„Laß mich raten!“ rief Hasard. „Don Juan de Alcazar natürlich – und Arne! Richtig?“ Er konnte sich sein Grinsen ebenfalls nicht mehr verkneifen.
„Stimmt’s oder stimmt’s nicht?“ brüllte Carberry. „Donegal, was ist los? Hat es dir die Sprache verschlagen?“
„Ihr Stinte!“ schrie der Alte mit hochrotem Kopf. „Ihr wißt ja schon alles! Hölle und Teufel, dann brauche ich ja gar nicht erst Aufklärung zu fahren und mir tage- und nächtelang die Augen aus dem Kopf zu starren! Genausogut kann ich in der Rutsche hängen und mir die Hucke voll saufen!“
„Beruhige dich!“ rief Hasard. „Es ist nicht unsere Schuld, daß wir bereits Bescheid wissen! Wir haben wieder eine Brieftauben-Botschaft aus Havanna empfangen, von dem guten alten Jussuf!“
Der Alte war immer noch wütend. „Zur Hölle mit ihm und seinen Nebelkrähen! Was stand in der Nachricht?“
„Arne hat sie noch selbst abgefaßt, bevor er an Bord der Schebecke in See gegangen ist!“ erklärte der Seewolf. „Er teilt uns darin lediglich mit, daß der Verband von zehn Schiffen ausgelaufen sei und daß die Schebecke ihm folge! Außerdem befindet sich der Gouverneur Don Antonio de Quintanilla an Bord des Flaggschiffes! Das ist alles, was wir wissen!“
„Das ist auch schon genug!“
„Wir haben Kriegsrat gehalten und sind mit den Schiffen ausgelaufen!“ fuhr Hasard unbeirrt fort. „Nur die ‚Wappen‘ unter dem Kommando von Renke Eggens liegt noch in der Bucht vor Anker!“
„Ein Fluchtmittel, wenn’s hart auf hart geht“, sagte der Alte brummig. „Eine gute Idee, obwohl wir alle nicht hoffen, daß es so weit kommt.“
„Donegal!“ rief Hasard. „Spaß beiseite – ich bin natürlich versessen darauf, nähere Einzelheiten zu erfahren! Ich muß unbedingt Genaueres über die Schebecke und Don Juans und Arnes Aktivitäten erfahren, verstehst du? Es könnte für unser weiteres Handeln von großer Bedeutung sein! Nur du kannst mir in allen Details berichten, wie es an Bord der Schebecke zugeht!“
„Du brauchst mir keinen Honig ums Maul zu schmieren!“ rief der Alte mit bitterböser Miene. Plötzlich hellte sie sich aber doch wieder auf. „Na ja, ich weiß natürlich genau Bescheid! Ein tolles Stück, diese Sache! Don Juan ist ja plötzlich wie umgewandelt!“
„Vielleicht ist es nur ein Trick von ihm!“ brüllte der Wikinger von Bord des Schwarzen Seglers herüber. „Sind wir sicher, daß er uns auf diese faule Art nicht reinlegen will?“
„Quark!“ schrie der Alte. Er war im Begriff, wieder fuchsteufelswild zu werden. „Wer hat dich überhaupt nach deiner Meinung gefragt, du Nordpol-Kannibale? Hölle, wenn ich einem Mann in die Augen sehe, weiß ich, was ich von ihm zu halten habe! Don Juan ist kein Schlitzohr! Der meint es ehrlich!“
„Wie hast du ihm mitten in der Nacht in die Augen sehen können?“ brüllte Thorfin Njal.
„Warum bist du nicht bei deiner Gotlinde geblieben?“ schrie der Alte. „Das wäre verdammt besser gewesen, für uns alle!“
„Auch Mary wartet auf dich!“
„Weißt du eigentlich, was du mich kannst?“
„Aufhören!“ rief der Seewolf. „Es hat wirklich keinen Sinn, daß ihr euch streitet! Donegal, du wolltest mir über Don Juans Gesinnungswandel erzählen!“
„Ich will es, aber ich werde dauernd unterbrochen!“ stieß der Alte hitzig hervor. Dann dachte er an die Begegnung mit der Schebecke zurück, und seine Züge glätteten sich wieder. „Also, wie gesagt, der Mann ist ganz anders, als wir ihn bisher gekannt haben, und ich wußte gar nicht, daß so ein guter Kern in ihm steckt. Ich meine – er könnte wirklich glatt einer von uns sein. Er paßt zu uns, kapiert?“ Er geriet jetzt fast ins Schwärmen. „Was für ein feiner Kerl das doch ist! Stellt euch vor – er hat, Bord an Bord, einen tüchtigen Schluck mit mir aus der Rumpulle getrunken! Ja, er kann mithalten, das schwöre ich euch!“
„Das hätte ich mir gleich denken können!“ rief Jean Ribault von Bord der „Le Vengeur III.“. „Kaum schickt man unseren Donegal mal allein los, nutzt er die Zeit, um Saufgelage abzuhalten! Sag mal, schämst du dich gar nicht, Donegal?“
„Hasard!“ schrie der Alte. „Warum schaffst du mir diese Bande nicht vom Hals?“
„Weil es sich um eine Flotte handelt!“
„Aber ich laß’ mich nicht anblöden!“
Der Seewolf wandte sich um und blickte zu den Schiffen. „Männer! Wir haben hier keine Zeit zu verlieren! Wer Donegal jetzt noch einmal unterbricht, der segelt zurück zur Schlangen-Insel, verstanden?“
Sie murmelten ihr „Aye, aye“ und steckten zurück, denn sie wußten, daß er es ernst meinte. Im übrigen war es ohnehin nicht ganz fair, Old O’Flynn ständig anzustänkern. Wie er Don Juan schilderte, war nämlich keineswegs eine Übertreibung. Er schätzte den Spanier völlig richtig ein, und er war stolz darauf, daß es Arne von Manteuffel gelungen war, einen solchen Kämpfer für den Bund der Korsaren gewonnen zu haben.
„Also, wo war ich stehengeblieben?“ fuhr er in seinem Bericht fort. „Richtig: Dieser Don Juan, das ist ein Kerl wie Samt und Seide, vom rechten Schrot und Korn! Den können wir brauchen! Und ich versichere euch, er ist voll auf die Seite des Bundes umgeschwenkt! Er hat jetzt keine Zweifel mehr! Er kämpft mit uns gegen den Verband – und das ist natürlich letztlich auf die Intrige des Gouverneurs zurückzuführen! Diese fette Qualle, dieser Don Antonio, hatte ihm einen Frauenmord anhängen wollen!“
„Und das ist ihm wohl auch gelungen, oder?“ rief Hasard.
„Ja! Don Juan ist jetzt ein Geächteter! So hat er den Weg zu Arne gefunden, und der hat ihm auch geholfen, die Crew der beschlagnahmten Schebecke aus der Gewalt der Schergen des Gouverneurs zu befreien und dann die Schebecke selbst im Hafen von Havanna zurückzuerobern!“
„Hochinteressant!“ feuerte Hasard den Alten an. „Weiter!“
„Nun, Arne hat Don Juan bei unserer Begegnung ja endgültig reinen Wein über alles eingeschenkt, was die Verwandtschaft mit dir betrifft und so. Auch die Zwillinge hat er ihm vorgestellt. Don Juan war ganz schön von den Socken.“
„Was ist weiter geschehen?“ wollte der Seewolf wissen.
„Wir haben uns wieder verabschiedet und sind noch in der Nacht ostwärts gesegelt, um euch den Anmarsch des Kampfverbandes zu melden“, erwiderte der Alte. „Hinter uns hat es ganz schön gekracht! Ein klares Zeichen dafür, daß Don Juan und Arne bereits voll eingestiegen sind!“ Plötzlich lachte er und rieb sich die Hände. „Fein, die Dons haben also die Schebecke am Hintern und werden sie nicht mehr los! Ich schätze, Don Juan und Arne spielen fleißig das bewährte Ruderanlagenzerschießen! Das wäre nämlich genau das, was ich an ihrer Stelle tun würde! Und Arne ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen! Oder? Leute, es geht rund, und auch wir gehen jetzt in die vollen, nicht wahr?“
„Wie darf ich das auffassen?“ fragte Hasard.
„Daß ich mit euch segle, ist doch klar!“
„Irrtum! Du kehrst zur Schlangen-Insel zurück!“
„Nein!“ brüllte der Alte, und seine Schläfenadern schwollen bereits wieder bedrohlich an. „Das kommt gar nicht in Frage! Was soll ich da? Die ‚Wappen‘ ist doch dort!“
Seine Einwände nutzten ihm nichts, bei Hasard biß er auf Granit. „Du segelst zur Schlangen-Insel!“ rief Hasard noch einmal. „Das ist ein Befehl! Du wirst nach Westen hin Aufklärung fahren – für den Fall, daß es einzelnen Schiffen des Gegners gelingen sollte, nach Osten durchzubrechen und Kurs auf die Schlangen-Insel zu nehmen!“
„Das schaffen die Hunde nie!“ brüllte der Alte.
„Das hab’ ich auch gesagt!“ pflichtete der Wikinger ihm mit Stentorstimme bei.
„Ruhe!“ schrie Hasard. „Wir müssen mit jedem Eventualfall rechnen, das habe ich schon mal gesagt! Wenn der Feind durchbricht, gilt es, die Schlangen-Insel so schnell wie möglich zu alarmieren! Keiner kann diesen Dienst besser versehen als du, Donegal, das mußt du einsehen! Und wenn du es nicht einsiehst, ist es mir auch egal!“
„Aye, Sir!“ rief der Alte, aber man sah ihm an, wie schwer es ihm fiel.
„Ich sage es euch noch mal klipp und klar!“ rief der Seewolf seinen Männern zu. „Bei dem Verhältnis von sechs Schiffen des Bundes gegen zehn spanische Kriegsschiffe ist durchaus damit zu rechnen, daß nicht alles so verläuft, wie wir uns das erhoffen! Wie ich die Dinge sehe, steht uns der härteste Kampf bevor, den wir jemals ausgefochten haben!“
„Wir haben schon ganz andere Schlachten geschlagen!“ rief Carberry aufgebracht. „Hast du das vergessen?“
„Nein! Aber es stand seinerzeit weniger auf dem Spiel!“
„Wir hauen die Dons in Stücke!“ brüllte Smoky. „Hölle, es wäre doch gelacht, wenn wir ihnen mit Höllenflaschen und Pulverpfeilen nicht Feuer unter dem Hintern machen würden!“
„Allein darauf dürfen wir uns nicht verlassen!“ schrie Hasard. „Wir müssen voraussetzen, daß sie gut armiert sind und jede Menge Munition an Bord haben! Wir wünschen uns, daß Don Juan und Arne so viele Galeonen und Karavellen wie möglich außer Gefecht setzen, aber wir wissen nicht, ob sie es schaffen! Wir dürfen auf keinen Fall etwas voraussetzen, von dem wir keine Bestätigung haben! Und noch etwas! Der Gegner könnte leicht Verstärkung aus einem der Häfen an der Nordküste von Kuba erhalten! Habt ihr an diese Möglichkeit schon gedacht? Stellt euch vor, der Kriegsverband verdoppelt sich! Was dann?“
„Hör bloß auf mit der Unkerei!“ brüllte Old O’Flynn.
„Das tust du doch sonst immer!“ rief Hasard ihm zu. „Aber diesmal gilt es, besonders vorsichtig zu sein! Nur das will ich euch klarmachen, sonst nichts! Donegal, ist dir etwas über die Black Queen bekannt?“
„Ja! Daß sie die größte Hurentochter und das ausgekochteste Höllenweib aller Zeiten ist!“
„Wo steckt sie zur Zeit?“
„Ich habe keine Ahnung“, erwiderte der Alte. „Aber ich drücke uns die Daumen, daß wir es rauskriegen! Und dann gnade Gott oder sonstwer diesem Satansbraten!“
Er wußte nicht, daß die Schebecke Don Juans den Zweimaster der Black Queen am Abend des 20. Juli zusammengeschossen und zum Sinken gebracht hatte – und auch nicht, daß die Schwarze mit ihrer Meute von Kerlen zuvor an dem Kampfverband der Spanier Fühlung gehalten hatte. Über diese Ereignisse war ihm nicht einmal in Ansätzen etwas bekannt – erst später sollte der Bund von dem Zweimaster und seinem Ende erfahren.
Der Seewolf hatte vorerst genug gehört, Old O’Flynn hatte nichts mehr zu berichten. Ernst verabschiedeten sich die Männer voneinander, und Hasard winkte noch zu seinen Söhnen hinüber. Dann ging die „Empress of Sea II.“ gemäß Hasards Order auf Ostkurs. Der Verband segelte weiter in Richtung Westen, einem Schwarm stolzer Schwäne gleich, deren Konturen im heraufziehenden Dämmerlicht verblaßten wie die Pinselstriche auf einem unfertigen Gemälde.
3.
Zur selben Zeit hockte ein gedemütigter, niedergeschlagener, ratloser Gouverneur Don Antonio de Quintanilla auf dem Rand der Koje in der Gästekammer des Achterkastells an Bord der „San José“. Das Flaggschiff des Kriegsverbandes war jetzt sein Gefängnis. Man hatte ihn unter Kammerarrest gestellt, und vor dem Schott stand ein bewaffneter Posten. Er war von seinen eigenen Landsleuten verdammt worden, war ihnen ausgeliefert und würde noch die Konsequenzen, einen Prozeß in Havanna oder anderswo, über sich ergehen lassen müssen.
Das Bordgericht der „San José“ hatte ihn unter Arrest gestellt, und Don Garcia Cubera, der Kapitän und Verbandsführer, hatte den Befehl sofort ausführen lassen. Nur zu gern, wie Don Antonio grimmig registrierte, und auch berechtigterweise mit Genugtuung, wenn man sachlich sein wollte, denn schließlich hatte man ihn töten wollen, und er war nur wie durch ein Wunder am Leben geblieben, weil zwei Männer der Kriegskaravelle „Gaviota“ ihn aus der See gefischt hatten.
Gomez Guevara – so hieß der verhinderte Meuchelmörder. Sein Messer hatte Cubera nur an der Schulter verletzt, und es war ihm letztlich zum Verhängnis geworden, denn der Erste Offizier der „San José“ hatte es nach der Tat auf den Planken des Achterdecks gefunden. Das Beweisstück hatte den Kerl überführt und zum Geständnis gezwungen. Er war gehängt, wieder von der Rah geschnitten und ohne Leichenrede in die See geworfen worden, wie es jedem Mörder oder versuchten Mörder gebührte.
Don Antonio erschauerte unwillkürlich, als er daran dachte. Immer wieder wurde er daran erinnert. Er konnte nicht mehr schlafen, und er wußte nicht, ob er sitzen oder stehen sollte. Er glaubte, seine eigene Angst zu riechen. Seine dicken, beringten Finger tasteten nach dem fetten Hals, und für einen winzigen Augenblick hatte er das Gefühl, auch um seine Kehle schnüre sich bereits die tödliche Schlinge zusammen.
Gewiß, seine Mittäterschaft hatte sich nicht nachweisen lassen. Dennoch: Guevara hatte ihn schwer belastet. Guevara war sein Kammerdiener gewesen, und es lag auf der Hand, daß er, Don Antonio, den Mordauftrag erteilt hatte.
Natürlich stritt er alles ab, und so stand Aussage gegen Aussage. Das Bordgericht konnte ihm also nichts anhängen. Aber Cubera würde ihn vor ein Gericht des Königs stellen, und der Prozeß würde keine Farce sein wie viele Verhandlungen, die in der Residenz von Havanna stattgefunden hatten, wenn es Don Antonio darum gegangen war, sich lästiger, aufmüpfiger oder unbequemer Zeitgenossen zu entledigen. Cubera war vorgewarnt und wußte, daß sich der dicke Mann wie ein Aal wand. Ein neutrales, unbestechliches Gericht mußte zusammentreten – und er würde dafür sorgen, daß es einen gerechten und unantastbaren Schuldspruch gab.
Don Antonio war davon überzeugt, daß ihm das gelang. Noch einmal hatte er das Verhängnis abwenden können, aber jeder Mann an Bord war davon überzeugt, daß er, der Gouverneur, dem Kommandanten nach dem Leben getrachtet hatte. Gründe für ein solches Handeln gab es genug, und auch die Tatsache, daß Guevara Cubera angegriffen und außenbords geworfen hatte, sprach für sich.
Was also tun? Fliehen? Don Antonio schauderte allein bei dem Gedanken daran zusammen. Schwimmen konnte er nicht. Ein Boot konnte er nicht entwenden, außerdem wußte er nicht, wie er es fortbewegen sollte, wenn es erst einmal im Wasser lag. Segel, Riemen – all das waren ihm widerwärtige Begriffe, er wollte mit der Seefahrt nichts zu tun haben. Und wie sollte er im übrigen auch den Wachtposten überwältigen?
Er saß in der Falle, es gab keinen Fluchtweg. Diese Erkenntnis machte ihn regelrecht krank, und auch der süße Portwein half ihm nicht über seinen Kummer weg. Die kandierten Früchte schmeckten ihm auch nicht mehr, aber er stopfte sie sich trotzdem ununterbrochen in den Mund. Irgend etwas mußte er tun, sonst wurde er noch wahnsinnig.
Dabei hatte alles so schön begonnen. Don Antonio war als sicherer Sieger an Bord des Flaggschiffes gegangen und hatte alle Privilegien für sich beansprucht, von der Kapitänskammer bis zum Waschzuber, der eigens für ihn hatte beschafft werden müssen. Nicht den geringsten Zweifel hatte er daran gehegt, daß alles nach seiner Pfeife tanzte, daß das Gefecht gegen die Engländer mit einem glorreichen Sieg für die spanische. Krone endete und daß er, Don Antonio, sämtliche Schätze der englischen Hundesöhne geflissentlich vereinnahmen würde. Das waren seine Pläne – und nur deshalb hatte er sich entschlossen, mitzusegeln.
Aber das Leben war voller Ecken und Kanten, und er bereute zutiefst seinen Entschluß, die Residenz verlassen zu haben. Jetzt konnte er nicht mehr zurück, und er hatte alle gegen sich.
Ausgerechnet auf einen Mann wie diesen Cubera hatte er stoßen müssen, der hart wie Eisen und unbeugsam war. Jeder Versuch Don Antonios, den Befehl über den Verband an sich zu reißen, war auf den erbitterten Widerstand dieses Kommandanten gestoßen, der sich nur seiner Obrigkeit, der Admiralität, verpflichtet fühlte und sonst niemand anderem Rechenschaft ablegte.
An einem gewissen Punkt des Kriegsmarsches auf die Schlangen-Insel angelangt, hatte Don Antonio den Verdacht zu hegen begonnen, die Black Queen habe ihn in eine Falle gelockt oder wolle ihm einen üblen Streich spielen. Denn was hatten die nächtlichen Angriffe auf den Verband zu bedeuten, bei dem nun schon mehrere Schiffe Schaden erlitten hatten?
Der Verdacht hatte Angst hervorgerufen, und Don Antonio hatte Don Garcia Cubera gedrängt, umzukehren und nach Havanna zurückzusegeln. Doch auch in diesem Punkt blieb der Kommandant stur: Er behielt seinen Kurs bei und war mehr denn je davon überzeugt und darauf bedacht, den Angriff auf die englischen Piraten durchzuführen.
Es war ein altes Prinzip von Don Antonio de Quintanilla, daß ein Mann so rasch wie möglich verschwinden mußte, wenn er unbequem zu werden begann. Viele Männer hatten im Laufe der Jahre, die er seinen Posten als Gouverneur versah, die Residenz von Havanna betreten und nie wieder verlassen, höchstens mit den Füßen zuerst. Im Kerker hatte er so manchen Gegner weichgeklopft, und unter den Qualen des peinlichen Verhörs waren auch die härtesten Kerle lammfromm geworden. Hatte ein Mann dann seine Geheimnisse preisgegeben – welcher Art sie auch immer sein mochten –, konnte er getrost den Weg ins Jenseits nehmen. Starb er nicht an den Folgen der Folter, half Don Antonio gern mit einer Prise Gift nach.
Aber nicht nur im Kerker, auch in den prunkvollen Sälen und Gemächern seines Allerheiligsten hatten schon Männer ihr Leben gelassen. Zuletzt Don Ruiz de Retortilla, der Stadtkommandant von Havanna.
Don Antonio verzog das Gesicht, wenn er an ihn zurückdachte. Dieser Narr, dachte er. Er hatte versucht, seinem Gouverneur zu drohen und ihn zu erpressen. Er hatte sich dadurch sein eigenes Grab geschaufelt.
Don Juan de Alcazar hatte einen ähnlichen Weg gehen sollen. Er war, so hatte Don Antonio es dargestellt, der Mörder der Señora Samanta de Azorin. Daß in Wirklichkeit ein gedungener Mörder des Don Antonio und Don Ruiz die Señora auf dem Gewissen hatten, wußte niemand.
Aber Don Juan war geflohen, und seitdem wußte kein Mensch mehr, wo er sich versteckt hielt. Don Antonio gab sich Mühe, nicht mehr an ihn zu denken, aber gerade durch Cubera wurde er immer wieder an diesen hartnäckigen und unbestechlichen Mann erinnert, der seine Prinzipien vor alles andere setzte. Auch Cubera war so ein Mensch, der Kühnheit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und den Kampf fürs Vaterland an die Stelle persönlicher Interessen stellte.
Zum Teufel, der ist imstande und läßt sich für die Krone töten, dachte Don Antonio. Unbegreiflich! In seinen Augen waren solche Männer Narren oder Idioten, denn sie brachten es im Leben zu nichts, höchstens zu einem Orden, den sie mit ins Grab nehmen konnten.
Doch man mußte das Leben genießen. Genuß war nur durch Reichtum gesichert, und reich wurde man weder durch Prinzipien noch durch Heldenmut. Spanien hatte Gold und Silber im Überfluß – warum also nicht wenigstens einen Teil davon für den Gouverneurspalast von Havanna beiseite schaffen?
Don Antonio hatte es getan. Er lebte im Luxus und verfuhr nach einem einfachen Grundsatz: Was dein ist, ist auch mein, und was mein ist, bleibt mein.
Reichtum und Besitz – und all das sollte durch einen fanatischen Capitán namens Cubera aufs Spiel gesetzt werden? Nein, auf gar keinen Fall durfte er sich geschlagen geben. Er mußte reagieren und sich zur Wehr setzen. Wenn er Cubera nicht beseitigen konnte, mußte es einen anderen Weg geben, sich zu befreien und für den nötigen Respekt seitens des Achterdecks zu sorgen. Er, Don Antonio, beging einen gewaltigen Fehler, wenn er sich jetzt von seiner Niedergeschlagenheit und seinem Selbstmitleid übermannen ließ.
Was sollte er unternehmen? Er verlieh sich einen innerlichen Ruck und zwang sich dazu, angestrengt nachzugrübeln. Wieder verschwanden drei, vier kandierte Früchte in seinem Mund, und er spülte kräftig mit Portwein nach.
Plötzlich fiel ihm etwas ein. Hatte er nicht eine Waffe in seinem Gepäck? Hatte er kurz vor dem Verlassen der Residenz nicht ausdrücklich befohlen, auch eine Pistole in seinen Sachen zu verstauen, damit er, der Hochwohlgeborene und Erlauchte, im Falle höchster Gefahr nicht ganz wehrlos dastand?
Er wollte bereits zu dem Glöckchen greifen, mit dem er seine Dienerschaft herbeizuklingeln pflegte, zog die Hand aber rechtzeitig genug wieder zurück. Guevara, sein Kammerdiener, war ja nicht mehr am Leben. Benachrichtigte er die übrigen Lakaien, schöpfte die Wache selbstverständlich Verdacht.
Es gab nur den einen Weg: Er mußte selbst suchen. Aber das war mit Arbeit verbunden. Mühsam erhob er sich, kippte auf den leicht schwankenden Planken fast um, hielt sich an der Koje fest und ließ sich auf die Knie sinken. Er begann, in seinen Gepäckstücken herumzukramen, aber die Suche brachte nicht den gewünschten Erfolg.
Mit einemmal war er nicht mehr sicher. Hatte er nun eine Pistole, oder hatte er sie nicht? Oder hatte Cubera heimlich seine Kammer durchsuchen lassen? Auch das war möglich. Überhaupt, auf diesem Teufelsschiff waren sie zu jeder Schandtat fähig.
Erschöpft ließ sich Don Antonio auf die Koje sinken. Er mußte Kräfte sammeln. Wenn er schon nicht schlafen konnte, dann wollte er doch wenigstens ein bißchen ruhen. Und mit der Zeit kam auch der erforderliche Rat. Vielleicht, dachte er und gähnte, suche ich nachher weiter. Vielleicht ist das Glück mir armem Teufel doch noch hold.
Der spanische Kampfverband lag in den Nachtstunden des neuen Tages, des 21. Juli also, nach dem Schebecken-Angriff wieder vor Treibanker im Nicolas-Kanal. Die beschädigte Ruderanlage der einen Kriegskaravelle mußte repariert werden, wie verrückt war das Schiff nach der Attacke in den Wind geschossen. Ebenso war es einer anderen Karavelle, der „Gaviota“, ergangen. Sie war sogar derart stark ramponiert, daß sie mit einem Notruder den nächsten Hafen anlaufen mußte.
Das war Remedios an der Nordküste von Kuba. Don Garcia Cubera hatte dem Kapitän der „Gaviota“ den offiziellen Befehl erteilt, den Hafen anzulaufen und dort ins Dock zu gehen. Die „Gaviota“ schied somit aus der Unternehmung aus, hatte jedoch den Auftrag, eventuelle in Remedios liegende spanische Kriegsschiffe über den Raid gegen die englischen Piraten zu informieren und um Unterstützung zu bitten.
Der Verband – so hatte Don Garcia Cubera dem Kapitän der „Gaviota“ mitgeteilt – würde den ganzen 21. Juli über noch vor Treibanker liegen und erst am Abend mit Kurs Osten zum Süden weiter an der Küste entlangsegeln, so daß man sich auf der Höhe von Remedios treffen konnte.
Aufgrund der bösen Erfahrungen der beiden letzten Nächte und der Gewißheit, daß zumindest zwei Gegner bereits gegen den Verband kämpften, ließ Cubera auch in dieser Nacht die Jollen der einzelnen Schiffe ausschwärmen, um den Verband nach allen Seiten hin gegen etwaige neue Angriffe abzuschirmen. Immerhin war sein Verband zur Zeit um zwei Schiffe vermindert: Eine Kriegskaravelle war aus bisher noch ungeklärten Gründen gesunken, und man hatte nur Trümmerteile westlich der Cay-Sal-Bank gefunden. Das zweite Schiff war die „Gaviota“, die jetzt mit schwerstem Ruderschaden nach Remedios verholen mußte.
Don Garcia Cubera stand auf dem Achterdeck der „San José“ und dachte erneut über die bisherigen Ereignisse nach. Vieles war ihm rätselhaft, aber folgende Punkte hatte er doch recherchieren können: Bei den beiden bisher festgestellten Gegnern handelte es sich – aus seiner Sicht – um einen Zweimaster, der laut Bericht der Jollenführer, die sich bereits mit der Besatzung dieses Schiffes herumgeschlagen hatten, von einer Negerin kommandiert wurde und mit dunkelhäutigen Männern besetzt sein sollte.
Ob das wirklich stimmte? Cubera sah keinen Grund, an den Darstellungen seiner Leute zu zweifeln. Gewiß, es gab einige unter ihnen, die vieles übertrieben und besonders farbig ausgeschmückt wiedergaben. Doch die Jollenführer waren nüchterne, salzgewässerte Männer, die aufmerksam zu beobachten verstanden und nicht unter Einbildungen litten. Sie hatten von einem „Negerweib“ gesprochen, und sie täuschten sich gewiß nicht.
Farbige also, die sich von einer Frau kommandieren ließen. Was für eine Bande war das? Nun, er würde es durch zähe Nachforschungen vielleicht doch noch herausfinden.
Bei dem anderen Gegner sollte es sich um die Schebecke des Don Juan de Alcazar handeln. Der Kapitän der „Gaviota“ hatte sie deutlich gesehen, und er hatte seinem Kommandanten gegenüber noch nie etwas behauptet, das er nicht belegen konnte. Bei ihrem nächtlichen Angriff hatte er sie zweifelsfrei identifiziert.
Cubera begriff die Zusammenhänge nicht. Die Schebecke war eine Prise des Don Juan de Alcazar, er hatte sie in den Hafen von Havanna überführt und dort vor Anker gehen lassen. Aber – sie war von den Soldaten des Gouverneurs unter Befehl des dann so plötzlich verstorbenen Stadtkommandanten Don Ruiz de Retortilla beschlagnahmt worden, soweit sich Cubera entsinnen konnte. Die kleine Mannschaft war ins Gefängnis geworfen worden, ganz abgesehen von der Ungeheuerlichkeit, daß ausgerechnet der Mann eine Frau ermordet haben sollte, der von der spanischen Krone beauftragt worden war, den englischen Kapitän Killigrew zur Strecke zu bringen. Don Juan ein Mörder – stimmte das denn wirklich?
Das alles war höchst verwirrend und stand nicht miteinander in Einklang. Don Garcia Cubera fuhr sich mit der Hand übers Kinn und dachte angestrengt nach. Er wägte dieses und jenes ab und stellte verschiedene Theorien auf. Wenn sich Don Juan de Alcazar wieder in den Besitz der Schebecke gebracht hatte, warum bekämpfte er dann die eigenen spanischen Schiffe, die jetzt gegen jenen Feind segelten, den er doch eigentlich vernichten sollte?
Cubera gelangte in dieser Nacht nicht zur Ruhe, denn natürlich beschäftigte ihn gleichzeitig auch der Gedanke an den Mordversuch, der an ihm vorgenommen worden war. Gomez Guevara, der Täter, war vom Bordgericht überführt worden. Und er hatte auch gestanden. Aber er hatte behauptet, von dem Gouverneur zu der Tat angestiftet worden zu sein. War es die Wahrheit?
Don Antonio de Quintanilla hatte jede Anschuldigung heftig abgestritten und den verhinderten Mörder einen Schurken und Lügner genannt. Dabei handelte es sich bei dem Mann um seinen eigenen Kammerdiener, um eine Vertrauensperson also, die niemals in seinen Diensten hätte stehen können, wenn sie wirklich so verschlagen und unehrlich gewesen wäre, wie Don Antonio sie hingestellt hatte.
Don Antonios Auftreten während der Verhandlung hatte Cubera eigentlich nur noch in seiner bisherigen Annahme bestätigt und bestärkt: daß nämlich der eigentliche Schuldige der Gouverneur war. Nur beweisen konnte er es nicht. Guevara hatte für sein Verbrechen mit dem Tod bezahlt. Don Antonio stand unter Kammerarrest, und daran würde sich auch nichts ändern. Später sollte er, seinem Rang als Gouverneur entsprechend, vor ein Gericht des Königs in Havanna gestellt werden.
Da war tatsächlich einiges zu klären und zu untersuchen – zum Beispiel der Versuch des Gouverneurs, ihm, dem Kapitän, die Kommandogewalt über den Verband zu entziehen. Oder sein plötzlicher Entschluß, das Unternehmen gegen die Engländer wieder abzublasen. Und wenn Cubera daran dachte, wie der Dicke sich an Bord der „San José“ aufgeführt hatte, stieg ihm sowieso nachträglich die Galle hoch.
Eine Kriegsgaleone war kein Lustfahrzeug zur Erbauung eines Gouverneurs der spanischen Krone. O nein! Hier wurde ein harter Dienst versehen, unter der permanenten Bedrohung eines unbekannten Gegners, der nachts tollkühn und mit offensichtlichem Erfolg angriff. Was sollten die Allüren eines Don Antonio, was bezweckte er mit seinem ganzen unhaltbaren Auftreten?
Don Garcia Cubera folgte einem plötzlichen Entschluß – oder sollte er ihn lieber eine Eingebung nennen? Irgendwie hatte er das Gefühl, er könne die wahren Hintergründe noch erfahren – jetzt. Alles würde sich aufklären, man mußte nur den entsprechenden Schlüssel in der Hand haben.
Er verließ das Achterdeck der „San José“. Der Erste Offizier übernahm solange das Kommando. Cubera begab sich ins Achterkastell und suchte Don Antonio de Quintanilla auf, vor dessen Kammer wie üblich ein Posten Wache stand. Er bedeutete dem Mann, zur Seite zu treten, und öffnete das Schott.
Mit grimmiger Genugtuung stellte Cubera fest, daß auch dem Gouverneur der Schlaf abging. Er hockte auf seiner Koje und hielt einen Kelch in der rechten Hand, der zur Hälfte mit schwerem Portwein gefüllt war. Mit der Linken schob er sich nahezu ununterbrochen die kandierten Früchte in den Mund, die Cuberas Widerwillen hervorriefen. Überhaupt, er verspürte fast Ekel, wenn er sah, wie Don Antonio aß und mit Portwein nachspülte. Nie zuvor hatte er einen Mann gesehen, der derart viele Süßigkeiten in, sich hineinzustopfen vermochte.
Don Antonio ähnelte zur Zeit einer in die Enge getriebenen, allerdings sehr fetten Ratte. Dieser Vergleich drängte sich Cubera auf, als er in die Kammer trat und das Schott hinter sich schloß.
Don Antonio sah zu ihm auf. Sofort schien er zu begreifen, daß der Capitán etwas von ihm wollte, und entsprechend fiel seine Reaktion aus. Sofort richtete er sich auf, und seine alte Überheblichkeit war wieder da.
„Capitán, was fällt Ihnen ein, mein Schlafgemach zu betreten, ohne vorher anzuklopfen?“ fragte er scharf.
„Sie befinden sich an Bord eines Kriegsschiffes.“
„Oh, das hatte ich noch nicht bemerkt.“
„Auf diesem Schiff führe ich den Befehl, und meine Befehlsgewalt ist uneingeschränkt“, fuhr Cubera unbeirrt fort. „Ich bitte Sie, das endlich zur Kenntnis zu nehmen, Señor.“
Don Antonios Gesicht nahm einen tückischen Ausdruck an. „Sie haben es mir deutlich genug zu verstehen gegeben, Capitán, auf jede erdenkliche Art.“ Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, seine Stimme hob sich etwas. „Aber das werden Sie noch schwer und bitter bereuen.“
„Das glaube ich allerdings nicht, Señor“, sagte Cubera kalt. „Und ich bin auch nicht gekommen, um darüber mit Ihnen zu diskutieren.“
„Sie werden es aber tun müssen!“ fuhr der Dicke ihn an. „Das ist der Gipfel all dessen, was Sie sich mir gegenüber erlaubt haben! Daß Sie es gewagt haben, mich, den Gouverneur, einen Vertreter der spanischen Krone, unter derart entwürdigenden Umständen vor ein Bordgericht zu zerren! Einen Gouverneur vor ein Bordgericht! Das muß man sich mal vorstellen!“
„Sie haben es sich selbst zuzuschreiben“, sagte Cubera. „Und Sie können noch froh sein, daß Sie einigermaßen glimpflich davongekommen sind.“
„So?“ Don Antonio lachte höhnisch auf. „Das alles ist so absurd, als erlaubten sich irgendwelche dahergelaufenen Bauerntrampel, über Seine Majestät, den König von Spanien, zu Gericht zu sitzen. Unvorstellbar! Wahnwitzig! Verrückt!“
„An Bord eines Kriegsschiffes ist der Kommandant König“, sagte Cubera scharf. „Wer das nicht weiß, sollte besser an Land bleiben und dort seinen Amtsgeschäften nachgehen, wie es sich gehört – statt auf einem Kriegsschiff Seiner Majestät Unheil zu stiften und es offenbar mit dem Gouverneursamt zu verwechseln.“
„Was nehmen Sie sich eigentlich noch alles heraus?“
„Señor, ich warne Sie“, sagte Cubera. „Lassen Sie es nicht an dem nötigen Respekt mangeln, sonst lernen Sie mich von einer Seite kennen, die ich Ihnen bisher noch vorenthalten habe. Es könnte leicht passieren, daß Sie Ihre bisherige Kammer mit dem Kabelgatt oder der Vorpiek vertauschen, wenn Sie wieder unverschämt werden.“
Don Antonio steckte zurück. Von der Seefahrt hatte er kaum Ahnung, doch was das Kabelgatt und die Vorpiek waren, wußte auch er. Er durfte Don Garcia Cubera nicht bis aufs Blut reizen, sonst war der tatsächlich imstande, ihn in ein feuchtes, rattenverseuchtes Schiffsverlies zu stecken.
In seinem aufgedunsenen Gesicht zuckte es heftig, aber er wagte nicht mehr aufzubegehren.
„Was führt Sie zu mir?“ fragte er.
„Ich wünsche eine klare Auskunft über die Mordgeschichte, in die Don Juan de Alcazar angeblich verwickelt ist.“
„Wie bitte? Was geht denn Sie das an?“
„Eine ganze Menge, und ich kann Ihnen nur raten, mir alles zu erzählen, was Ihnen über den Fall bekannt ist.“
„Soll das eine Drohung sein?“ fragte Don Antonio mit schriller Stimme. „Nötigung?“
Cubera zwang sich zur Ruhe. „Nein. Keineswegs. Ich trage nur Fakten und Daten zusammen, um mir ein Bild von der Gesamtlage zu verschaffen. Warum, das setze ich Ihnen gleich noch auseinander. Aber vorher bitte ich Sie um klare Antworten. Don Juan ist doch angeblich ein Frauenmörder, nicht wahr?“
Jetzt fuhr der Dicke von seiner Koje hoch. „Angeblich? Das wird ja immer schöner! Es gibt Augenzeugen für die Tat – Leute, die gesehen haben, wie der Kerl die Señora de Azorin ermordet hat!“
„Und seitdem ist er verschwunden?“
„Ja! Seine sofortige Flucht nach der Tat beweist seine Mordschuld sogar zusätzlich! Leuchtet Ihnen das ein?“
„Noch nicht ganz.“
„So? Das ist mir auch egal. Sie stehen ja sowieso nicht auf meiner Seite, sondern sind gegen mich.“
„Hören Sie mit der Polemik auf“, sagte Cubera. „Eine andere Frage: Warum hat man die Schebecke beschlagnahmt, die im Hafen von Havanna geankert hat? Und warum wurde die Besatzung ins Gefängnis gesperrt?“
„Sie unterziehen mich also einem Verhör?“
„Herrgott, nein. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie mir antworten oder nicht.“
Don Antonio schien angestrengt nachzudenken. Er ließ seinen Besucher stehen und bot ihm keinen Platz an, auch kein Glas Portwein oder kandierte Früchte – die Cubera ohnehin abgelehnt hätte. Die Atmosphäre hätte nicht frostiger sein können, und sie gaben sich keinerlei Mühe, ihre beiderseitige Abneigung zu verbergen.
„Gut“, sagte Don Antonio schließlich. „Ich will Sie zufriedenstellen. Ich habe nach Don Juans Flucht sofort die Möglichkeit einkalkuliert, daß er versuchen könne, mit der Schebecke zu fliehen, die ja eine Prise von ihm war. Weiterhin war damit zu rechnen, daß seine kleine Mannschaft zu ihm hielt. Also habe ich entsprechende Vorsorge getroffen. Oder was hätten Sie an meiner Stelle getan?“
„Lassen wir das einmal dahingestellt“, entgegnete Cubera. Trocken fuhr er fort: „Im übrigen scheint Don Juan wider Erwarten größten Erfolg gehabt zu haben.“
„Wie meinen Sie das?“ fragte Don Antonio, und jäh erwachte Mißtrauen in ihm. Was wollte der Capitán? Ihn zum Narren halten? Ihn auf die Probe stellen? Was wußte er über Don Juan? Mehr als er? „Wie soll ich das verstehen?“ stieß er hervor.
„Es ist eindeutig die Schebecke Don Juan de Alcazars gewesen, die um Mitternacht die Ruderanlagen der beiden letzten Schiffe des Verbandes zerschossen hat.“ Cubera wartete nach diesen Worten ab und beobachtete, welche Wirkung sie auf den Dicken hatten. Es entging ihm nicht, wie dieser kaum merklich zusammenzuckte.
Don Antonio griff nach seinem Glas, füllte es mit Portwein und führte es an die Lippen. Er trank einen Schluck, verschluckte sich und begann zu husten und zu röcheln. Er lief dunkelrot im Gesicht an und schien keine Luft mehr zu bekommen, aber Cubera dachte nicht daran, ihm hilfreich auf den Rücken zu klopfen.
Völlig ungerührt stand er da und betrachtete sein Gegenüber. Don Antonios Getue und Gehabe vermochte ihn nicht im geringsten zu beeindrucken.
Don Antonio ließ das Glas wieder sinken, und fast verschüttete er dabei den Rest des Inhalts. Er keuchte und schöpfte japsend Atem, dann ließ er sich wieder auf den Rand seiner Koje sinken.
„Was erregt Sie eigentlich so?“ fragte Cubera.
„Ach, es ist nichts.“
„Vielleicht ist es doch besser, wenn Sie endlich mit der Wahrheit herausrücken. Denn daß hier einiges faul ist, habe ich längst begriffen.“
„Faul? Ich verstehe Sie nicht.“
„Das ist nicht weiter schlimm“, sagte Cubera gelassen. „Ich bin aber sehr gespannt darauf, die volle Wahrheit über Don Juan zu erfahren.“
„Gut, die sollen Sie wissen“, sagte Don Antonio, und er keuchte immer noch. „Dieser Frauenmörder ist ein Verrückter, ein Lustmörder und Sittenstrolch, dem es offenbar gelungen ist, mit der Schebecke aus Havanna zu fliehen.“
„Ja, das ist offensichtlich.“
„Und jetzt?“ stieß Don Antonio mit schriller, kreischender Stimme hervor. „Jetzt fällt er in seiner Mordlust auch noch über die eigenen Schiffe her, über die Schiffe Seiner Majestät!“
„Eben“, sagte Cubera in aller Ruhe und verschränkte die Arme vor der Brust. „Genau das will mir nicht in den Kopf. Es leuchtet mir einfach nicht ein. Nie wäre ein Mann wie Don Juan zu so etwas fähig.“
„Kennen Sie ihn denn?“
„Nur flüchtig, aber …“
„Er zeigt jetzt sein wahres Gesicht“, unterbrach ihn der Dicke. „Oder er hat total den Verstand verloren. Eins von beiden.“
Cubera fixierte ihn kühl. „Das glaube ich Ihnen nicht, Señor Gouverneur.“
4.
„Etwas anderes habe ich auch nicht erwartet“, sagte Don Antonio. Nur mühsam beherrschte er seine aufwallenden Haß- und Zorngefühle. „Warum reden wir überhaupt miteinander? Wenn Sie mich für einen Lügner halten, brauchen Sie mich ja gar nicht erst zu vernehmen, oder?“
Unbeirrt sagte Cubera: „Don Juan steht im Range eines Generalkapitäns, außerdem ist er Sonderagent der spanischen Krone. Wie können Sie im Ernst behaupten, daß ein solcher Mann ein Verbrecher oder Geistesgestörter ist?“
„Ich berufe mich nur auf die Tatsachen.“
„Es ist auch allgemein bekannt, daß sich Don Juan bravourös geschlagen hat, als die Horde eines gewissen Catalina über Havanna hergefallen ist.“ Fast süffisant fügte Cubera hinzu: „Einen solchen Mann kann ich mir schlecht als Frauenmörder vorstellen, als Lustmörder und Sittenstrolch schon gar nicht.“
Don Antonio blickte ihn an und wünschte sich, etwas Gift zur Verfügung zu haben, das er ihm heimlich in den Portwein streuen konnte. Aber dummerweise hatte er seine sämtlichen Vorräte in Havanna zurückgelassen. Außerdem trank der Capitán gewiß keinen Portwein, und er hätte bei einem so plötzlichen Ausbruch von Gastfreundschaft auch sofort Verdacht geschöpft.
„Mit der Mordlust, über die eigenen Schiffe herzufallen, scheint auch etwas nicht zu stimmen“, fuhr Cubera fort. „Denn es verwundert mich wirklich sehr, daß bei dieser Mordlust stets nur in die Ruderanlagen geschossen wird, wobei noch kein einziger Mann getötet worden ist.“
„Das sind alles nur Zufälle“, sagte der Dicke. „Beim nächstenmal schon kann es ein Massaker geben. Don Juan ist zu allem fähig. Aber, ach, Sie nehmen mir das ja doch nicht ab.“
Cubera musterte ihn verächtlich von oben bis unten. „Nach meiner Ansicht deuten diese Angriffe vielmehr darauf hin, daß mit allen Mitteln versucht wird, möglichst viele Schiffe des Verbandes außer Gefecht zu setzen und auf diese Weise zur Umkehr zu zwingen.“
„So?“ Don Antonio horchte auf. Was sagte der Mann da? Natürlich – Don Juan de Alcazar wollte, aus welchen Gründen auch immer, das Unternehmen sabotieren. War das für ihn, Don Antonio, nicht ein Vorteil? Er konnte seine Taktik darauf einstellen. Sofort nahm er die einmalige Chance wahr. „Daran habe ich noch gar nicht gedacht“, erklärte er mit lauernder Miene. „Aber ich schätze, Sie haben wirklich recht, Señor. Ich meine – wenn ich so richtig darüber nachdenke, muß ich Ihre Theorie sogar unterstützen. Nur bin ich bislang nicht darauf gekommen.“
„So ein Pech“, sagte Cubera. „Sie hätten mich sonst schon eher auf die Absichten des Don Juan hinweisen können.“
„Ich wußte ja nicht, daß er uns folgt. Aber Sie entsinnen sich, daß auch ich genau das im Sinn gehabt habe – daß der Verband umkehrt. Sehen Sie, es scheint also gar nicht so falsch und abwegig zu sein, das, Unternehmen abzubrechen.“
„Ich kann mich sehr gut an jedes einzelne Ihrer Worte erinnern“, sagte Don Garcia Cubera sarkastisch. „Aber Sie kennen mich immer noch nicht richtig. Gerade das werde ich nicht tun. Wir segeln auf dem bisherigen Kurs weiter.“
„Vielleicht kostet das unser aller Leben.“ Don Antonio spürte bei dem Gedanken an die bevorstehende Schlacht wieder die Angst in sich aufflackern, die stärker war als die Gier nach Gold und Silber. Natürlich würde dieser Fanatiker Cubera mit seinem Flaggschiff auch in erster Linie kämpfen und sich nicht zurückhalten, wie Don Antonio es getan hätte, wenn der Verband seinem Kommando unterstanden hätte. Es wurde also höchst brenzlig, und das Risiko, nie mehr nach Havanna zurückzukehren, war hoch.
„Ich fühle mich herausgefordert“, sagte Cubera. „Und als spanischer Seeoffizier bin ich gewohnt, eine einmal angefangene Angriffsoperation auch durchzuschlagen. Letztlich geht es ja auch um einen Gegner, der Spanien seit Jahren unermeßlichen Schaden zugefügt hat. Eine Umkehr ist völlig undiskutabel.“
„Aber – versuchen Sie doch, vernünftig zu denken!“ stieß Don Antonio flehend hervor.
„Das tue ich. Sie haben das Unternehmen gewollt und in Gang gesetzt. Und jetzt werden Sie dabeisein, wenn wir es durchführen.“ Mit diesen Worten vollführte er eine kühle Verbeugung und verließ die Kammer, in der man die Angst riechen konnte. Voller Abscheu verzog er den Mund, als er draußen war und den Gang zum Querschott entlangschritt. Mehr denn je war er davon überzeugt, daß es richtig war, durchzuhalten und bis zur äußersten Konsequenz zu gehen. Für Don Antonio de Quintanilla würde es im übrigen die Lektion seines Lebens sein. Er hatte sie verdient.
Don Juan de Alcazar stand mit seiner Schebecke um diese Zeit bereits wieder auf der Luvseite des Verbandes, also nördlich von ihm und aufgrund der nächtlichen Lichtverhältnisse im dunklen Sektor, der das Schiff hervorragend tarnte.
Der Verband hingegen war klar zu erkennen. Schweigend beobachteten die Männer der Schebecke, was geschah. Es war ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen, daß die eine von ihnen angegriffene Kriegskaravelle nach einer gewissen Zeit – offenbar unter Notruder – mit Kurs auf die Küste im Süden davongekrochen war, während das Achterschiff des anderen Opfers hell erleuchtet war.
„Sie arbeiten daran, den Ruderschaden zu beheben“, sagte Don Juan. „Gut so. Das gibt wieder eine Verzögerung.“
„Der ganze Verband liegt vor Treibanker“, sagte Arne von Manteuffel. „Aber natürlich trifft der Verbandsführer jetzt auch einige Sicherheitsvorkehrungen, um die Schiffe abzuschirmen.“
Ramón Vigil bestätigte dies durch ein Kopfnicken. Fast unausgesetzt hatte er durch sein Spektiv geblickt und zu verfolgen versucht, was sich an Bord der spanischen Schiffe tat.
„Sie haben die Jollen ausgesetzt und um den Verband verteilt“, sagte er.
„Also Wachboote, die auf und ab patrouillieren“, sagte José Buarcos. „Außerdem dürfte damit zu rechnen sein, daß sie auch an Bord der Schiffe auf der Hut sind.“