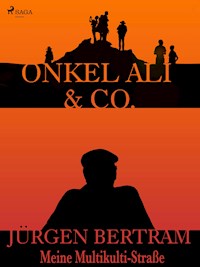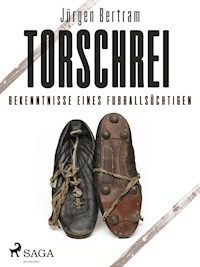Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dreieinhalb Monate, 14 000 Kilometer, unzählige Gespräche zwischen Darwin, Perth und Adelaide. Über dreißig Auswanderer-Geschichten sammelte das Hamburger Journalistenpaar Helga und Jürgen Bertram auf seiner Reise durch Australien. Eine Geschichte von der Sehnsucht nach Aufstieg, Freiheit und Wärme. AUTORENPORTRÄT Jürgen Bertram, Jahrgang 1940, war SPIEGEL-Redakteur und arbeitete für das Fernsehmagazin "Panorama". Als langjähriger Auslandskorrespondent leitete er u.a. die ARD-Büros in Singapur und Peking. Er ist Autor zahlreicher Bücher. Helga Bertram, Jahrgang 1942, war, bevor sie mit ihrem Mann für 13 Jahre nach Asien ging, als Redakteurin für die "Hannoversche Presse" und für Zeitschriften ("Constanze", "Fernsehwoche", "Für Sie") tätig. Gemeinsam mit ihrem Mann veröffentlichte sie mehrere Reisebücher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helga und Jürgen Bertram
SehnsuchtAustralien
Vom Abenteuer des Auswanderns
Saga
Vorwort
Im Obsthain leuchteten pralle Äpfel und Birnen in der Vorabendsonne. Von den Ästen eines Eukalyptusbaumes beäugten uns, in einer Mischung aus Argwohn und Neugier, weiße Kakadus. Von einer Koppel wehte heiteres Wiehern herüber. An der Hauswand rankten sich, als Sinfonie aus Farben und Düften, die Blumen des späten Sommers empor.
Es war einer dieser Momente, in denen man sich in Australien verlieben kann. Und da das ein paar Hundert Kilometer westlich von Sydney gelegene Grundstück, auf dem uns dieses Land während einer Drehreise für ein Fernsehfeature wieder einmal bezirzte, preiswert zu haben war, dachten wir: Hier könnte man sich ein Domizil einrichten – zunächst für die Ferien und später für den Lebensabend.
Es siegten, typisch deutsch, die Bedenken. Ist unser Journalistenberuf, so fragten wir uns, nicht zu stark an unsere Heimat und ihre Sprache gebunden? Und würden die durch unsere lange Korrespondentenzeit in Asien ohnehin schon brüchigen Bande zu unseren deutschen Freunden nicht endgültig zerrissen? So blieben wir Auswanderer im Geiste, verbrachten aber auch, zählt man alle Reisen zusammen, insgesamt etwa zwei Jahre auf der größten Insel der Welt. Die Ergebnisse sind, außer einem unbezahlbaren Schatz an Erinnerungen, vier Bücher und sechs filmische Dokumentationen.
Unser neuester Report würdigt jene Deutschen, die mutiger waren als wir und sich der Herausforderung Australien konsequent stellten. Manche stöberten wir in der ständig von Dürre und Fluten bedrohten Wildnis des Outbacks auf oder in den Regenwäldern im Hinterland der grandiosen Küsten. Mit anderen dinierten wir in den Restaurants der kosmopolitischen Metropolen. Oft half uns der gezielte Blick in die Branchenadressbücher, in denen zum Beispiel deutsche Handwerksbetriebe auffallend häufig vertreten sind.
Als immenser Vorteil erwies es sich, dass Menschen, die das Wagnis der Auswanderung eingehen, automatisch spannende Geschichten zu erzählen haben und dass ihr Mitteilungsbedürfnis offenbar mit der geografischen Distanz zu ihrer Heimat wächst. Zu mehr als hundert Stunden summieren sich auf unseren Tonbändern die Interviews, die wir auf unserer dreieinhalb Monate und 14000 Autokilometer langen Reise führten.
Eine unserer wichtigsten Erkenntnisse: Der enorme Einfluss, den deutsche Immigranten auf die australische Gesellschaft hatten und noch immer haben, wird hierzulande, vermutlich wegen der Fixierung auf Amerika, noch viel zu wenig gewürdigt. Dies nachhaltig zu ändern, ist eines der Ziele unseres Buches.
Hamburg, Anfang 2009
Helga und Jürgen Bertram
I Taifune und TräumeDie Pioniere des Nordens
1 »Wenn man in Not ist, dann kommen die Engel«Eine deutsche Karriere in Darwin
Darwins Erkennungsmelodie sind die Geräusche seiner abertausend Palmen: Ein Säuseln, wenn – piano – nur ein Lüftchen geht, ein Rascheln im Allegro eines tropischen Windes, ein Knistern und Knarzen im Fortissimo der Stürme, die sich wie aus dem Nichts über der Timor Sea aufbauen und das beschwingte Fächerspiel der Zweige im Nu zum Veitstanz peitschen. Dazu trommelt dann – plopp, plopp, plopp – der dumpfe Rhythmus der zu Boden fallenden Kokosnüsse.
So muss es in dem Hain an der Meerespromenade geklungen haben, bevor ein Taifun namens »Tracy« in der Nacht nach Heiligabend 1974 mit einer Spitzengeschwindigkeit von 280 Kilometern in der Stunde fast die komplette Hauptstadt des australischen Northern Territory flachlegte. 66 Menschen starben, 36 000 wurden evakuiert. Nach den japanischen Bombenangriffen von 1942 war es der zweite Schock in Darwins gerade mal hundertjährigen Geschichte.
Harry Maschke, geboren am 6. Juni 1936 in Groß-Bölkau bei Danzig, hat die Katastrophe miterlebt. »Ich lag gerade in der Badewanne, als das Dach wegflog«, erinnert er sich. »Mir fiel sofort das deutsche Paar ein, das bei mir zu Gast war. Die Frau hielt sich an einem Pfeiler auf der Empore im oberen Stockwerk fest und schrie um Hilfe. Die Treppe war bereits eingestürzt. ›Spring!‹, befahl ich ihr. ›Spring!‹ Sie sprang – und landete in meinen Armen. Danach habe ich mein Gedächtnis verloren. Aufgewacht bin ich drei Tage später in meinem Wochenendhaus am Adelaide River. Wie ich die mehr als hundert Kilometer mit dem Auto geschafft habe, das ist mir bis heute ein Rätsel.«
Turbulenzen, heftige wie moderate, prägen die Lebensgeschichte des Auswanderers, der im feuchtheißen Norden Australiens eine neue Heimat fand. Das Temperament, mit dem er uns in der künstlich gekühlten Lobby unseres Hotels die ersten Kapitel dieser Lebensgeschichte erzählt, ist das beste Mittel gegen den Jetlag, der uns nach siebzehnstündigem Flug zusetzt.
Die filmreife Story beginnt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Hassendorf, einem Flecken im Osten Schleswig-Holsteins. Dorthin hat es die Familie Maschke nach ihrer Flucht aus Westpreußen verschlagen. Der Vater, vom Landwirt zum Waldarbeiter abgestiegen, wird eines Tages vom Klassenlehrer seines Sohnes mit einer Auffälligkeit konfrontiert, die den Pädagogen mehr stört als begeistert. »Ich habe nichts gegen Neugier«, klagt er. »Aber Harry ist mir zu neugierig. Der will wirklich alles wissen. Mir geht das allmählich auf die Nerven.«
Als der Vierzehnjährige die Volksschule verlässt, weiß er vor allem eins: Eine Perspektive kann ihm Hassendorf nicht bieten. Ein Gymnasium mit anschließendem Studium kommt für ein Kind aus der Unterschicht, und sei es noch so begabt und wissbegierig, auch nicht in Frage. Da er sich nicht als Hilfskraft auf einem der Bauernhöfe verdingen will, setzt sich Harry Maschke in den Zug und fährt nach Dortmund, in eines der Zentren des Ruhrgebiets. Im industriellen Herzen der Bundesrepublik zeichnen sich die ersten Konturen des Wirtschaftswunders ab. »Ja, und da stand ich nun auf dem Dortmunder Bahnhof. Ich hatte ein paar Mark in der Tasche, aber kein konkretes Ziel. Mir war nur klar: Irgendwo in dieser Stadt wartet eine Chance auf dich. Während ich den nächsten Schritt überlegte, kam eine ältere Frau auf mich zu. ›Dir sieht man an‹, sagte sie, ›dass du nicht von hier bist. Komm, ich bring’ dich in ein Lehrlingsheim.‹«
Weil er sofort eine Lehrstelle als Klempner und Feinblechner findet, kann er in der Herberge bleiben. Schon kurz nach der Abschlussprüfung befördert ihn sein Betrieb, der 300 Leute beschäftigt, zum Vorarbeiter. Auf Baustellen in Bayern und in Holland bekommt der blutjunge Aufsteiger die damals noch rigiden Gesetze der Hierarchie zu spüren: An der Basis hält man zusammen, an der Spitze hat man Entscheidungsfreiheit. Wer dazwischen agiert, bekommt Druck von beiden Seiten.
Ein junger Mann von gut zwanzig, der sich mit dem Platz zwischen den Stühlen nicht zufriedengibt und auch etwas von der Welt sehen will, ist anfällig für Angebote. Das attraktivste kommt aus Australien, das in den fünfziger Jahren noch immer unter dem Schock des Zweiten Weltkriegs steht, in dem es an der Seite Großbritanniens kämpfte. Mit ihren nur sieben Millionen Einwohnern, so die Befürchtung, könnte eine Insel, die geografisch gut zwanzigmal größer ist als die Bundesrepublik, neuen Angriffen nicht trotzen. Und da man gleichzeitig Arbeitskräfte für die Industrialisierung des Landes benötigt, lenkt man das Augenmerk auch auf das Potenzial des ehemaligen Feindes Deutschland. Zunächst gibt man den Opfern eine Chance, die den Naziterror in den Gefangenenlagern überstanden haben. Wenig später wirbt man, Pragmatismus über moralischen Rigorismus stellend, auch um das Volk der Täter. »Australien ruft!«, heißt es in großflächigen Zeitungsannoncen.
Harry Maschke entschließt sich 1959, dem Lockruf zu folgen. »Wenn ich jetzt nicht gehe«, sagt er sich, »gehe ich nie.« Der australische Staat checkt seine Gesundheit, verpflichtet ihn für ein Jahr und finanziert ihm die Überfahrt. Am 23. Dezember, dem Geburtstag seiner Mutter, legt sein Schiff, das den verheißungsvollen Namen »Castel Felice« trägt, mit mehr als tausend Passagieren in Bremerhaven ab. »Nicht nur der Himmel«, erinnert er sich, »hat an diesem Tag geweint.«
Die sechswöchige Seereise endet in Fremantle, einem Immigrantenhafen an der australischen Westküste. Auf der mehr als 3000 Kilometer langen Zugfahrt in Richtung Melbourne, die tage- und nächtelang durch Wüste führt, begreift der Facharbeiter aus Hassendorf die Dimensionen des Kontinents, von dem er sich, wie Millionen Auswanderer vor und mit ihm, den Durchbruch zu einem Leben im Wohlstand erhofft.
Ziel des Transports ist Bonegilla, ein Kaff nordwestlich von Melbourne. Der Staat hat dort ein ehemaliges Armeecamp für seine neuen Bürger aus Europa geräumt. Dass sein erstes Zuhause in Australien aus Wellblech besteht, steckt der in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsene Waldarbeitersohn weg – die berufliche Offerte der Lagerverwaltung nicht. Weintrauben pflücken oder Bahnschwellen verlegen, lautet sie. »Deswegen«, sagt er sich, »bin ich nicht nach Australien gekommen.«
Mit vierzehn setzte er sich in den Zug nach Dortmund, mit 23 stellt er sich an den Highway und trampt nach Melbourne. Der Autofahrer, der ihn die 500 Kilometer lange Strecke bis in die Hauptstadt des Bundesstaates Victoria mitnimmt, ist Einwanderer wie er. Er stammt aus der Ukraine und war als Kriegsgefangener in einem deutschen Lager interniert. Man kommt ins Gespräch, findet sich sympathisch, und am Ende hat der Anhalter eine Empfehlung für eine Firma in der Tasche, die mit Feinblech arbeitet. Tatsächlich erhält er den Job, der exakt seinen Fähigkeiten entspricht. »Wenn man in Not ist«, philosophiert Harry Maschke in den schwülen Morgen hinein, »dann kommen die Engel.«
Wir sind aus der Hotellobby, in die zunehmend das Geplapper und Geklapper aus dem Frühstücksraum drang, in Harry Maschkes Auto gewechselt, einen Geländewagen mit Vierradantrieb. Solche bulligen Vehikel braucht man am nördlichen Ende des Kontinents. Denn gleich hinter Darwin, wo 80 000 Menschen leben, beginnt der unwegsame Busch.
Allmählich formt sich für uns ein Bild von unserem ersten Interviewpartner auf australischem Boden. Es zeigt, noch etwas klischeehaft, einen Einzelgänger, der sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lässt und der etwas unternimmt, wenn er mit seiner Lage nicht zufrieden ist, der also, in der einfachsten Bedeutung des Wortes, das Zeug zum »Unternehmer« hat. Die Stadt, durch die er uns führt, bleibt dagegen seltsam konturlos. Kein Kern ist zu erkennen, kein ruhender Pol. Weite Lücken klaffen zwischen den Häusern, breite Straßen zerschneiden tropisches Grün. Als fürchte es sich vor einem neuen Taifun, wirkt Darwin wie eine Stadt auf dem Sprung.
Ein Ort, an dem man vor Anker geht, war Darwin nie. Der Transit, das Provisorische, das Flüchtige prägen seinen Charakter. Chinesische Goldsucher brachen im 19. und 20. Jahrhundert von hier zu den nahe gelegenen Minen auf. Die Schiffe, die heute Erze und Rindvieh nach Asien transportieren, nehmen den umgekehrten Weg. Für die meisten Touristen ist Darwin nur die Durchgangsstation zu den krokodilreichen Nationalparks des Northern Territory. So richtet sich unser Augenmerk, mangels urbaner Reize, schnell wieder auf Harry Maschke. Die Neugier darauf, wie es mit ihm weiterging in Australien, hat unsere Müdigkeit endgültig vertrieben.
Die Melbourner Fabrik, in der Harry Maschke einen angemessenen Job findet, liegt fünf Kilometer von seiner Behausung, einer Arbeiterunterkunft, entfernt. Also ersteht er für fünf australische Pfund ein gebrauchtes Fahrrad. Ein Kollege, der vor dem gleichen Transportproblem steht, kauft es ihm für zwölf Pfund ab. Der Auswanderer aus Hassendorf hat eine Marktlücke entdeckt. Er kauft so viele alte Fahrräder wie möglich auf und zieht damit nach Dienstschluss und vor allem an den Wochenenden in seinem Viertel von Haus zu Haus. »Bis zu zehn habe ich samstags abgesetzt, die Leute waren ganz verrückt nach den Dingern.«
Drei Monate nach seiner Ankunft in Melbourne erwirbt Harry Maschke in einem Vorort sein erstes Stück Land. Fünf Jahre später bezieht er sein eigenes Haus. 1966 heiratet er die Australierin Lynette Joan Carrodus, eine Bibliothekarin. Schon bald bekommt sie zu spüren, dass sie an einen unruhigen Geist geraten ist. Ihr Mann will endlich etwas von dem Land sehen, dessen Sprache er mittlerweile beherrscht. Und er hat gehört, dass man im tropischen Norden gutes Geld verdienen kann. Also setzen sich die beiden in ihren Volkswagen und juckeln über Stein und Schotter in Richtung Darwin. Etwa 4000 Kilometer lang ist die Strecke, die mitten durch den Kontinent führt. »Tagelang«, erinnert sich Harry Maschke, »sind wir nur gefahren, gefahren, gefahren.«
Tatsächlich ist es kein Problem, in Darwin zunächst einen Job in der Blechverarbeitung zu finden und sich schon nach einem Vierteljahr mit einer Werkstatt selbstständig zu machen. »Natürlich ging das nicht ohne einen Kredit. Aber schwierig war das, ehrlich gesagt, nicht. Wenn man sich versteht und vertraut, besiegelt man das mit einem Handschlag, ohne große Formalitäten. In Australien ist das so, auch heute noch.«
Das Ehepaar hat sich in Darwin gerade eingerichtet, als Harry Maschke ein Schlag trifft, gegen den auch die stärkste Natur machtlos ist. Nierenkoliken plagen ihn. Er muss operiert werden. Der wilde Norden Australiens bietet alle Freiheiten – solange man gesund ist. Was die medizinische Versorgung betrifft, so vertraut der Auswanderer mehr den deutschen Hospitälern. Also begibt er sich, ständig unter Morphium stehend, mit seiner Frau per Schiff zurück nach Bremerhaven. Nach seiner Heilung arbeitet er so lange in der Bundesrepublik, bis er sich ein Auto kaufen kann. Er schickt es als Fracht nach Australien – und damit steht endgültig fest: Dort ist sein Zuhause.
Seine Abenteuerlust und seine Neugier haben unter dem gesundheitlichen Rückschlag nicht gelitten. Per Bus und per Bahn bestreitet das Ehepaar den größten Teil der Heimreise. Türkei, Persien, Afghanistan, Pakistan, Indien ... Auch mit dem einen oder anderen Kriegsschauplatz werden die beiden auf dieser brisanten Strecke konfrontiert. »Aber Angst«, sagt Harry Maschke, »war nie meine Schwäche. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, kann ich ziemlich stur sein.«
Zu stur, findet irgendwann seine Frau. Sie leidet zunehmend unter der erfolgsorientierten, risikoreichen Dynamik ihres Mannes und konsultiert einen Psychotherapeuten. »Der hat ihr klipp und klar gesagt, dass ich das Problem bin. Und daraus hat sie dann ihre Konsequenzen gezogen.«
Die Bibliothekarin verlässt die Gegend, in der noch immer das eindimensionale Denken der Goldgräber herrscht, und begibt sich in die südaustralische Universitätsstadt Adelaide, eines der intellektuellen Zentren des Landes. Dort nimmt sie ein Stipendium an. Die Scheidung, die der Trennung folgt, ist nach der schweren Krankheit die zweite Zäsur in der Vita das Auswanderers und Tatmenschen Harry Maschke. Das psychische Loch, in das er fällt, füllt er zunächst mit sinnlosem Aktionismus. »Ich habe mich«, blickt er zurück, »in meinen VW gesetzt und bin kreuz und quer durch die Gegend gefahren.« So reagiert ein Mensch, der nach einem Schock nicht mehr ein noch aus weiß und der die eheliche Katastrophe ja nicht durch seine Rücksichtslosigkeit herbeigeführt hat, sondern durch eine Passion, die als rücksichtslos begriffen wurde.
Erst als er im Hafen von Darwin ein beschädigtes Schiff entdeckt, erwacht wieder der Unternehmer in ihm. Er bietet sich an, den Generator zu reparieren, bekommt den Auftrag und erhält dafür die stattliche Summe von 1200 Dollar. Es ist das Startkapital für einen beispiellosen wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg.
1970 kauft er, mit Hilfe eines neuen Kredits, das Feinblechunternehmen, in dem er jahrelang als Facharbeiter tätig war. Er gründet regionale Zeitungen, beteiligt sich an einem Shopping-Center, hat bei Grundstücksgeschäften eine glückliche Hand. Vor allem mit seiner Fabrik gehört Harry Maschke zu den Gewinnern der Globalisierung. Australien, so der ökonomische Mechanismus, klinkt sich ein in die südpazifische Wachstumsregion, und die Indonesien vorgelagerte Hafenstadt Darwin avanciert zu einem wichtigen Vorposten. Wo es boomt, wird gebaut. Und wo neue Gebäude entstehen, braucht man Klimaanlagen. Exakt darauf hat sich Harry Maschke spezialisiert. Er war mit dem richtigen Produkt rechtzeitig am richtigen Ort.
Das Anwesen der Firma »Action Sheetmetal« fügt sich nahtlos in das unwirtliche Industriegebiet, durch das ein noch tristerer, fast ausschließlich von röhrenden Lastwagen befahrener Highway führt. Auch das Allerweltsbüro des Inhabers, der praktischen Safari-Stil trägt statt repräsentativen Zwirn, passt zu dieser grauen Umgebung. Alle Faszination geht in diesem Betrieb von dessen Produkt und einer Betriebsphilosophie aus, die auf Kooperation und Transparenz baut und in einem ebenso einfachen wie seltenen Charakterzug wurzelt: Der Chef hat nicht vergessen, woher er kommt.
»Meine Tür ist immer offen«, sagt Harry Maschke, dessen zwanzig Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten, politisch und kulturell zum Teil miteinander verfeindeten Nationen stammen: Australien, Kambodscha, China, Vietnam, Taiwan, Indien, Deutschland ... »Auch politische Flüchtlinge sind darunter«, betont der Auswanderer, der sich als Kind selbst auf der Flucht befand. Bei Kommunalwahlen hat er für die Labor Party, die australischen Sozialdemokraten, kandidiert. Auch der Gewerkschaft gehört er noch immer an. »Ich bin Unternehmer, aber auch Arbeiter«, sagt er, die These ignorierend, dass dies ein unüberbrückbarer Gegensatz sei. »Und diese Hierarchie, diese Frontstellung, wie ich sie aus Deutschland kenne«, fügt er hinzu, »gibt es in Australien sowieso nicht. Hier geht man lockerer miteinander um.«
Der Besitzer umtriebig und innovativ, die Belegschaft loyal und motiviert: Es ist eine Kombination, die diese mittelständische Fabrik an die internationale Spitze katapultiert. Sie sei auf ihrem Gebiet, heißt es in einer anlässlich einer Fachmesse in Chicago verliehenen Urkunde, »das technologisch am weitesten fortgeschrittene Unternehmen der Welt.«
Eine junge Frau in Arbeitsmontur betritt das Büro. Sie bittet ihren Chef um einen technischen Rat und spricht dabei Deutsch mit badischem Akzent. »Das ist Sandra aus Offenburg«, stellt Harry Maschke sie uns vor. »Sie lebt seit zweieinhalb Jahren in Australien und macht bei mir ein Praktikum als Elektrikerin. Danach will sie ihr Ingenieurstudium fortsetzen.«
Unternehmer wie Harry Maschke sind manisch auf die Marktlücke fixiert – wir als Journalisten auf die Story. In dieser Sucht nach dem Effekt und dem Erfolg und der Angst, etwas zu verpassen, gleichen sich unsere Berufe. Also lassen wir Sandra aus Offenburg nicht gehen, ohne ihr eine Frage zu stellen, von der wir uns eine emotionsgeladene, möglichst überschriftsreife Antwort erhoffen. »Was«, so wollen wir mit pathetischem Unterton wissen, »vermissen Sie als Deutsche in Australien?«
»Die Leberwurst.«
»Sonst nichts?«
»Eigentlich nicht.«
»Und was schätzen Sie an Australien besonders?«
»Das Leben ist hier weitaus entspannter. Die Menschen sind höflicher und unbeschwerter als in Deutschland.«
Möglichst viele junge Landsleute in die Wachstumszone an der Timor Sea zu locken, gehört zu den Prioritäten des Auswanderers. Er fördert, neben lokalen Bildungs- und Umweltprojekten, einen Austausch zwischen Gymnasiasten aus Nordrhein-Westfalen und dem Northern Territory und pflegt einen engen Kontakt zur Industrie und den Technischen Hochschulen der Bundesrepublik. Dabei kommt ihm ein Amt zugute, das die Karriere dieses Immigranten vorerst krönt: Seit 1988 ist er der regionale Ehrenkonsul der Bundesrepublik.
1500 Deutsche residieren mittlerweile im Northern Territory, das viermal größer ist als die Bundesrepublik, in dem insgesamt aber nur etwa 150 000 Menschen leben. Auf den ersten Blick ist das ein relativ kleiner Anteil, aber wenn man bedenkt, in welch ein abgelegenes Gebiet sich diese Menschen begeben, handelt es sich um eine beachtliche Zahl.
Erfolgreicher Unternehmer und Ehrenkonsul: Harry Maschke in Darwin
Auch die Ziffer der deutschen Urlauber, besonders der Rucksacktouristen, steigt ständig. Geht einem von ihnen das Geld aus oder wird jemand mit Rauschgift aufgegriffen, ist der Konsul die erste Anlaufstelle. »Das Schlimmste, was bisher passiert ist«, berichtet er, »war der Fall einer jungen Deutschen, die nachts während einer Party in einen Fluss stieg und von einem Krokodil getötet wurde. Klar: Es war auch Leichtsinn im Spiel, aber das ändert ja nichts an der Tragik.«
Die äußeren Kennzeichen des Ehrenamtes beschränken sich in Harry Maschkes Büro auf die schwarz-rot-goldene Fahne und Fotos der wichtigsten Repräsentanten des Staates. Auf seinen Habitus strahlt der Posten nicht aus. Es sei ihm eher peinlich, sagt er, »wenn deutsche Besucher vor mir fast auf die Knie fallen. Die denken: Konsul – das ist etwas ganz Besonderes. Diese Fixierung auf die Obrigkeit und die Bürokratie – nicht zu fassen. In Australien sind die Beamten wirklich servants, und die Bürger empfinden sich nicht als Bittsteller. Diese Mentalität habe ich übernommen.«
Vor einem solchen Hintergrund wundert es nicht, dass der Diplomat nicht vor Ehrfurcht erstarrt, als er uns von seiner Begegnung mit dem Australienbesucher Helmut Kohl erzählt. Am meisten hat ihn an dem damaligen Kanzler ein anatomisches Merkmal beeindruckt: »Der hat Hände wie Schaufeln.«
In unser Lachen mischt sich, wie aus heiterem Himmel, ein metallenes Kichern. Es entfährt einer Puppe, die einen Chinesen darstellt und bei Harry Maschke auf dem Schreibtisch steht. Automatisch springt sie an, wenn die Tonlage im Raum eine bestimmte Frequenz erreicht. Infantil, denkt man zunächst. Doch dann spürt man, dass die Witzfigur aus dieser Amtsstube den letzten Rest an leerer Konvention vertreibt.
Am Abend, bei einem Essen in einem Restaurant an einer traumhaften Bucht, stellt uns Harry Maschke seine zweite Frau vor. In Sydney, der Weltstadt an der Südostküste, hat er sie kennengelernt. Jannice Murdoch ist mit ihrer scheuen Noblesse und ihrer zarten Figur der optische Gegenpol zu dem vor Optimismus strotzenden Unternehmer, der hochtourige Autos und Boote schätzt. Vor kurzem, erzählt er, hat er seine Frau nach Hassendorf geführt, ihr die kleine Kirche gezeigt, die Behausung, in der er einen Teil seiner Kindheit verbrachte, die Schule, in der er den Klassenlehrer mit seiner Neugier nervte.
Es ist die Souveränität des Großbürgers, auf der das Bekenntnis zur ärmlichen Herkunft basiert. Dass Harry Maschke diesen gewaltigen gesellschaftlichen Sprung geschafft hat, belegt er, als er in der belebenden Kühle der Dämmerstunde über seine Rolle als Mäzen sinniert. Er unterstütze, verrät er, eine Universität für klassische Musik und die schönen Künste. »Und an die«, bemerkt er eher beiläufig, »geht eines Tages auch mein Erbe.« Hat er ein Vorbild?
Harry Maschke beantwortet die Frage, indem er uns eine Abhandlung über einen anderen Deutschen reicht, der in dieser Gegend gewirkt hat. Paul Heinrich Matthias Foelsche heißt er – und obwohl er einer ganz anderen Generation angehört, sind Parallelen in der Vita, vor allem aber in der Lebensphilosophie, unverkennbar.
Foelsche, am 30. März 1831 in dem Dorf Moorburg bei Hamburg als Sohn eines Seilmachers geboren, tritt mit achtzehn als einfacher Soldat in ein Husarenregiment ein. Er ist, wie Harry Maschke, 23 Jahre alt, als er sich entschließt, nach Australien auszuwandern. Sein Ziel ist Adelaide an der Südküste, wo sich während dieser Ära Tausende von Deutschen ansiedeln: Angehörige einer christlichen Gemeinschaft, die vor religiösen Repressionen in Preußen flohen, oder Intellektuelle, die ihrer Heimat aus Enttäuschung über die mageren Resultate der Revolution von 1848 den Rücken kehrten.
Der Auswanderer aus Moorburg macht, nachdem er als Goldsucher glücklos geblieben ist, Karriere bei der berittenen Polizei und steigt in kurzer Zeit zum Unteroffizier auf. 1869 wird er beauftragt, im fernen Norden des Landes, dem heutigen Northern Territory, eine Polizeistaffel aufzubauen. 44 Jahre verbringt er in Darwin. In diesen Dekaden entfaltet er Fähigkeiten, die ihm, weil sie vom Pioniergeist der Gründerjahre zeugen, einen Platz in den australischen Geschichtsbüchern sichern. Er agiert als Friedens- und Untersuchungsrichter, betätigt sich als Zahnarzt und Büchsenmacher, engagiert sich in der methodistischen Kirche, in der Kommunalpolitik und bei den Freimaurern.
Vor allem aber: Der Kommissar ist ein begnadeter Fotograf. Die Bilder, die er auf seinen Inspektionsreisen durch das weite, wilde Land macht, gehören heute zu den Schätzen der australischen Archive. Auch liebevolle Porträts von Aborigines, den australischen Ureinwohnern, sind darunter. Weil er auch ihre Sitten und Gesetze achtete und sogar ihre Sprache lernte, gehört der deutsche Polizeioffizier zu den wenigen weißen Einwanderern, die von den Aborigines verehrt werden.
Den Namen des Autodidakten, der sowohl vom britischen König als auch vom deutschen Kaiser einen Orden erhielt, tragen ein Berg, ein Fluss, ein Baum, eine Blume und eine Straße von Darwin. »Er war«, sagt der Fabrikant und Konsul Harry Maschke in einer Gedenkrede, »ein Mann, der Visionen hatte und der von einer grenzenlosen Energie und Leidenschaft beseelt war. Er glaubte fest an den Frieden und die menschliche Einsicht.«
Ein Porträt von Paul Heinrich Matthias Foelsche hängt im Chefzimmer der Firma »Action Sheetmetal« an der Wand.
2 »Es hat mich einfach gepackt«Mit dem Fahrrad in ein neues Leben
An dem Morgen, als wir uns zum ersten Mal trafen, hatte uns der Frühaufsteher Harry Maschke mit seinem Anruf aus dem Tiefschlaf geholt. Am Abend, als wir uns mit einem Essen voneinander verabschiedeten, reichte er telefonisch einen »wichtigen Tipp« nach. Er kenne da noch jemanden in Darwin, der für uns interessant sein könnte. Wir sollten mit unserem Mietauto am nächsten Vormittag bei seiner Fabrik vorbeikommen, dann lotse er uns mit seinem Geländewagen zu »Helmut«, den im ganzen Northern Territory bekannten Gärtner.
Wir fahren von der Firma »Action Sheetmetal« keine drei, vier Kilometer in Richtung Süden, als das unwirtliche Industriegebiet abrupt von einer Landschaft abgelöst wird, die uns eine Ahnung von der wilden Schönheit des Buschs vermittelt. Von Eukalyptusbäumen flattern, durch den Lärm unserer Motoren verscheucht, kreischende Kakadus auf. An den Gestaden einer mit weißer Blütenpracht besprenkelten Lagune putzen sich Pulks von Reihern und Wildgänsen.
Doch dann herrscht plötzlich Ordnung im Outback. Namensschilder markieren die tropischen Pflanzen. Auf keinem der wie mit dem Lineal gezogenen Beete wuchert unnützes Grün. Die Brunnen und die Miniaturmühlen, die chinesischen Terrakottafiguren und die modernen Skulpturen, die das nach Hibiskus, Bougainvilleen und Rosen duftende Areal dekorieren, verstärken den Eindruck von einer domestizierten Natur. Aber wo ist Helmut, der Gärtner? »On the radio«, sagt Hardy, sein Sohn.
»On the Radio?”
Sein Vater, klärt uns der Sohn auf, habe eine feste Ratgebersendung im Regionalprogramm. Wir sollten warten, er käme gleich zurück.
Und dann steht er plötzlich vor uns, der Experte für Blumenerde, Zimmerpalmen, Blattläuse, Kakteen. Er trägt, zum Schutz gegen die von Tag zu Tag stärker werdende Frühlingssonne, einen breitkrempigen Hut, die für australische Männer typische dreiviertellange Hose und jene ledernen Stiefel, die als Bollwerk gegen die auch in dieser Region weit verbreiteten Giftschlangen dienen. Die Souveränität, die ihm den Job beim Hörfunk einbrachte, steht ihm im kantigen Gesicht geschrieben. Im Gegensatz zu Harry Maschke, der seine Pointen mit temperamentvoller Gestik untermalt, bevorzugt er einen eher ruhigen, fast stoischen Erzählstil. Der Humor, mit dem er manche Sätze würzt und der in seinen Augen immer mal wieder den Schalk aufblitzen lässt, wirkt durch dieses Understatement umso intensiver.
Helmut Schimmel, 68
Wenn ich den Leuten hier in Australien von meiner Heimat erzähle, dann sage ich immer: Ich komme aus einem Dorf, das damals wohl das rückständigste in ganz Deutschland war. Tatsächlich gehörten wir zu den Letzten, die Elektrizität, fließendes Wasser und gepflasterte Straßen bekamen, und bei uns wurde auch einer der letzten Wilderer auf deutschem Boden erschossen. Das Dorf heißt Schnellbach, und es liegt mitten im Hunsrück. Zu meiner Zeit waren die Leute dort sehr arm. Es gab nur wenige Bauern, die mehr als zwei Kühe hatten und von der Landwirtschaft leben konnten. Die meisten verdienten ihren Lebensunterhalt, indem sie Musik machten. Sie zogen von einer Kirmes zur nächsten und machten Musik.
Meine Mutter war Kriegerwitwe, sie hatte es nicht leicht damals mit drei kleinen Kindern. Wir waren Flüchtlinge, ursprünglich stammt meine Familie aus Schlesien. Ich wurde 1939 in Hermannsdorf bei Breslau geboren. Meine Mutter hat uns durchgebracht, indem sie für die Bauern im Hunsrück arbeitete. Sie hat auf den Feldern gearbeitet oder die Wäsche gemacht, es war harte Arbeit, sehr hart. Aber das weiß man natürlich erst zu schätzen, wenn man älter ist.
1989 war ich zum letzten Mal in Deutschland und habe auch meine alte Heimat besucht. Schnellbach nennt sich jetzt Höhenluftkurort. Viele neue Häuser wurden gebaut, aber die meisten stehen leer, weil die Bewohner nur die Ferien dort verbringen. Alles hat sich total verändert, und wenn du aus Australien kommst, dann fällt dir besonders die Beengtheit auf. Ein Dorf am anderen, und so vieles ist verboten. Ich weiß noch, dass ich mit einem meiner alten Schulfreunde angeln gehen wollte. Ich hab’ zu ihm gesagt: Los, komm, lass uns fischen gehen. Forellen aus dem Bach, so wie früher. Der Mann hat fast einen Herzinfarkt bekommen und mir klargemacht, dass man dafür ins Gefängnis kommen kann.
Aus dem Hunsrück ins Northern Territory: Helmut Schimmel, Gärtnereibesitzer und Farmer
Nein, ich könnte heute nicht mehr in Deutschland leben, ich würde da nicht mehr hinpassen. Hier ist vieles viel einfacher, man findet leichter Zugang. Ich kann hier einen Minister anrufen, und ich weiß, dass ich einen Termin bekomme. Unseren Ministerpräsidenten habe ich mehrfach getroffen, so etwas ist kein Problem in Australien. In Deutschland würde man nicht mal auf die Idee kommen, oder?
Ob ich mich als richtiger Aussie fühle? Schwer zu sagen. Ich weiß nur: Ich träume in Englisch. Und ich denke, ich werde hier sterben. Australien war gut zu mir. Ich sage immer: Um das zu erreichen, was ich hier erreicht habe, hätte ich in Deutschland viel mehr investieren müssen, in jeder Beziehung.
Dabei wollte ich eigentlich gar nicht nach Australien, ich bin eher per Zufall hier gelandet. Nachdem ich in Bad Kreuznach am Max-Planck-Institut Gartenbau studiert hatte, wollte ich die Welt sehen. Und ich wollte dabei auch Japan besuchen. Ich dachte, in meinem Beruf könnte ich davon profitieren. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, per Fahrrad. Soweit es irgend ging, habe ich mich über Land vorwärtsbewegt. Italien, Türkei, über den Bosporus, Iran, Irak, Pakistan, Indien, Ceylon, schließlich per Schiff nach Indonesien. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich insgesamt zwei Jahre gebraucht, um nach Japan zu gelangen. Ich habe dort weiterstudiert, bis ich erfuhr, dass in Melbourne und in den USA große internationale Pfadfindertreffen stattfinden würden. Ich war damals begeisterter Pfadfinder, bin es heute noch, und natürlich musste ich da unbedingt hin.
1964 bin ich in Darwin angekommen, per Schiff. Ich mochte die Gegend hier auf Anhieb. Ob es die Weite war, die Freundlichkeit der Leute – ich weiß es nicht, es hat mich einfach gepackt. Sicher, die Menschen hier sind auch heute noch freundlich – aber damals, das war einfach überwältigend. Diese Offenheit, die Gastfreundschaft, ständig wurde man zu Barbecues eingeladen. Darwin hatte in den Sechzigern gerade mal 24 000 Einwohner, verglichen mit heute eine Kleinstadt. Um Geld für meine Weiterreise zu verdienen, habe ich mir erst mal einen Job gesucht, und abends habe ich Englischkurse belegt. Zum Unterricht bin ich mit dem Rad in die Stadt gefahren, das waren ungefähr zwanzig Kilometer, und ich erinnere mich bis heute, dass mir einmal sieben Autos auf dieser Strecke entgegenkamen. Mein Gott, habe ich damals gedacht, was für ein Verkehr.
Als ich dann schließlich zusammen mit den Boyscouts aus Darwin nach Melbourne und Amerika gereist bin, wusste ich: Eines Tages komme ich zurück. Ein Jahr lang bin ich noch durch Südamerika geradelt, von Caracas bis an den Amazonas, und danach habe ich in Deutschland meine Sachen geordnet. Ich bin zu meiner Mutter in den Hunsrück gefahren und habe ihr gesagt: Ich mache hier klar Schiff und gehe nach Australien. Begeistert war sie nicht, aber was konnte sie tun? Da war nichts in Deutschland, was mich gehalten hätte. Schon unterwegs hatte ich immer, wenn ich an zu Hause dachte, Darwin vor Augen.
Meine englische Freundin hatte auf mich gewartet, und 1967 haben wir unser gemeinsames Leben begonnen. Zunächst habe ich für die Fluggesellschaft Quantas gearbeitet, aber schon 1969 habe ich mich mit einem Betrieb für Gartenarchitektur selbstständig gemacht. Mit Schubkarre und Schaufeln ging es los, aber schon bald hatten wir dreißig Angestellte. Fast alles, was heute im Stadtbild von Darwin an Gartenarchitektur zu sehen ist, stammt von unserer Firma. Natürlich war es nicht so einfach, wie es sich jetzt hier darstellt, der Anfang ist immer schwer. Aber ich denke, auch heute noch kann man es in Australien zu etwas bringen, wenn man bereit ist, hart zu arbeiten.
Das Gelände hier ist an die hundert Hektar groß, aber wir bewirtschaften nur fünfzig. Wir haben das Land ringsum vor allem deshalb gekauft, um die Lagune zu schützen, die sich hinter der Gärtnerei ausbreitet. Noch sind nur wenige hier, aber in den nächsten drei Wochen werden Tausende von Gänsen einfliegen, um an der Lagune zu brüten. Sie wissen inzwischen, dass dort nicht geschossen wird.
Meine Frau und ich, wir lieben die Natur, das ist auch etwas, was uns an diese Gegend bindet. Wir sind das, was man in Australien bush people nennt, wir mögen die Einsamkeit. Wir haben schon unsere Flitterwochen im Busch verbracht, und als wir ein bisschen Geld übrig hatten, haben wir eine station gekauft: Diese Farm war mehr als 700 Kilometer entfernt, im Barkly Tableland, irgendwo im Nirgendwo. Mit dem Auto fuhr man achteinhalb Stunden von Darwin bis zur Farm, und was mich dabei am meisten beeindruckt hat: Auf der gesamten Strecke gab es nur einen Abbieger. Du fuhrst endlos geradeaus, und einmal ging’s links ab. Das ist auch Australien, das ist das Outback.
Die Farm war riesig, wir hatten schließlich 13 000 Stück Rindvieh. Dafür brauchte man natürlich Personal, und das wurde uns eines Tages zu viel. Nach zehn Jahren haben wir die Farm verkauft, schweren Herzens. Wir haben es geliebt, da draußen. Drei Jahre lang haben wir uns umgeschaut, dann haben wir wieder ein Stück Land im Outback gekauft. Dieses Areal ist nur anderthalb Autostunden von Darwin entfernt, liegt in der Nähe vom Kakadu-Nationalpark. Eigentlich wollten wir nur eine Hütte draufsetzen, aber wie es so geht: Erst baut man eine Veranda, dann ein Schlafzimmer, schließlich noch die Küche – und plötzlich hat man ein vollständiges Anwesen.
Einen Teil des Landes haben wir verpachtet. Wir haben nur eine 27 Quadratkilometer große Koppel behalten, auf der wir Rinder züchten. Bantengs, die bringen gutes Fleisch, und mir macht das Spaß. Natürlich ist nicht alles vergnüglich da draußen, der Busch ist immer eine Herausforderung. Wir haben zum Beispiel Stechakazien auf unserem Land, ein furchtbares Zeug mit Dornen. Die Dinger wuchern wie verrückt, und die Saat bleibt dreißig Jahre lang im Boden. Ich denke, ich werde noch zwanzig Jahre damit beschäftigt sein, Stechakazien zu vernichten.
Unser Haus steht auf einem Hügel, man kann von dort die Wasserstellen überblicken. In den Lagunen sind etliche Krokodile, aber normalerweise greifen sie nicht an. Am Ende der Trockenzeit sind sie manchmal sehr hungrig, dann sollte man allerdings aufpassen. Im vergangenen Jahr habe ich zwei männliche Tiere miteinander kämpfen sehen, ein grandioses Spektakel. Ich habe geschrien, aber ich hätte vermutlich direkt neben ihnen stehen können, ohne dass sie voneinander abgelassen hätten.
Eines der Krokodile ist der Boss, wir nennen es Walter. Ich schätze, dass es an die fünf Meter lang ist. Wenn ein fremdes Auto aufs Gelände fährt, dann schlägt Walter Wellen im Wasser. Krokodile stecken auf diese Weise ihr Gebiet ab. Sie wollen dir damit klarmachen: Hier bin ich, und hier habe ich das Sagen. Unsere Autos kennt Walter. Wenn wir kommen, bleibt die Lagune ruhig. Meine Frau hat Angst, sie geht nicht mehr schwimmen. Mir macht das nichts aus. Wenn’s mir zu warm wird, steige ich ins Wasser. Allerdings: Ich schwimme nicht in der Nacht, das wäre tatsächlich zu gefährlich.
Wir leben zur Hälfte auf der Farm, zur anderen Hälfte in Darwin. Völlig aus dem Geschäft zurückziehen möchte ich mich noch nicht, auch wenn ich merke, dass ich älter werde. Früher konnte ich einen zwanzig Gallonen schweren Benzinkanister mit einem Ruck auf einen Pritschenwagen hieven – das geht jetzt nicht mehr. Meine Ratgebersendung im Radio habe ich seit zwanzig Jahren. Früher habe ich auch Fernsehen gemacht, aber das wurde mir zu viel. Da müsste ich samstags und sonntags auf Sendung sein, und das sind genau die Tage, an denen hier in der Gärtnerei am meisten los ist.
Zurzeit verkaufen sich Bougainvilleen am besten, eine sogenannte Bambino-Variante. Sie ist kompakter und hat auch mehr Blüten als der normale Strauch. Wissen Sie, Pflanzen sind auch Modesache. Man verkauft, was die Leute wollen. Wir haben sogar Rosen im Angebot, und sie machen sich gar nicht mal so schlecht, trotz des tropischen Klimas. Wenn’s nach mir ginge: Ich würde keine Rosen pflanzen. Aber die Leute, die aus kühleren Gegenden hierherkommen, wollen ihre Rosen, und dann sollen sie Rosen haben.
Ich weiß nicht, ob unser Sohn den Betrieb übernehmen wird. Gärtnereien sind sehr arbeitsintensiv, und man kann sich auch verspekulieren. Wir sind eine Partnerschaft mit einem Unternehmen in Saudi-Arabien eingegangen und haben für den Markt dort drüben Pflanzen im Wert von 150 000 Dollar gezogen. Aber die Saudis kommen mit dem Geld nicht rüber, und jetzt sitzen wir auf dem Grünzeug. Natürlich wäre es schön, wenn der Laden in der Familie bleiben würde. Aber wenn es zu schwer wird für Hardy – auch okay. Wir zwingen ihn zu nichts.
3 »Nie wieder Bellenberg!«Ein schwäbisch-australischer Überlebenskampf
Ein Gurren ist es nicht, was aus dem Dunkel der Wildnis tönt. Zwitschern, Trällern oder Krähen kann man es auch nicht nennen. Irgendwo dazwischen bewegt sich der Ton, der, so viel steht fest, unheimlich klingt.
»Geistervögel«, klärt uns Regina Wiebelskircher auf. »Die heißen so«, fügt ihr Mann Udo hinzu, »weil man sie zwar hören kann, aber nie zu sehen bekommt. Sie sind nachtaktiv. Das sind die Kängurus, die auf unserem Grundstück grasen, zwar auch, aber die zeigen sich wenigstens morgens und abends in der Dämmerung.«
In Howard Springs, einem der ausufernden, sich in der zaunlosen Weite verlierenden Vororte von Darwin, liegt das 10 000 Quadratmeter große Anwesen. Das Einfamilienhaus in seiner Mitte dient als Wohnung und als Büro und taugt auch zum Refugium. Das gilt besonders für die riesige Veranda, von der man direkt in den vor tropischer Vitalität strotzenden Busch blickt.
Es dauert eine Weile, bis man sich in diesem Ambiente an Begriffe wie »atomare Bedrohung«, »Baader-Meinhof-Hysterie« oder »Nato-Doppelbeschluss« gewöhnt. Wie verbale Irrläufer schwirren sie durch den Raum und verlangen doch gespannte Aufmerksamkeit. Schließlich markieren sie den Anfang einer Auswandererkarriere, die nach der Dramaturgie der Achterbahn verlief.
»Wenn man Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre die Fernsehnachrichten eingeschaltet hat«, blickt Udo Wiebelskircher zurück, »dann gab es doch fast nur Gewalt und Bedrohung. Gloom and doom, wie es auf Englisch heißt. Na ja, und irgendwann haben wir es mit der Angst bekommen und beschlossen, Deutschland zu verlassen. Wirtschaftliche Gründe waren es jedenfalls nicht. Wir waren beide um die dreißig. Ich hatte einen guten Job in der Computerbranche. Und ein Haus besaßen wir auch schon. Eigentlich hätten wir glücklich sein können in Bellenberg – wenn da nicht diese pessimistische Grundstimmung gewesen wäre.«
Der Schwabe Udo Wiebelskircher spricht bedächtig, legt zwischen den Sätzen Denkpausen ein, die der Ruf der Geistervögel füllt. Für Spontaneität und Emotion sorgt seine aus der norddeutschen Elbniederung stammende Frau. »Die Atmosphäre war es nicht allein«, relativiert sie, »ich wollte auch unbedingt was sehen von der Welt. Tag für Tag Bellenberg – bis zum Lebensende? Das kann’s doch nicht sein. Mit achtzehn bin ich schon mal nach Südafrika abgehauen. Toll war das. Ich war die treibende Kraft hinter unserem Entschluss. Der Udo ist mehr ein Familienmensch, dem ist die Entscheidung schwerer gefallen als mir. Sie müssen wissen: Ich hab’ Zigeunerblut in den Adern.«
Udo Wiebelskircher nimmt einen kräftigen Schluck aus seinem Bierglas, wendet den Blick in die schwarze Nacht, lässt die Worte seiner Frau erst einmal sacken. Er selbst, das spürt man, würde sich nicht dazu durchringen können, wildfremde Besucher mit persönlichen Bekenntnissen zu konfrontieren. Eine paralysierende Pause entsteht. Regina Wiebelskircher befreit uns mit einem Temperamentsausbruch von der zwanghaften Vorstellung, die Stille mit einer womöglich unpassenden Frage überbrücken zu müssen. »Und dann«, schimpft sie, »war da noch diese Ungeheuerlichkeit mit unserer Tochter. Als sie fünf war, haben wir sie für die Schule angemeldet. Dabei kam heraus, dass sie nicht getauft ist. Und da hat’s dann geheißen: Die Getauften kommen in die katholische Klasse, die Nichtgetauften in die Ausländerklasse. Das hat das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Ich kann nur sagen: Nie wieder zurück nach Bellenberg!«
Es gibt also eine Reihe von Gründen, die dieses in einer schwäbischen Kleinstadt etablierte Ehepaar 1981 veranlassen, das Wagnis einer Auswanderung einzugehen: politische, atmosphärische und individuelle. Zur Wahl stehen damals Kanada und Australien. Dass die beiden sich für Australien entscheiden, liegt an einem Bekannten, der sich in den Bundesstaat New South Wales absetzte und ihnen Fotos von der faszinierenden Landschaft dort schickt. Weiße Strände, blauer Himmel, üppige Vegetation ... Regina Wiebelskircher würde am liebsten sofort ihre Koffer packen. Doch ihr Mann wählt den sicheren Weg. Er formuliert eine fristgerechte Kündigung, vergattert seine Frau aber, das Schreiben erst mal zu Hause aufzubewahren. Dann setzt er sich in ein Flugzeug und lotet an der Südostküste, einem der wirtschaftlichen Zentren Australiens, die Arbeitsmöglichkeiten aus. Sie gestalten sich erfolgversprechend. Also signalisiert er nach Bellenberg: Kündigung abschicken!
Die Entscheidung zahlt sich aus – zunächst. Als eine technologische Revolution die Computerbranche erfasst und die Firma, für die der deutsche Auswanderer arbeitet, mit der übermächtigen Konkurrenz nicht mehr mithalten kann, steht das Ehepaar vor dem Nichts.
Zurück in die Heimat, sich wieder einrichten im schwäbischen Idyll und nie mehr ein solches Risiko eingehen – das wäre eine typisch deutsche Reaktion. Flexibel und mobil sein, unkonventionell handeln und ein neues Wagnis eingehen – das ist die australische Variante. Udo und Regina Wiebelskircher entscheiden sich für den australischen Weg. Sie verkaufen ihr Haus in Melbourne und investieren den Erlös in einen Caravanpark, den sie zusammen mit einem anderen Auswandererpaar in einer reizvollen Flusslandschaft in der Nähe der Ostküste betreiben.
Eine vielversprechende Perspektive ist das auf einem Kontinent, den in zunehmendem Maße die »grauen Nomaden« erobern. So nennt man die Pensionäre, die, statt nach Bali oder auf die Fidschi-Inseln zu jetten, monate- oder jahrelang mit ihren Wohnwagen durch Australien reisen, um die wilde Schönheit und die historischen Wurzeln ihres eigenen Landes zu entdecken.
Die Zielgruppe stimmt, aber die Chemie unter den Geschäftspartnern nicht. »Irgendwann hat es dann echt geknallt«, erinnert sich Regina Wiebelskircher. »70 000 Dollar haben wir bei diesem Geschäft in den Sand gesetzt. Also, wir hatten in Australien wirklich unsere ups and downs.«
Rauf, runter, rauf: Das bleibt für das Ehepaar aus Bellenberg noch über Jahre der Lebenstakt. Die Rückkehr nach Melbourne in die noch immer von Turbulenzen geschüttelte Computerbranche – gescheitert. Das Angebot, in Darwin, ausgerechnet in Darwin, für die Finanzbehörde die Wartung der Computer zu übernehmen – ein Hoffnungsschimmer. Udo Wiebelskircher sagt zu, zieht mit seiner Frau in den gottverlassenen Norden. Doch schon bald entledigt sich das Amt seines alten Systems – und seines deutschen Spezialisten. »Das geht alles ganz schnell hier. Da gehst du morgens auf die Arbeit und nach dem zweiten Frühstück bist du wieder zu Hause.«
Es ist die Kehrseite einer Flexibilität, die auch der Arbeitgeber für sich in Anspruch nimmt. Udo Wiebelskircher macht sich selbstständig, will sein eigener Herr sein. Ein letztes Mal versucht er es mit Computern – und scheitert. Doch statt aufzugeben, trifft das Ehepaar eine ebenso mutige wie weitsichtige unternehmerische Entscheidung. Es betreibt, wie es in der Fachsprache heißt, Diversifikation. Man stellt sich, einfacher ausgedrückt, wirtschaftlich auf mehrere Beine.