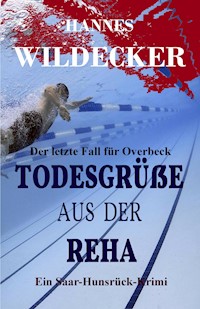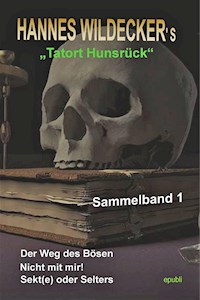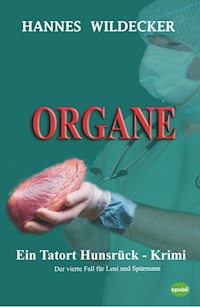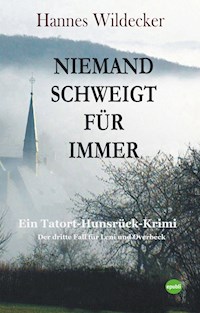Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tatort Hunsrück
- Sprache: Deutsch
Der Hunsrück wird wieder einmal zum spannungsgeladenen Schauplatz. Eine unheimliche Mordserie und eine suspekte Sekten-Gemeinschaft geben den Ermittlern zahlreiche Rätsel auf. Blutleere Frauenleichen und in die Haut eingebrannte sakrale Motive deuten auf Ritualmorde hin. Hat die Sekte ihre Finger im Spiel? Ist es ein Psychopath, der sein grausames Spiel treibt? Auch in diesem Hunsrück-Krimi verzichtet der Autor nicht auf Lokalkolorit und beschreibt Besonderheiten seiner Heimat, mal mit dem Tenor der Begeisterung, mal mit leiser Kritik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannes Wildecker
Sekt(e) oder Selters
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Sekt(e) oder Selters
Impressum
Für Frederik und Viola
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11.Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Epilog
Mit einem Blutbild legt man ein Zeugnis ab über die Gesundheit des Menschen. Ein Blutbild kann auch der Weg in den Tod bedeuten
Impressum neobooks
Sekt(e) oder Selters
Hannes Wildecker
Ein Hunsrück-Krimi
Impressum
Coverfoto und Covergestaltung: Hans Muth
© h@mu 2017
Hans Muth
Kapellenstr. 6
54316 Lampaden
www.Hans-Muth.de
Der Originaltitel „Blutbild“ ist im Jahr 2010 im Südwestbuch-Verlag Stuttgart erschienen. Die Rechte wurden mit freundlicher Genehmigung des Verlags SWB an den Urheber zurückgegeben. Die vorliegende Fassung wurde neu lektoriert.
Für Frederik und Viola
Prolog
Die Diskothek „Inferno“ liegt außerhalb der Ortschaft Forstenau. Sie liegt an jenem Weg, der auch zur Fuchsfarm und dem Segelflugplatz führt und hat gerade ihre Pforten dichtgemacht. Die letzten mehr oder weniger angetrunkenen, grölenden Gäste werden von den Bediensteten unsanft nach draußen befördert und machen sich schwankend auf den Heimweg.
Es ist fast vier Uhr morgens. Am Horizont kann man erkennen, dass sich in spätestens zwei Stunden die Sonne ihren Weg über den Hunsrück bahnen und ihre wohlige vorsommerliche Wärme auf den Hochwald verteilen wird.
Es scheint ein angenehmer Sommer zu werden. Der Winter ist ausnahmsweise mal wieder so richtig kalt gewesen, so, wie man ihn noch vor Jahrzehnten erlebt hat. Doch was danach kam, verbreitete wenig Freude. Nasse, unangenehm neblige und teils verregnete Winter sorgten dafür, dass sich das Familienleben mehr innerhalb als außerhalb der heimischen Gemäuer abspielte. Dennoch verzeichnen Kindergärten und Schulen eine Reduzierung ihrer Kapazitäten und man denkt bereits über die Schließung manch kleinerer Schule nach.
Doch der letzte Winter ist endlich wieder so gewesen, wie man sich einen Winter im Hunsrück vorstellt: Kalt und mit viel Schnee und die höchste Erhebung im Hunsrück, der Erbeskopf mit seinen stattlichen 818 Metern sorgt für gute finanzielle Einnahmen, denn dort heißt es: „Ski und Rodel gut.“
Dieser Morgen allerdings ist alles andere als ein Vorbote auf einen schönen und sonnigen Tag. Nebel senken sich über die Wiesen und Felder und verbreiten in der grau-bläulichen Morgendämmerung eine Art gruseliger Friedhofsstimmung. Der Mond hat immer noch nicht seinen Platz am Firmament geräumt und durch die Nebelschwaden ist er nur schemenhaft in einem fahlen bläulichen Licht zu erkennen.
Die letzten Gäste der Disko „Inferno“ haben sich inzwischen wankend und zum Teil in lallende Selbstgespräche verwickelt davongeschlichen und sind im Nebel verschwunden. Ihre Stimmen versickern allmählich im Nichts.
In den Räumlichkeiten des Tanzpalastes verlöschen die bunten Lampions nacheinander und schließlich verlassen auch die Betreiber des Objektes, drei Burschen im Alter zwischen dreißig und vierzig Jahren, den Ort, der sie Nacht für Nacht an die Lärmmaschine fesselt. Wortlos steigen sie in eine dunkle Limousine und brausen davon, ihrem ersehnten Schlaf entgegen.
Dann ist es plötzlich still. Kein Laut ist zu vernehmen, kein Vogel, der schon erwacht wäre, kein Stück Wild, das sich hierher verlaufen hätte. Es ist einfach still. Totenstill.
Doch dann!
Ein Geräusch in der Stille!
Ein Brummen, das lauter wird und schließlich im Nebel und der Morgendämmerung in der Nähe der Diskothek endet.
Für einen Moment erhellen Scheinwerfer in gerader Richtung die Umgebung. Sie gehören zu einem Pkw-Kombi der Mittelklasse, der sich aus Richtung der Waldlandschaft kommend langsam aus dem Dunkel schält und auf Höhe der Diskothek anhält. Sofort erlöschen die Scheinwerfer wieder und der Wagen ist nur noch schemenhaft zu erkennen.
Die Fahrertür öffnet sich langsam und eine Gestalt, in dunkle Kleidung gehüllt, die Kapuze über den Kopf gezogen, steigt sich nach allen Seiten umsehend aus und schließt leise die Tür. Offensichtlich ist sie bestrebt, auf jede Art von Geräusch zu verzichten, denn auch die Hecktür des Fahrzeuges öffnet sie bedächtig und fast vollkommen lautlos.
Hätte jemand in der Nähe dieser Aktivität Aufstellung bezogen und seinen Blick nicht zugfällig in diese Richtung gewandt, es würde kein Laut bis zu ihm herüberdringen.
Die Gestalt, die aufgrund ihrer schwarzen Kleidung kaum noch wahrzunehmen ist, greift mit beiden Armen in das Fahrzeuginnere und zieht Zentimeter für Zentimeter einen länglichen Gegenstand heraus und legt ihn hinter dem Fahrzeug auf der geteerten Straße ab.
Sie schließt die Heckklappe, fast geräuschlos. Nur ein leises Klack ist zu vernehmen. Die Person beugt sich zu dem Objekt hinunter, greift mit beiden Armen zu und wuchtet sich das Paket über beide Unterarme, um sofort mit ihrer schweren Last, unter der sie zusammenzubrechen droht, in Richtung des Diskothek-Gebäudes zu wanken.
Die Person scheint kurz zu überlegen, dann legt sie den fast zwei Meter langen Gegenstand auf dem Boden ab, runde zehn Meter von der Lokalität entfernt, an den Rand einer frisch gemähten Wiese.
Schwer atmend erreicht sie mit zwei großen Schritten wieder das befestigte Gelände der Diskothek, steigt in den Kombi ein und fährt, auf eine Beleuchtung verzichtend, langsam davon, in Richtung Forstenau. In der Ferne kann man erkennen, wie die Beleuchtung des Fahrzeuges eingeschaltet wird. Dann ist es wieder still. Totenstill!
Die aufgehende Sonne des vielversprechenden Maimorgens erhellt langsam die Erde und verteilt den fallenden Nebel endgültig auf die Wiesen und Felder des Hochwalds als Nahrung für Flora und Fauna.
Auch der neben der Disko abgelegte Gegenstand verliert mehr und mehr seine Schemenhaftigkeit und offenbart schließlich die Form eines menschlichen Körpers, der auf dem Rücken liegt und mit leeren Augen gen Himmel zu schauen scheint.
Abgelegt wie ein Stück Abfall liegt die tote Frau, deren Alter kaum über fünfundzwanzig zu sein scheint, nun auf der Wiese vor dem Tanzpalast, die gebrochenen Augen in dem fast weißen Gesicht zum Himmel gerichtet, so, als wollte sie ihren Schöpfer bitten, ein grausiges Verbrechen ungeschehen zu machen.
1. Kapitel
Der gesamte Ort war in Aufruhr. Die Diskussionen erhitzen die Gemüter an jeder Straßenecke, in den Familien, den Läden und Gaststätten und der Salon von Friseur Bruno Biewer im Ortszentrum schien seit Neuestem mehr denn je als Kommunikationszentrum zu florieren.
Auch im Hochwaldstübchen war der Geräuschpegel seit einigen Tagen um ein Mehrfaches angestiegen. Die Gäste, die in der Gemeinde Forstenau den Tourismus belebten, zogen in Anbetracht der dunklen Wolken, deren Ursache sie nicht einschätzen konnten, die Köpfe ein, als befürchteten sie, ein Unwetter wolle mit aller Vehemenz über sie hereinbrechen.
Einer jedoch hatte an der Ursache der Diskussionen am schwersten zu kauen. Es war Pastor Adalbert Schaeflein, über dessen breitkrempigem Hut man förmlich eine schwarze Zorneswolke wahrnehmen konnte, die den Gottesmann auf Schritt und Tritt zu begleiten schien.
Mit hochrotem und gesenktem Kopf stieg er schwer atmend die wenigen Stufen zum Hochwaldstübchen hinauf, öffnete die Tür und sogleich empfing ihn ein Schwall von Bierdunst und Zigarettenrauch.
Obwohl seit geraumer Zeit ein Rauchverbot für öffentliche Einrichtungen bestand, wovon die Gaststätten nicht ausgenommen waren, hatte man den kleineren Kneipen übergangsweise weiterhin gestattet, diese Regelung für sich zu ignorieren. Während die Besucher größerer Lokalitäten wie Restaurants und Hotelhallen ihren Lastern entweder in speziell angelegten Raucher-Räumen frönen mussten oder vor das entsprechende Anwesen verbannt wurden.
Schaeflein verfiel nahezu in einen Hustenkrampf und sein voluminöser Bauch unter der schwarzen Soutane, die er heute ausnahmsweise für den Gaststättenbesuch nicht abgelegt hatte, wippte auf und nieder und er musste seinen Hut festhalten, damit er ihm nicht vom Kopf fiele.
Während seine Augen den Gastraum abtasteten, der ihm heute irgendwie anders als sonst vorkam, bemerkte er aus den Augenwinkeln, dass am Stammtisch bereits zwei seiner Stammtischbrüder saßen. Sie hatten ihn offensichtlich erblickt, denn sie winkten zu ihm herüber, um sich ihm bemerkbar zu machen.
Die Tische auf der linken Seite des Raumes - es waren ihrer gerade mal fünf an der Zahl mit jeweils vier Sitzplätzen - waren ausnahmslos besetzt. Von Leuten aus dem Ort, aber auch von Personen, die derzeit ihren Urlaub in der Region verbrachten und im Hochwaldstübchen eine Kleinigkeit aßen.
Eine der Spezialitäten lockte die Gäste dabei besonders an. Es waren in einer kräftigen Gewürzsoße eingelegte Hähnchenflügel, die, in einer Fritteuse mehrere Minuten knusprig gegart, den Gaumen erfreuten und die Gäste immer wieder gerade zum Genuss dieser Köstlichkeit anlockten.
Schaeflein kämpfte sich durch den schon fast beißenden Smog hindurch zum Stammtisch, dessen Mitglied er seit Jahren war, und erkannte schließlich die vom Rauch umwölkten Personen, die sich dort niedergelassen hatten. Es waren Dieter Lauheim und Florian Glasheber, die heftig miteinander diskutierten.
Letzteren erkannte Schaeflein nicht sofort, denn der Förster hatte sich seit Neuestem einen grau melierten Vollbart wachsen lassen, der sich mit seiner vollen Dichte von dem rötlichen, runden Gesicht abhob und eine gleichfarbige Einheit mit seinem Kopfhaar bildete.
Hinter der Theke, an der sich einige Männer angestellt hatten, die keinen Sitzplatz mehr hatten erhaschen können und dort ihr Bier tranken, arbeiteten Siggi, der Wirt, und seine bessere Hälfte Lissy fieberhaft.
Siggi hatte eigentlich nur eine Aufgabe zu erfüllen. Er musste in der Küche dafür sorgen, dass die Hähnchenflügel knusprig gegart und nicht etwa zu roh waren oder gar in der Außenhaut zu trocken wurden. Genauer gesagt, er musste den richtigen Moment abpassen und dann die fertigen Teile mit einem Sieb herausfischen und abtropfen lassen, um sie auf den Tellern zu verteilen und mit zwei oder drei Scheiben Brot, je nach Größe des Laibes und einigen Papierservietten zu garnieren. Dazu gab es noch ein Erfrischungstuch zum späteren Reinigen der fettigen Finger.
Ab und zu fuhr er sich mit einem riesigen Taschentuch, dessen Zipfel aus seiner Hosentasche lugte, so dass er nur zuzugreifen brauchte, über seine feuchte Stirn und das inzwischen lichte, aber immer noch dunkle Haupthaar.
Obwohl Siggi und Lissy ihr Leben fast ausschließlich in der Gaststätte verbracht hatten und ständig auf den Beinen waren, hatten sie sich selten eine Bedienung zugelegt. Sie waren über sechzig und ihr einziges Töchterlein war auf die schiefe Bahn gekommen und hatte sich in Frankfurt den „goldenen Schuss“ gesetzt, weil es für sich keinen Ausweg mehr gesehen hatte.
Siggi hatte seine Rache gehabt und dem Schuldigen, dem Zuhälter Wilhelm Rietmaier, mit einem Sammler-Schwert schwere Wunden zugefügt. Doch Rietmaier war nicht an den Folgen dieser Verletzungen gestorben. Ermordet hatte ihn im Anschluss an seine Tat ein anderer und Siggi saß nur eine kurze Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung ab.
Doch dann ereilte ihn ein Herzinfarkt und seit diesem Tag war er nicht mehr derselbe. Er verließ kaum noch das Hochwaldstübchen, wo er auch Mitglied des Stammtisches war. Doch wenn, gerade wie jetzt, die Bude gerammelt voll war, dann hatte er für seine Freunde keine Zeit. Dann musste er sich um das Essen kümmern. Geschäft ist nun mal Geschäft.
Lissy zapfte derweil mit hochgestecktem Haar hinter der Theke ein Glas Bier nach dem anderen, spülte zwischendurch Gläser und räumte die leeren Teller von den Tischen ihrer zufriedenen Gäste.
Obwohl sie den ganzen Abend hinter der Theke verbrachte und auch noch die Gäste bediente, blieb ihre weiße Schürze immer sauber.
Die Ursache konnte nur ein stiller Beobachter erkennen, denn Lissy wechselte die Schürze, sobald sie begann unansehnlich zu werden. Gerade diese Reinlichkeit liebten die Gäste an ihr und dass es in der Küche ebenso sauber zuging, daran zweifelte niemand.
Es war gerade mal acht Uhr abends und wäre da nicht dieser Stammtisch gewesen, den Lissy - geschehe was wolle - für Schaeflein und die restlichen Stammtischbrüder verteidigte, der Pastor hätte gerade noch einen Stehplatz an der Theke erhaschen können und wäre anzüglichen Fragen und den üblichen kleinen Foppereien der Runden trinkenden Männer ausgeliefert gewesen.
Nicht hilflos, beileibe nicht! Schaeflein wusste sich wohl zu wehren und in den meisten Fällen machten seine Kontrahenten bereits nach kurzer Zeit einen Rückzug aus ihren verbalen Ergüssen.
Schaeflein steuerte auf den Stammtisch zu. Dieter Lauheim und Florian Glasheber unterbrachen ihre angeregte Unterhaltung kurz durch eine grüßende Handbewegung gegenüber dem Pfarrer.
Schaeflein erkannte die Situation sofort.
Lauheim als Kulturbeauftragter des Landkreises und einer, den alles Kulturelle und Politische in seiner Umgebung interessierte, hatte Glasheber offensichtlich einiges mitzuteilen und dessen zufriedener Gesichtsausdruck und die Tatsache, dass er sich kaum zu Wort meldete, bewies dem Pastor, dass der Wolf sein Opfer gefunden hatte.
Schaeflein wählte den Platz neben Lauheim, obwohl die Sitzordnung des Stammtisches einem festen Ritual unterlag und sein offizieller Platz einen freien Stuhl zwischen ihm und Lauheim hätte belassen müssen.
Aber auch er war gespannt auf das, was Lauheim zu berichten hatte. Nicht, dass es für ihn etwas völlig Neues sein würde, was er hier und heute zu erfahren imstande war, beileibe nicht. Er wusste schon, was neuerdings in der Gemeinde die Gemüter bewegte, doch hoffte er, dass sich am Stammtisch dieses Bild abrunden würde.
„Was sagen Sie dazu, Herr Pfarrer?“
Lauheim drehte sich zu dem Geistlichen, wobei er mit seinem Stuhl etwas vom Tisch abrücken musste, um seinem stattlichen Bauch den erforderlichen Platz zu gewähren und beendete damit abrupt das Gespräch mit Glasheber, der sich nun seinerseits nach vorne über den Tisch beugen und den Kopf näher an die beiden bringen musste, in der Erwartung, noch einmal das anzuhören, was ihm Lauheim in den vergangenen Minuten groß und breit erläutert hatte.
Glasheber, seines Zeichens Förster in der Gemeinde, teilte sich seine beruflichen Aufgaben mit seinem Kollegen Uwe Marek, jedoch so, dass sich die beiden nicht ins Gehege kamen. Zu unterschiedlich waren ihre Ressorts und die Vielfalt des Hunsrücker Hochwalds nahm ihnen beiden die Möglichkeit, irgendeinem Kompetenzgerangel ausgesetzt zu sein.
Schaeflein nickte mit verkniffenen Lippen und wollte gerade eine entsprechende Antwort geben, als Lauheim auch schon zum Weitersprechen anhub.
Schaeflein sah, dass Lauheim vor Wissen nahezu explodierte, dass er es an den Mann bringen musste und verkniff sich deshalb weitere Fragen. Was er wissen wollte, das würde er erfahren. Hier und heute. An diesem Stammtisch.
Er würde es gleich mehrfach erfahren, denn bislang waren sie nur zu dritt. Es fehlten Ortsbürgermeister Detlef Hildebrandt, Feuerwehrchef Siegfried Brandel, der Kriminalbeamte Heiner Spürmann und Siggi, der Wirt, auf dessen Anwesenheit man heute Abend in Anbetracht des regen Publikumsverkehrs würde verzichten müssen.
Wenn also die Genannten nicht mit einem Male, sondern jeder für sich, einzeln, im Hochwaldstübchen erscheinen würden, dann konnte er die Rede von Lauheim am späten Abend auswendig aufsagen, dessen war sich Schaeflein sicher.
„Ich verstehe nicht, dass die Gemeindeväter so etwas zugelassen haben!“, entschloss sich Schaeflein dann doch, die Richtung der Diskussion zu bestimmen und verhinderte damit weitere Ergüsse von Lauheim.
„Wie kann man in einer Gemeinde wie der unseren so etwas zulassen? Man hätte doch voraussehen können, dass eine solche Entscheidung für die Zukunft von Forstenau ungeahnte Folgen haben kann. Lauheim, Sie sind doch Mitglied dieses Gemeinderates. Waren Sie nicht in der Lage, so etwas zu verhindern?“
„Na hören Sie mal!“
Lauheim sah empört von einem zum anderen. Das Rot der Aufregung in seinem Gesicht stach ab von den silbernen gewellten Haaren.
„Ich war nur als einer von vielen in den Entscheidungsprozess eingebunden. Ein Einzelner zählt da nicht. Schließlich war es ein Mehrheitsentscheid. Demokratie nennt man so etwas hier in diesem unseren Lande.“
Schaeflein überhörte die Bemerkung. „Ein sehr knapper Entscheid, wie ich hörte.“ Schaeflein schüttelte verständnislos den Kopf und sein volles rundes Gesicht nahm eine rosige Farbe an, die sich über den teils kahlen Kopf nach hinten verbreitete.
„Richtig“, fuhr Lauheim fort. „Es war eine knappe Entscheidung. Eine knappe demokratische Entscheidung.“
„Die meines Erachtens nicht ausreichend überdacht wurde. Sie sind doch alle erwachsene Menschen, Sie müssen sich doch über die Folgen im Klaren sein! Auch das gehört zu einer Demokratie. Abwägen einer Entscheidung.“
„Welche Folgen meinen Sie? Gut, Sie als Kirchenmann haben da Ihre Bedenken, aber sonst …“
„Was soll das heißen: Aber sonst…? Ach, lassen wir das!“, Schaeflein machte eine abwertende Handbewegung. „Erzählen Sie uns lieber einmal in allen Einzelheiten, was uns hier in Forstenau erwartet!“
Glasheber hatte bis zu diesem Zeitpunkt kein Wort gesagt, sondern die Unterhaltung, besser gesagt den kleinen Disput, aufmerksam verfolgt, ab und zu mit der Hand durch die angegrauten welligen, nach hinten gekämmten Haare streichend. Gerade als er dem Mund öffnen wollte, um seinen Teil an dem Gespräch beizutragen, öffnete sich die Tür der Gaststätte und Detlef Hildebrandt, seines Zeichens Ortsbürgermeister und Siegfried Brandel, Chef der örtlichen Feuerwehr, steuerten auf den Stammtisch zu.
„Kann mal jemand ein Fenster öffnen?“, rief Hildebrandt Lissy hinter der Theke im Vorbeigehen zu und die Bemerkung „Wird Zeit, dass auch in den kleinen Kneipen das Rauchverbot eingeführt wird!“, lenkte mit einem Schlag vielsagende Blicke eines Teils der Thekensteher, die genüsslich an ihren Glimmstängeln saugten, auf ihn.
„Er kann Ihnen genau sagen, was Sie wissen wollen!“
Lauheim zeigte auf Hildebrandt und schien selbst mit einem Mal kein Interesse mehr an der Weitergabe von Informationen zu haben.
„Ich habe dagegen gestimmt, damit Sie `s wissen!“, brummte Hildebrandt, während er sich auf einen freien Stuhl niederließ, der ebenfalls nicht derjenige war, der seit Monaten für ihn vorgesehen war. Angesichts der Neuigkeit, die offensichtlich das ganze Dorf bewegte, schien die Sitzordnung am Stammtisch im Hochwaldstübchen ihre Wichtigkeit verloren zu haben.
Der Gemeindechef streifte im Sitzen sein Jackett aus und hängte es hinter sich über der Stuhllehne auf. Hildebrandt wirkte abgemagert, als er hemdsärmelig da saß, sein ohnehin schmales Gesicht offenbarte ein paar Sorgenfalten. Seine Frau Margarethe saß immer noch im Gefängnis, denn sie war es, die dem Zuhälter Rietmaier einen tödlichen Stoß mit einem seiner eigenen Schwerter versetzt hatte. Man hatte ihr mildernde Umstände zugesprochen, denn auch sie war von ihrem Opfer misshandelt und vergewaltigt worden.
Hildebrandt krempelte seine Hemdsärmel bis zu den Ellbogen hoch und schaute zu Lissy hinüber, die ihm zunickte und kurz darauf ein Bier servierte.
„Also, kann mir endlich einer genauestens sagen, worum es geht! Stimmen die Gerüchte oder ist es nur heiße Luft? Und wenn es stimmt, verdammt noch mal, dann möchte ich wissen, wie so etwas passieren konnte!“, ereiferte sich Schaeflein, um sich gleich darauf mit Blick zur Zimmerdecke zu bekreuzigen.
„Entschuldigung, ist aber doch wahr! Da kommt eine Gefahr auf uns zu, der vielleicht einige meiner Schäflein nicht widerstehen können“, flüsterte er, so leise, dass keiner seiner Stammtischbrüder es hören konnte. „Wenn du uns jetzt nicht hilfst, dann werden wir beide eine schwere Zeit vor uns haben!“
2. Kapitel
Es war ein langer Tag gewesen heute. Für mich und für Leni. Wir waren den ganzen Tag auf den Beinen und hatten unser Büro erst am Abend wiedergesehen, als wir uns entschlossen, den Dienst für heute zu beenden und die weiteren Ermittlungen auf den kommenden Tag zu verschieben.
Es war kein Mord, kein Totschlag, kein Gewaltverbrechen, das uns den ganzen Tag über in Anspruch genommen hatte. Nein, es waren Taten, von denen man glaubte, dass sie mit Beginn des deutschen Wirtschaftswunders ausgestorben seien. Es handelte sich schlicht und ergreifend um einfache Wildereien im Hunsrück, genauer gesagt im Schwarzwälder Hochwald, im südwestlichen Teil des Hunsrücks, dem Grenzbereich des nördlichen Saarlands zu Rheinland-Pfalz.
Ein Jagdpächter mit Heimatwohnsitz in der Schweiz hatte hier einen großen Jagdbezirk gepachtet und auf einem seiner Pirschgänge Wildaufbrüche gefunden, worüber er sehr erbost war und woraufhin er sich vornahm, den Frevler selbst zu stellen. Doch als er in den folgenden Tagen weitere drei Aufbrüche jungen Rehwilds vorfand, schaltete er die Polizei ein und Leni und ich wurden mit der Angelegenheit beauftragt.
Es muss eben nicht immer Mord sein und wenn es in dieser Hinsicht ruhig blieb, hatte auch uns der Alltag mit seinen „normalen“ Straftaten wieder. Auch wenn wir nicht unbedingt zuständig für diese Art von Freveln waren, wenn es erforderlich wurde, unterstützten wir die schwach besetzten Ressorts, denn Polizisten waren wir nun mal alle.
Die Ermittlungen hatten uns jedoch kaum weitergebracht. Diverse Reifen- und Schleifspuren, die noch ausgewertet werden mussten, hatten wir gesichert, aber einen Verdacht in eine bestimmte Richtung gab es nicht. Der oder die Täter konnten aus dem Saarland, genauso gut aber auch aus Rheinland-Pfalz kommen. Der Schwarzwälder Hochwald bot auf Grund der Nähe der Landesgrenze die Möglichkeit für beide Bundesländer.
Leni war anschließend mit ihrer neuen Kawa in ihre Wohnung gefahren, nicht ohne mich noch einmal daran zu erinnern, mich in Forstenau nach einer Wohnung für sie umzusehen. Sie war nach wie vor fest entschlossen, sich auf dem Lande niederzulassen, was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass wir bei der Bildung einer Mordkommission stets als Team zusammenarbeiteten. Als Team unter einem neuen Chef. Das hatte seinen Grund.
Kriminaldirektor Willibald Wittenstein hatte die Brocken hingeworfen, denn seine Gesundheit, nein, anders gesagt, seine Krankheit, das Asthma, das schon chronisch geworden war, hatte ihm keine andere Wahl gelassen. Und der Neue? Kriminalrat Peter Krauss? Na ja. Gewöhnungsbedürftig, glaube ich, war die richtige Bezeichnung. Wenig Praxis und das Bestreben, seine Bildung in jeder freien Minute zu erweitern. Genauer gesagt war es so, dass er ein Fremdwort-Fetischist war und bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihm unbekannte Fremdworte aus Zeitungen und Illustrierten notierte, um sie dann mithilfe eines Fremdwort-Lexikons zu entschlüsseln und auswendig zu lernen.
Diese Leidenschaft hatte sich schnell herumgesprochen und so war es kaum verwunderlich, dass man ihn schon nach kurzer Zeit aufs Glatteis führte.
Zwei Kollegen, die für ihren Schalk bekannt waren, begannen beim Herannahen ihres Chefs eine Diskussion, die damit endete, dass einer der beiden sagte: „Nein, nein, mein Lieber, das finde ich doch sehr homophiktisch!“
Damit beendeten sie ihre Diskussion und wandten sich wieder ihrer Arbeit zu. Krauss aber suchte sofort sein Büro auf und die beiden Kollegen, die durch den Türspalt mit ansahen, wie Krauss in seinem Lexikon blätterte, konnten ihr Lachen kaum zurückhalten.
Als ich vom Polizeipräsidium in Trier wegfuhr war es kurz nach zwanzig Uhr. Ich nahm mir vor, mir im Hochwaldstübchen in Forstenau noch ein Bier zum Abschluss zu genehmigen und den Abend mit hoffentlich anwesenden Stammtischbrüdern ausklingen zu lassen. Ich brauchte das heute nach den anstrengenden Exkursionen im Wald, der Suche nach dem für diesen Fachbereich zuständigen Förster, der nicht greifbar war, weil er als Ausbilder für Schweißhundeführer irgendwo in Deutschland im Einsatz war. Wenn es um diese Art von Hunden ging, wartete Förster Hans Reinhard mit großem Wissen auf. Das konnte man dann auch in entsprechender Literatur nachlesen, denn Reinhard bewies als Autor von einschlägigen Fachbüchern ausdrücklich seine Kompetenz.
Die Fensterscheiben des Hochwaldstübchens waren so stark beschlagen, dass es von außen keine Hoffnung auf eine Sicht nach innen gab. Entsprechend musste der Betrieb im Lokal sein. Ich war gespannt, wen ich von meinen Stammtischbrüdern antreffen würde und öffnete die Tür, um sogleich von einer Wolke aus Tabaksmog, Alkoholduft und Fritten-Fett empfangen zu werden.
Die Bude war krachend voll, das hatte ich lange nicht mehr erlebt. Und sogar der Stammtisch war komplett, bis auf Siggi, den ich in der Küche vermutete. Hatte ich etwas verpasst? Geschah hier etwas, das ich hätte wissen müssen?
„Dann sind Sie aber der einzige Ahnungslose hier im Ort“, legte Glasheber los, als ich die bescheidene Frage nach einem eventuellen besonderen Ereignis stellte.
„Und ob etwas los ist hier in Forstenau, kann man doch so sagen, oder nicht, Herr Pastor?“, warf er mir die für mich unverständliche Bemerkung mit einem Blick auf Schaeflein zu.
„Kommen Sie! Setzen Sie sich zu uns! Da müssen wir doch etwas unternehmen!“
Ich verstand überhaupt nichts.
„Das kommt davon, wenn man dienstlich den ganzen Tag auf den Beinen ist und nach Dienstschluss sofort nach Hause fährt, um die Beziehung nicht zu gefährden“, dachte ich und setzte mich auf den freien Platz neben den Pastor.
„Also, für diejenigen, die es noch nicht wissen, sage ich es jetzt noch einmal, in aller Ruhe zum Mitschreiben und hoffe, dass keine falschen Behauptungen nach außen getragen werden!“, begann Ortsbürgermeister Hildebrandt und fuhr sich durch seine dunklen kurz geschnittenen Haare über dem jugendlichen Gesicht.
Mit 34 Jahren war er zum Dorfoberhaupt gewählt worden, das war jetzt fünf Jahre her. Eine Wiederwahl stand in Kürze an, wenn … ja, wenn er nicht den Unmut der Gemeinde auf sich zöge. Und die Gefahr bestand durchaus und da spielte es auch keine Rolle, wie er in fragwürdigen Angelegenheiten persönlich abgestimmt hatte. Ein weiterer Aspekt sprach gegen eine Wiederwahl. Seine Ehefrau Margarethe saß wegen Totschlags im Gefängnis und würde dort noch einige Zeit verweilen müssen. Hildebrandt blickte von einem zum anderen in die Runde.
„Jeder von Ihnen kennt die ehemalige Fuchsfarm hinter der Diskothek, auf dem Weg zum Segelflugplatz, oder?“
Allgemeines Nicken und Glasheber, aber auch Lauheim, waren in ihren Oberkörpern ein wenig nach vorne übergeknickt, um ja kein Wort zu verpassen. Auch sonst war es plötzlich still am Stammtisch geworden.
„Bis in die fünfziger Jahre wurden dort noch Silberfüchse für die Pelzindustrie gezüchtet“, fuhr Detlef Hildebrandt fort. „Danach stand das Anwesen einige Zeit leer, wurde schließlich mehrere Jahre an die verschiedensten Leute vermietet, bis es endlich wieder ohne Bewohner war. Als sich in den Jahren danach niemand mehr für das Anwesen interessierte, hat die Ortsgemeinde das Haus mit dem Land drum herum erworben. Der Gemeinderat spielte mit dem Gedanken, dort ein Freizeitgelände zu errichten. Unmittelbar am Waldrand, mit dem Segelflugplatz in der Nähe und vor allem der Ruhe, die dort herrschte, war das doch eine gute Idee, das müssen Sie alle zugeben!“
„Bis dann vor einigen Jahren die Diskothek in unmittelbarer Nähe errichtet wurde“, warf Lauheim ein.
„Genau! Und seit diesem Zeitpunkt war das Gelände für uns als Gemeinde uninteressant geworden und wir suchten händeringend nach einem Käufer.“
„Und den haben Sie ja nun gefunden!“
Schaeflein beugte sich nach vorne, soweit es sein dicker Bauch zuließ und sah Hildebrandt direkt ins Gesicht.
„Dabei haben Sie nur an das Geld gedacht, nicht aber an die Folgen, die dieses für die Gemeinde offensichtlich lukrative Geschäft hinterlassen wird.“
„Kann mir mal einer sagen, worum es eigentlich geht?“, meldete ich mich nun auch zu Wort und erhielt vorerst einmal keine Antwort, weil Lissy eine Runde Bier brachte und die Gläser nacheinander vor uns abstellte.
Ich roch das Frittenfett in ihren Kleidern und sah das vor Anstrengung glänzende Gesicht. Lissy tat mir irgendwie leid. Sie hatte hier alles im Griff, aber sie war nicht mehr so stark wie noch vor einigen Jahren. Seit dem Tod ihrer Tochter war das Hochwaldstübchen ihr einziger Wirkungskreis. Sie brauchten beide Abwechslung, sie und ihr Siggi.
„Ich bin dabei, es zu erklären“, riss mich Hildebrandt aus meinen Gedanken. Nachdem er einen Schluck genommen hatte, wischte er sich einen Rest Schaum vom Mund, ehe er weitersprach.
„Und ich betone noch einmal, dass die Transaktion an den Käufer von uns gut überlegt und heiß diskutiert wurde. Das sehen Sie auch an dem knappen Abstimmungsergebnis im Rat ...!“
„Das uns aber auch nicht weiterhilft!“
Schaeflein begann sich zu ereifern und hatte offensichtlich nicht vor, Hildebrandt noch einmal zu Wort kommen zu lassen.
„Meine Herren, um es kurz zu sagen: Die Gemeindeväter haben das Anwesen an eine Sekte verkauft. An eine Glaubensgemeinschaft, die in diesem Ort und über seine Grenzen hinaus nichts Gutes im Schilde führen wird, davon können Sie ausgehen!“
„Eine Sekte?“
Ich glaubte, nicht richtig zu hören.
„Eine Sekte? Na und? Was ist das Schlimme dabei. Jedem Tierchen sein Plaisierchen und jedem Menschen seine Glaubensrichtung. Gehen Sie doch mal in die Städte! Jede Menge religiöser Gemeinschaften. Katholische und evangelische Kirchen, Muslime werden ihre Moscheen mit Minaretten bauen. Na und? Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals zu Problemen gekommen ist.“
„Das ist die Stadt, Spürmann! Die Stadt! Aber wir leben hier in der Provinz!“
Schaeflein war außer sich. „Es wird zu Abwerbungen von Mitgliedern unserer Pfarrei kommen und es wird familiäre Probleme geben. Wenn die jemanden in ihren Fängen haben! Scientology! Ich sage nur: Scientology! Gehirnwäsche und so. Wer einmal in deren Krallen hängt, für den gibt es kein Zurück mehr! Wir haben seit Bestehen dieses Ortes unsere Religion. So soll es auch bleiben! Du sollst keine fremden Götter neben mir haben, spricht der Herr!“
„So schlimm wird es schon nicht sein. Irgendwo verehren doch alle Glaubensgemeinschaften den gleichen Gott“, gab ich einen vorsichtigen Einwand und erntete einen strafenden Blick.
„Und wir wissen doch nicht einmal, was da auf uns zukommt“, fuhr ich fort. „Ist es eine Sekte? Ist es eine Glaubensgemeinschaft? Das ist doch ein großer Unterschied.“
„Auf geradem Weg zu Gott!“
Glasheber hatte es mit Blick auf sein Weizenbierglas vor sich hin gesagt.
„Ja, so sollte es sein. Auf geradem Weg zu Gott!“ Schaeflein atmete schwer. „Aber …!“
„So nennt sich diese Sekte. Auf geradem Weg zu Gott. Klingt doch sehr religiös“, ließ sich Lauheim kleinlaut vernehmen. „Man sollte nicht voreingenommen sein!“
„Ich weiß auch nicht, worüber wir uns hier aufregen!“ Hildebrandt trank den letzten Schluck aus seinem Bierglas und stand auf. „Es ist doch eh alles unter Dach und Fach. Sie werden sehen: Viel Lärm um nichts! Ich muss weg. Habe noch einen Termin. Einen Todesfall, Sie verstehen.“
Wir verstanden. Inzwischen hatte Hildebrandt seinen Job als Leichenbestatter zum Hauptberuf gemacht und hatte alle Hände voll zu tun in Forstenau, aber auch in den Nachbargemeinden, denn gestorben wird ja bekanntlich immer. Mit der Art seines Stresses hatten sich die Gremien, die mit ihm zusammenarbeiteten, längst abgefunden. Sie wussten, dass er meist zu spät zu den Treffen kam und auch, dass er dieselben meist vorzeitig verlassen musste. Versuchte er dann doch einmal pünktlich zu sein, waren es Anrufe auf seinem Mobiltelefon, die für seinen vorzeitigen Abgang sorgten.
Auch Schaeflein erhob sich und legte einen Geldschein auf den Tisch.
„Ignoranten! Alles Ignoranten. Sie werden noch an mich denken, aber dann wird es zu spät sein!“, wetterte er im Hinausgehen und ich bildete mir tatsächlich ein, eine dunkle Zorneswolke über seinem Hut feststellen zu können, die ihn auf seinem Weg nach draußen begleitete.
Ich nahm mir vor, in den nächsten Tagen das Haus dieser Sekte aus entsprechender Distanz einmal in Augenschein zu nehmen, aber mehr auch nicht, ganz privat. Schließlich war die Existenz anderer Glaubensgemeinschaften als der gewohnten nicht strafbar und solange sie nicht gegen das Gesetz verstießen, waren ihre Anhänger harmlose Bürger wie alle anderen auch.
Lisa, meine Lebensgefährtin, hatte heute Kirchenchorprobe und mir deshalb einen Zettel mit einer Nachricht hinterlassen.
Seit dem Vorfall in Bad Sobernheim mit ihrer Freundin Christine war sie ängstlicher geworden und ließ mich stets wissen, wo sie erreichbar war.
Weder sie noch Christine hatten sich so richtig von dem erlittenen Schock erholt, als ihre Freundin fast Opfer einer illegalen Organhandel-Bande geworden war. In letzter Minute konnten wir sie aus den Fängen der Verbrecher befreien und den gesamten Ring sprengen. Ich war kaum zu Hause und hatte die Beine auf der Couch hochgelegt, da war ich auch schon eingeschlafen. Irgendwann weckte mich Lisa. Sie trug ihr dunkelblondes langes Haar heute offen, und als sie mich küsste, vereinnahmte ihre Haarpracht mein Gesichtsfeld komplett.
Widerstandslos ließ ich mich von Lisa ins Schlafzimmer führen und entschwand, kaum lag ich im Bett, mit einer geflüsterten Entschuldigung ins Reich der Träume.
3. Kapitel
Es war Samstag, kurz vor 9 Uhr. Lisa und ich hatten endlich mal wieder so richtig ausschlafen können, was an den Wochenenden schon lange nicht mehr der Fall gewesen war. Ich hatte mich an diesem Morgen sogar aufgerappelt, war in die Küche geschlichen, während Lisa noch schlief und hatte Frühstück gemacht.
Während der Kaffee in der Maschine vor sich hin brabbelte suchte ich Brot, Butter und die üblichen Dinge zusammen, die ein Frühstück ausmachten und stellte zwei Frühstücks-Eier zum Kochen auf den Herd auf.
Ein paar Minuten später erfüllte Kaffeeduft die gesamte Wohnung. Ein herrlicher Geruch, den ich allzu selten in meinen eigenen vier Wänden wahrnehmen konnte. Immer wieder kam irgendetwas dazwischen, so dass ich meist, mit der Tasse in der linken, einer Scheibe Brot in der rechten Hand und auf dem Sprung, an irgendeinem Tatort erwartet wurde.
Heute fühlte ich mich wie ein König. Bei Lisa konnte ich Punkte sammeln. Ein Frühstück im Bett, dafür würde sie eines ihrer schönsten Paar Schuhe hergeben. Heute schien es zu funktionieren. Auch ich war erleichtert. Endlich mal wieder ein Wochenende, an dem ich mit Lisa etwas unternehmen konnte.
Ich schnappte mir das Tablett mit dem Frühstück für zwei und wollte gerade mit vor Stolz gewölbter Brust Lisa im Schlafzimmer als treusorgender Fast-Ehemann meine Aufwartung machen, da läutete die Türklingel.
Erstaunt sah ich erst auf Lisa, dann auf meine Uhr und mit einem Schulterzucken warf ich mir den Morgenmantel um und öffnete die Haustür. Ich zwinkerte mit den Augen, denn die Junisonne schlug mir voll auf die Pupillen. Warum das so war, stellte ich fest, nachdem sich meine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten.
Vor mir standen zwei Gestalten männlichen Geschlechts, beide in schneeweiße Anzüge gehüllt. Anzüge war eigentlich nicht der richtige Ausdruck für die Kleidungsstücke. Ich schaute mir die beiden Gestalten näher an, musste dabei die Augen immer noch zur Hälfte geschlossen halten. Da standen zwei Figuren vor mir, von denen ich annahm, dass es sich um Männer handelte. Beide waren um die fünfzig, schätzte ich jedenfalls, beide waren glattrasiert, beide waren braun gebrannt.
Urlauber! Ja, Urlauber, die ihre Zeit hier im Hunsrück verbringen wollten, Ausländer offenbar. Vielleicht Inder oder so. Dafür würden auch die Kleidungsstücke sprechen. Weiß, alles weiß. Schneeweiß. Weiß die Hose, weiß die Schuhe, weiß das, was sie darüber trugen. Es waren keine Jacketts, es waren Umhänge oder Pelerinen, ohne Knöpfe, ohne Reißverschlüsse, einfach Umhänge mit einem Loch, durch das man den Kopf steckte, ärmellos. Darunter trugen sie Hemden mit langen Ärmeln, die Kragen hatten beide über die Öffnung am Hals gelegt. Auf ihren Köpfen trugen sie kleine Kappen, ähnlich wie Matrosen sie trugen, jedoch ohne die beiden Bändchen an der Nackenseite und … wie konnte es anders sein … natürlich in Weiß.
Was nicht zu ihnen passte, waren die beiden Plastiktüten, die sie, jeder eine, in ihren Händen hielten.
Sie wollten mich sicher nach dem Weg fragen, nach irgendeinem Hotel hier in Forstenau, die beiden Urlauber. Ob ich sie in Englisch anreden sollte, überlegte ich, doch der eine von ihnen, ich glaube er war etwas älter als der andere, zumindest waren die Falten seiner durch die Sonne gegerbten Haut einen Deut tiefer, kam mir zuvor.
„Auf geradem Weg zu Gott!“
„Wie bitte?“
„Auf geradem Weg zu Gott! So nennen wir uns“, wiederholte der Mann, der von großer Statur war. Er trug einen Zopf, in den seine schwarzen langen Haare gefasst waren.
„Wie ich sehe, haben Sie noch nichts von unserer Existenz mitbekommen. Aber genau das ist ja auch der Grund, warum wir uns den Menschen hier in diesem schönen … äh Ort vorstellen. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft. Auf geradem Weg zu Gott lautet unsere Devise und das ist auch gleichzeitig der Name unserer Kirche.“
„Dann gehören Sie also der Sekte an, über die …?“
Nun schaltete sich auch der zweite Mann in das Gespräch ein. Er war ein gutes Stück kleiner als sein Kollege und der Kopf mit seiner Hakennase nickte auf- und abwärts, als wolle er mich damit gleich einem Schnabel anhacken, als er sagte: „Sekte? Wer sagt denn sowas? Nein, wir sind eine, mein Bruder sagte es bereits, Glaubensgemeinschaft. Dürfen wir uns mit Ihnen unterhalten? Wenn sie ein paar Minuten Zeit für uns hätten.“
Nun war es an der Zeit, mich gegen eine ungewollte Missionierung zur Wehr zu setzen. Und auch dagegen, dass mir die beiden irgendwelchen Schriftkram in die Hand drückten, denn der Lange mit dem Zopf griff in seine Plastiktüte und förderte eine Lage Zeitschriften zutage.
„Es tut mir furchtbar leid, aber wir müssen das Gespräch leider beenden“, sagte ich schnell, bewusst Hektik verbreitend. „Religion an der Haustür, das liegt mir nicht …“
„Dürfen wir denn hereinkommen …?“
„… und außerdem ist das ein äußerst ungelegener Moment. Sie entschuldigen mich.“
Ich schloss langsam die Tür, den Blick auf den Fuß des Hakennasigen gerichtet, der sich langsam in Richtung des Türspalts geschoben hatte. Doch mein Gegenüber hatte meinen Blick richtig gedeutet und sein Bein wieder entspannt, was ihm einige Schmerzen in der Kniegegend ersparte.
Ich atmete durch, als ich die Tür ins Schloss fallen hörte und war gerade im Begriff die Treppe zur Diele hochzugehen, als ich ein sattes Platschen hinter mir vernahm.
Ich wusste was es war, noch ehe ich mich umgedreht hatte. Mein Verdacht fand sich bestätigt. Unter dem Briefkastenschlitz lag eine Zeitschrift, die Vorderseite in einem satten Himmelblau, auf dem sich ein Arm diagonal nach oben richtete und mit dem Finger – Gott sei Dank nicht mit der flachen Hand - gen Himmel zeigte und mir fett in einem tiefen Blau Auf geradem Weg zu Gott zuschrie.
Ich nahm die Zeitschrift vom Boden auf und als ich die Küche betrat, war Lisa bereits dabei, den Kaffeetisch zu decken. Das Frühstück im Bett hatte also ein jähes Ende gefunden, noch ehe es begonnen hatte. Sie trug ihre Haare, die sie für gewöhnlich zu einem Knoten zusammenband, noch offen. Ich liebte es, wenn ihr die Haare ins Gesicht fielen und sie eine Strähne mit einem kräftigen Luftstrom ihrer zusammengepressten Lippen nach hinten blies.
„Wer war das?“, fragte Lisa und arbeitete weiter und ich wusste nicht, ob es sie tatsächlich interessierte. Erst als sie mich fragend ansah erklärte ich ihr den morgendlichen Besuch an der Haustür.
„Ist aber ein komischer Name, Auf geradem Weg zu Gott. Aber Phantasie haben sie ja, diese Leute.“
Lisa zeigte auf das Titelblatt der Zeitschrift.
„Der Arm dort soll sicher diesen ‚Weg‘ zeigen.“
Dann wechselte sie plötzlich das Thema und ab diesem Moment war der Tag für uns beide stimmungsmäßig gelaufen.
„Was findest du besser, soll ich meine Haare zu einem Knoten binden oder soll ich sie offen tragen, oder vielleicht zu einem Pferdeschwanz fassen? Was meinst du?“, fragte Lisa und tat weiterhin beschäftigt.
Wer die Frauen kennt, der weiß, dass sie in einer solchen Situation nur auf eine Antwort lauern und zwar auf eine baldige. Mit dem Hinauszögern dieser Antwort kann man sich nur in Schwierigkeiten bringen. „Jetzt nur nichts Falsches sagen“, kam es mir in den Sinn.
Ich überlegte fieberhaft in den Bruchteilen von Sekunden, die mir zur Verfügung standen. Was sollte ich antworten auf die eigentlich doch so leichte Frage? Würde ein Mann eine solche Frage stellen, ich würde antworten „Mach, was du willst“ und der Käse wäre gegessen. Aber bei einer Frau ist eine solche Antwort der sichere Scheidungsgrund. Was also sollte ich sagen? Ich kannte Lisa. Was ich ihr auch vorschlagen würde, ich würde den Kürzeren ziehen in dem sich anschließend ergebenden verbalen Gefecht.
„Es steht dir alles gut“, versuchte ich mich an einer Entscheidung vorbeizuschlängeln. „Du wirst es schon richtig machen.“
Meine Antwort war ebenso gut oder so schlecht, als hätte ich geschwiegen, was ich auch besser getan hätte, denn nun begann eine Diskussion, die ich mir eigentlich hatte ersparen wollen.
„Es interessiert dich also nicht, wie ich aussehe? Oder wie soll ich deine Antwort verstehen?“
„Natürlich interessiert es mich, wie du aussiehst. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass dir einfach alle Frisuren stehen.“
Es klang etwas ruhiger, als Lisa weitersprach.
„Aber es gibt doch Unterschiede. Wenn ich einen Knoten oder einen Pferdeschwanz trage, wirkt mein Gesicht doch bestimmt breiter.“
„Dann trage dein Haar doch einfach offen.“
Kaum hatte ich diesen Satz ausgesprochen, hätte ich mir auf die Lippen beißen können.
„Du blöder Hund“, dachte ich bei mir. „Es hätte so ein schöner Morgen werden können.“
„So ist das also. Mein Gesicht ist zu breit. Du möchtest, dass ich es mit dem offenen Haar verdecke?“
Lisa hörte auf, den Tisch weiter zu decken und sah mich geradeheraus an.
„Nein, Lisa, du gefällst mir so, wie du bist. Du verstehst mich falsch. Mir gefällt einfach alles an dir.“
„Und das soll ich dir glauben?“