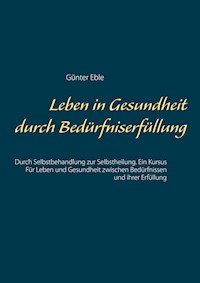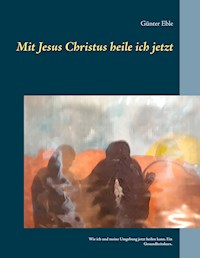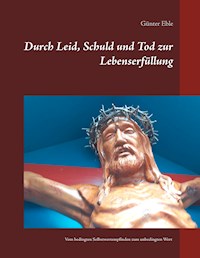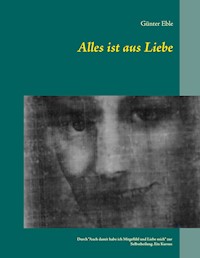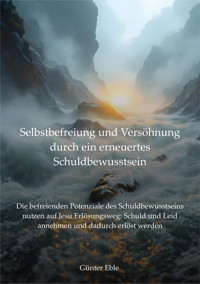
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Gewissen und Schuldbewusstsein können zur Befreiung der Freiheit genutzt werden: Das mit versäumten, verletzten, unerfüllten Werten – respektive Schuld – mitfühlende „schlechte“ Gewissen sowie das Schuldbewusstsein rücken zugleich diese der Schuld vorausgesetzten Werte anerkennend wieder ins Bewusstsein. Sie rehabilitieren dabei die Schulddefizite in ihrem immanenten Wert und lösen sie so aus ihrem einseitig negativen Zusammenhang des Verlusts und der Schädigung. Vergleichbar der Entdeckung eines verschmutzten Diamanten: Indem ich den Schmutz als Schmutz erkenne, erkenne ich auch den Diamanten als Diamanten. Dies bedeutet befreiendes Wissen und Bewusstsein. Alles menschliche Bewusstsein ist von Menschen gemacht. Das gilt für das kollektive Bewusstsein der ganzen Menschheit ebenso wie für mein persönliches. Da alles einschließlich meiner Person in ständiger Entwicklung begriffen ist, gilt dies auch für das kollektive und das persönliche Bewusstsein. Da alles Bewusstsein menschengemacht ist, trifft das für alle Bewusstseins- und Glaubensinhalte zu. Wenn jemand behauptet, sein Bewusstsein sei von außen gemacht, erklärt man damit seine abhängige Unfreiheit. Was ein Mensch auch immer fühlt, glaubt, denkt und sich vorstellt, ist die einzigartige Leistung seines Bewusstseins. Hier genau ist meine Freiheit: Mein Bewusstsein zu nutzen, um meine Freiheit immer weiter aus bestehenden Wicklungen zu entwickeln und auszuweiten. Mit der Entwicklung des menschlichen Selbstbewusstseins ist unter der Einwirkung des Mitgefühls zunehmend ein Schuldbewusstsein entstanden. Im Maße der Ausweitung besonders der ideellen Werte wie Gerechtigkeit oder Humanität ist zugleich die Einsicht in die Verfehlung dieser Werte – das ist gleichbedeutend mit Schuld – gewachsen. Dementsprechend vollzieht sich im persönlichen wie im kollektiven Schuldbewusstsein, man kann es auch Gewissen nennen, ein permanenter Veränderungsprozess. Im Buch wird ein Weg beschrieben, wie das Bewusstsein reflektiert für solche Werte und der Umgang mit diesen zur Befreiung der persönlichen Freiheit genutzt werden kann. Es geht um das zunehmende fühlende Verständnis, dass mich mein Schuldbewusstsein letztlich frei macht und nicht ausgrenzt oder entwertet. Es macht mich zu einem wahrhaftigen Bewahrer von Werten, für den die Annahme von Schuld befreiende Selbstakzeptanz bedeutet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
© 2024 Dr. Günter Eble
Coverdesign: merkechtDigital, ww.merkecht.digital
Verlagslabel: Mitgefühl Verlag
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgt im Auftrag des Autors, postalisch zu erreichen unter: Dr. Günter Eble, Burghof, 53501 Grafschaft, Deutschland und per E-Mail unter [email protected].
Gewissen und Schuldbewusstsein können zur Befreiung der Freiheit genutzt werden:
Das mit versäumten, verletzten, unerfüllten Werten – respektive Schuld – mitfühlende „schlechte“ Gewissen sowie das Schuldbewusstsein rücken zugleich diese der Schuld vorausgesetzten Werte anerkennend wieder ins Bewusstsein. Sie rehabilitieren dabei die Schulddefizite in ihrem immanenten Wert und lösen sie so aus ihrem einseitig negativen Zusammenhang des Verlusts und der Schädigung. Vergleichbar der Entdeckung eines verschmutzten Diamanten: Indem ich den Schmutz als Schmutz erkenne, erkenne ich auch den Diamanten als Diamanten. Dies bedeutet befreiendes Wissen und Bewusstsein.
Erneuertes, befreiendes Schuldbewusstsein: Durch das Schuldbewusstsein zu immer größerer Freiheit
Alles menschliche Bewusstsein ist von Menschen gemacht. Das gilt für das kollektive Bewusstsein der ganzen Menschheit ebenso wie für mein persönliches. Da alles einschließlich meiner Person in ständiger Entwicklung begriffen ist, gilt dies auch für das kollektive und das persönliche Bewusstsein. Da alles Bewusstsein menschengemacht ist, trifft das für alle Bewusstseins- und Glaubensinhalte zu. Wenn jemand behauptet, sein Bewusstsein sei von außen gemacht, erklärt man damit seine abhängige Unfreiheit. Was ein Mensch auch immer fühlt, glaubt, denkt und sich vorstellt, ist die einzigartige Leistung seines Bewusstseins. Hier genau ist meine Freiheit: Mein Bewusstsein zu nutzen, um meine Freiheit immer weiter aus bestehenden Wicklungen zu entwickeln und auszuweiten.
Mit der Entwicklung des menschlichen Selbstbewusstseins ist unter der Einwirkung des Mitgefühls zunehmend ein Schuldbewusstsein entstanden. Im Maße der Ausweitung besonders der ideellen Werte wie Gerechtigkeit oder Humanität ist zugleich die Einsicht in die Verfehlung dieser Werte – das ist gleichbedeutend mit Schuld – gewachsen.
Dementsprechend vollzieht sich im persönlichen wie im kollektiven Schuldbewusstsein, man kann es auch Gewissen nennen, ein permanenter Veränderungsprozess.
Im Buch wird ein Weg beschrieben, wie das Bewusstsein reflektiert für solche Werte und der Umgang mit diesen zur Befreiung der persönlichen Freiheit genutzt werden kann. Es geht um das zunehmende fühlende Verständnis, dass mich mein Schuldbewusstsein letztlich frei macht und nicht ausgrenzt oder entwertet. Es macht mich zu einem wahrhaftigen Bewahrer von Werten, für den die Annahme von Schuld befreiende Selbstakzeptanz bedeutet.
Günter Eble
Selbstbefreiung und Versöhnung durch ein erneuertes Schuldbewusstsein
Die befreienden Potenziale des Schuldbewusstseins nutzen auf Jesu Erlösungsweg: Schuld und Leid annehmen und dadurch erlöst werden
Inhalt
Cover
Urheberrechte
Titelblatt
Eine wertschätzende Sicht auf das Schuldbewusstsein vorweg: Schuld und Schuldgefühle in ihrer Not-wendigkeit und ihrer heilsamen Wirkung
Schuldhaftes Verhalten ist von schlechtem Gewissen und von Schuld zu unterscheiden
Schuld ist eine gute Idee – zugleich beängstigend und belastend
Schuldgefühle zeigen ein Missverhältnis in Beziehungen an
Die beiden entgegengesetzten Blickrichtungen der Schuld
Schuldbewusstsein im evolutionären und gesellschaftlichen Zusammenhang
Transformation des Schuldbewusstseins
Zwei Vorgeschichten
Von welchem Selbst- und Weltverständnis ausgegangen wird
Folgerungen aus diesem Verständnis: Heilung durch Not und Sterblichkeit
Aus frühesten und bisherigen Erfahrungen abgeleitete Glaubenssätze
Kraft meiner Glaubenssätzen bestimme ich mich, mein Verhalten und meine Welt
Mein impliziter Glaube an Ganzsein, Einheit und Heilsein von Anfang an
Ich glaube, alles ist aus der Liebe hervorgegangen und in ihr bewahrt
Bewusstsein kann erweitert und befreit werden
Mein individuelles Bewusstsein
Dimensionen des Bewusstseins - durch Mitgefühl zum Schuldbewusstsein und zur Liebe
Das Schuldbewusstsein im Dienst paternalistischer, autoritärer Strukturen
Die Entwicklung des Schuldbewusstseins und die christliche Erzählung dazu
Das aus der christlichen Lehre abzuleitende Glaubensbewusstsein
Vom notwendigen Egoismus zu seiner Aufhebung im Allumfassenden
Erläuterungen zu Egoismus, Heilsegoismus und umfassendem Heilsein
Aufhebung des natürlichen Heilsegoismus durch seine Schuldverstrickung
Was jeder für seine Heilsentwicklung tun kann
Vom Heilsegoismus zum bedingungslosen Heil in der christlichen Erzählung
Jesus – ganz Mensch in seinem Heilsegoismus und ganz Gott als Heiland aller
Anscheinende Gegensätze zwischen Heilsegoismus und bedingungslosem Heil aller
Verfasstes und anonymes Christentum
Vom vorläufigen kindlichen Paradies durch die Schuld zum zeitlosen PARADIES
Vorstellungen vom bedingungslosen Heil
Alles Sein ist vorgegeben – alles Wissen und Bewerten ist menschengemacht
Das so genannte „schlechte“ Gewissen und seine Schuldkonstruktion
Das notwendige Gewissen: Wertevertreter und Kompass des menschlichen Bewusstseins
Das Gewissen als Wertebewahrer und sein Ursprung in der Liebe
Die Substanz des schlechten Gewissens und wie es sich wofür äußert
Wovon die Vernehmbarkeit der Stimme meines Gewissens abhängt
Veränderungen der Inhalte des kollektiven und des individuellen Gewissens
Gerechtigkeitssinn und Gewissen
Das chronisch schlechte Gewissen und die Wunde der Ungeliebten
Schlechtes Gewissen und Gewissenlosigkeit
Die Potenz des Gewissens, seine Manipulation und der Umgang damit
Die Erfahrung meiner Freiheit und ihre Befreiung durch meine Schuld
Freiheit – eine gute Idee
Gedanken zum Ursprung der Freiheit
Erkennen und verkennen der Freiheit
Ursache der Freiheitsverkennung
Meine Freiheit und mein Körper
Möglichkeiten des Zugangs zu meinem Freiheitserleben
Durch Erkenntnis zur Freiheit sowie zur Schuld und durch die Schuld zu mehr Freiheit
Gott schenkt mit der Freiheit die Schuld und ich mache mir beide als Werte zu eigen
Wozu ein strafender Gott und seine autokratischen Vertreter noch gebraucht werden
Von Schuld und Strafe über die Schuldannahme zur Gerechtigkeit Gottes
Die umfassende Gerechtigkeit des barmherzigen Vaters und des sozialen Gehirns
Schuld und Versöhnung
Ursachen und Zweck der Versöhnung
Ursache der Unversöhntheit und mein Glaube an die Macht des Bösen
Versöhnung womit
Versöhnung mit transgenerational weitergegebener Schuld: Demut und Dankbarkeit
Versöhnung durch Gleichberechtigung
Versöhnung mit meiner Endlichkeit: Altern, Lebensende und Tod
Versöhnung am Ende des Lebens
Versöhnung mit dem Ungelebten
Versöhnung mit Gott
Nachwort
Der Gottessohn Jesus als ultimativer Versöhner durch seine Annahme leidvollen und schuldhaften Menschseins
Von Jesus vorgelebte Versöhnungsstrategien
Anhang zur Selbstbehandlung
Praktischer versöhnlicher Umgang mit der Schuld
Fragen und Hinweise dazu
Berührungsbehandlung
Anwendung der Berührungsbehandlung im Umgang mit Schuld und Schuldempfinden
Literatur
Selbstbefreiung und Versöhnung durch ein erneuertes Schuldbewusstsein
Cover
Urheberrechte
Titelblatt
Eine wertschätzende Sicht auf das Schuldbewusstsein vorweg: Schuld und Schuldgefühle in ihrer Not-wendigkeit und ihrer heilsamen Wirkung
Literatur
Selbstbefreiung und Versöhnung durch ein erneuertes Schuldbewusstsein
Cover
I
II
III
IV
V
VI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
Eine wertschätzende Sicht auf das Schuldbewusstsein vorweg: Schuld und Schuldgefühle in ihrer Not-wendigkeit und ihrer heilsamen Wirkung
Die Schuld und Schuldgefühle sind letztlich der Ausdruck einer Sehnsucht nach der Erfüllung wesentlicher Werte – besonders des Mitgefühls und der Liebe. Die Schuld ist eine leidende, verkannte Schwester des Mitgefühls und eine Tochter der Liebe.
Vorbemerkung: Das Schuldthema ist das vielleicht schwierigste Thema überhaupt, da jeder Mensch in irgendeiner Weise darin verstrickt ist. Das geschieht unabhängig davon, ob er an Schuld glaubt oder nicht, oder was er unter Schuld versteht, und wie er mit Schuld umgeht. Vor diesem Hintergrund kann es sein, dass die folgenden Darlegungen als unverständlich, als falsch, als widersprüchlich, als ärgerlich und als kontraintuitiv empfunden werden. Das wird besonders dann der Fall sein, wenn man von einer einseitigen Negativbedeutung von Schuld ausgeht und daran festhalten möchte. Hier soll es darum gehen, bei bleibender Anerkennung des Negativen und des Leidvollen der Schuld ihre gerade dadurch das Mitgefühl und die Entwicklung fördernde und damit ihre befreiende sowie heilsame Wirkung hervorzuheben. Nur in dieser komplexhaften Verbindung von Negativem, Leidvollem, Mitgefühl, Anerkennung der Schuld und von Befreiung kann die Schuld die Not wenden und heilsam sein. (Um hier gleich einem möglichen Irrglauben zu wehren: Es gibt kein „lustiges“ Schuldigsein, um frei zu werden und zu heilen, sondern nur ein leidvolles.)
Schuld ist in diesem Leben unvermeidbar, weil es bei unserer menschlichen Begrenztheit unmöglich ist, allen Werten und allen Ansprüchen gleichzeitig gerecht zu werden.
Die Schuld und die schuldanzeigenden Schuldgefühle nehmen von Kindheit an eine zentrale Rolle im Leben eines Menschen ein. Das ist im jüdisch-christlich-abendländisch geprägten Bewusstsein seit Adam und Eva so. Angeblich soll die Schuld an der Vertreibung aus dem Paradies schuld sein. Damit ist ein wesentlicher Faktor der Schuld bis zum heutigen Tag beschrieben: Entwertung und Ausschluss aus einer harmonischen und bergenden – paradiesischen – Gemeinschaft. Das sind die Folgen und gleichzeitig die Bestrafung der Schuld, die auf alle Nachkommen übertragen wird. Bis heute glauben wir in der Tradition dieses jüdischchristlich-europäischen Glaubensbewusstseins zumindest auf einer unbewusst-impliziten Ebene – und im religiösen Kontext auch ganz explizit – an diesen Schuldzusammenhang. Daher quälen sich die Menschen ihr ganzes Leben damit ab, Schuld zu vermeiden, was prinzipiell unmöglich ist. Oder sie versuchen, sich zu rechtfertigen oder eine Schuld generell zu leugnen.
An dieser Stelle soll zunächst erklärt werden, was hier unter Schuld verstanden wird:
Mit „Schuld“ werden eine Differenz und eine Diskrepanz zwischen einem Ist-Wert und einem Soll-Wert oder auch einem Norm-Wert bezeichnet. So sprechen wir beispielsweise in der Medizin von „Sauerstoffschuld“, wenn eine Diskrepanz zwischen dem Sollwert der normalen Sauerstoffsättigung des Blutes und dem gemessenen Ist-Wert besteht. Entsprechend spricht man auch bezüglich ideeller persönlicher und sozialer Werte, um die es hier geht, von Schuld, wenn ein bestimmter Norm- bzw. Sollwert nicht erfüllt ist. Hierbei besteht nun die große Schwierigkeit, zu bestimmen, was bei einem Wert jeweils die Norm und das Soll sind.
Wer bestimmt nun die „Normwerte“, wer bestimmt den Geltungsbereich, für wen, wann, unter welchen Bedingungen und wie lange bestimmte Normwerte und „Soll“-Werte gelten?
Die Zehn Gebote sind Sollwert-Festlegungen, die im Wesentlichen bis heute gelten. In ihnen werden laut Altem Testament von Gott – dem Schöpfer – „Solls“ vorgegeben, die im Interesse der Gemeinschaft von Schöpfer und seinen Geschöpfen auch im Interesse der Gemeinschaft der Menschen zu erfüllen sind: „Damit es ihnen wohlergehe und sie lange auf der Erde leben.“ Die Solls der Zehn Gebote sind also für das Wohl der Menschen da; sie sollen dem Menschen dienen und nicht der Mensch den Solls. Wie relativ diese Solls der Zehn Gebote schon von Anfang an waren, ist im Alten Testament beschrieben: Moses – die Autorität – kommt mit den gerade erhaltenen Gebotstafeln mit dem Gebot „Du sollst nicht töten“ vom Berg. Und dann erschlägt er als erstes Tausende seiner Landsleute, weil diese angeblich ihrem Gott untreu geworden seien. Wie leider häufig scheinen die Gebote nicht so sehr für die Autorität selbst zu gelten, welche die Gebote vermittelt.
Doch in dem Dilemma, welchem Soll und welchem Wert bei miteinander konkurrierenden, scheinbar gegensätzlichen Werten man gerecht werden soll und welcher dabei vernachlässigt wird, befinden wir Menschen uns ständig. Wie immer man sich auch für den einen oder den anderen Wert entscheiden mag: Bezüglich des vernachlässigten Wertes hat man sich schuldig gemacht. Es ist daher im menschlichen Leben aufgrund der immer wieder miteinander konkurrierenden Werte und Soll-Vorstellungen unmöglich, nicht schuldig zu werden. Die Schuld – die Nichterfüllung eines Wertes – ist im Leben unvermeidbar. Somit geraten wir überwiegend unverschuldet stets in neue Situationen hinein, wo wir dem einen oder dem anderen Wert nicht gerecht werden und etwas schuldig bleiben.
Auf die Frage, wer denn die Solls und die Werte festsetzt, lautete die Antwort vor einem religiösen Hintergrund: die höchste Autorität, also Gott. Das könnte man für eine Projektion menschlicher Erfahrungen mit menschlichen Autoritäten auf ein entsprechendes Gottesbild halten: Der Stärkste, der Anführer, der Häuptling, der Schamane, der Priester oder der König bestimmt die Werte, die Solls und die entsprechenden Gebote und Gesetze. Wer sie nicht erfüllt und sie verletzt, wird bestraft und auf die eine oder andere Weise aus der Gemeinschaft – auf Zeit oder dauernd – ausgeschlossen. Das alttestamentarische Muster des Ausschlusses wegen des Essens verbotener Früchte ist schon im Tierreich erkennbar: Den ersten Zugang zu den Früchten, dem Fressen, hat das Alphatier. Wer das nicht respektiert, wird vertrieben, ausgeschlossen oder getötet.
Die Frage nach der Entstehung der Werte in menschlichen Gesellschaften lässt sich jedoch auch anders beantworten: Werte und Solls wurden nicht von außen vorgegeben, sondern sind aus dem wachsenden Bewusstsein für die menschliche Bedürftigkeit heraus entwickelt worden. Da aber nichts, was entstanden ist, sich selbst geschaffen hat, hat man den Ursprung der Gebote in einer Schöpfermacht vermutet. Diese hat man nach menschlichem Vorbild mit Eigenschaften und Herrschaftsvollmacht ausgestattet. Ausgehend von dieser Erzählung fällt es auch heute noch vielen schwer, sich vorzustellen, dass sich etwas aus dem System von innen heraus entwickelt hat. Doch in Wirklichkeit ist es so, dass sich die Gesetze und Regeln von innen aus der jeweiligen spezifischen Lebenssituation und unter den darin herrschenden Bedingungen sowie den dieser Situation entsprechenden existenziellen Bedürfnissen heraus gebildet haben. Dies ist in sozialer Übereinkunft der jeweiligen Gesellschaft geschehen. Dementsprechend machte es im Altertum einen Unterschied für die Hygiene, ob – leicht verderbliches – Schweinefleisch in Palästina bei Juden und Mohammedanern verboten wurde und nicht im kühleren Europa, wo ein Verbot weniger notwendig war. Das bedeutet, dass man den Anfang von Geboten und Verboten in den umgebungsabhängigen Erfahrungen der Menschen vermuten kann und nicht in autoritären – göttlichen – Offenbarungen.
Doch es gibt auch Bedürfnisse und – diesen entsprechend – Werte, die für alle Menschen unabhängig von den jeweiligen Lebensbedingungen gelten: Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Geborgenheit, Selbstbestimmung, Freiheit, Kultur im weitesten Sinne einschließlich Feiern und Riten sowie zahlreiche weitere. Das sind Bedürfnisse und Werte, die grundsätzlich von jedem Menschen aus seinem Inneren heraus erfüllt sein wollen. Leidet man Mangel an einem dieser Werte, ein Bedürfnis ist unerfüllt, dann fühlt man sich im Ganzen schlecht. Dabei zeigt das Sich-schlecht-Fühlen nur einen Mangel, eine Schuld im Sinne einer Ist-Soll-Diskrepanz bezüglich eines speziellen Wertes an. Das ist vergleichbar mit den Hunger- und Durstgefühlen, die ebenfalls eine Ist-Soll-Diskrepanz oder einen Mangel anzeigen. Dieses Sich-schlecht-Fühlen sagt nichts über den Wert Person als ganze aus. Doch wenn dieses Sich-schlecht-Fühlen, das eine mangelnde Bedürfniserfüllung anzeigt, mit „Ich-bin-schlecht“ gleichgesetzt wird, kommt es zu einem Schuldgefühl, in dem der eigentliche Wert als Mensch herabgesetzt scheint. Dabei geraten der spezielle Mangel, das unerfüllte Bedürfnis respektive der unerfüllte Wert – wie bei fehlender Gemeinschaft – leicht aus dem Fokus: Anstatt zu fragen, was mir fehlt, geht es mehr um die Frage, wie schlecht ich mich fühle oder was ich wert bin.
Unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie wurde offenkundig, wie sehr solche Werte wie Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Geborgenheit, Freiheit, Kultur, Feiern usw. das Leben der Menschen bestimmen. Und wie sehr die Menschen leiden und „sich schlecht fühlen“, wenn diese Werte bzw.
Bedürfnisse nicht oder nur unzureichend erfüllt werden. Ebenso wurde deutlich, wie dann für die mangelnde Bedürfniserfüllung Schuldige gesucht werden. Vermeintlich (Mit-)Schuldige wie Politiker, Virologen oder Impfärzte wurden massiv bedroht. Der verurteilende und bestrafende Umgang mit der Schuld – hier die Schuldverteilung nach außen – wirkt dabei wie eine Ersatzbefriedigung.
Bei der Behandlung von traumatisierten Flutopfern ging es immer wieder um die Schuldthematik; doch hier im Sinne einer sich entwertenden Selbstbeschuldigung: Worunter diese Menschen am meisten und am nachhaltigsten litten, war nicht der unmittelbare eigene Verlust. Sondern sie fühlten sich schuldig, die eigenen Kinder oder Verwandte, Freunde, Nachbarn nicht genügend geschützt bzw. gerettet zu haben. Bei diesem selbstanklagenden Umgang mit der Schuld und dem Schuldempfinden ist die Würdigung dieses Empfindens als tiefer Ausdruck von Mitgefühl und als Liebesäquivalent besonders notwendig, angemessen und tröstlich.
Hinter der genannten Fokusverschiebung vom zugrunde liegenden Sich-schlecht-Fühlens wegen eines Mangels auf die gefühlte Zuschreibung „Ich bin schlecht“, steckt der Jahrtausende alte Glaube, dass für das Sich-schlecht-Fühlen aufgrund unerfüllter Bedürfnisse irgendjemand die Schuld tragen müsse. Vorzugsweise werden Fremde, Andersgläubige, Andersaussehende, Andersdenkende, Ausländer, der Teufel, das Böse oder auch Gott verdächtigt und beschuldigt. Der Fokus der Aufmerksamkeit wird also nicht so sehr darauf ausgerichtet, was fehlt, was das unerfüllte Bedürfnis und der unerfüllte Wert sind. Sondern es geht vielmehr darum, einen vermeintlichen oder tatsächlichen (Mit-)Verursacher, einen Schuldigen ausfindig zu machen, um diesen dann wütend zu bekämpfen. Wenn ich keinen Schuldigen finde oder der mir zu mächtig erscheint, sodass ich seine Reaktion fürchten muss, gebe ich mir selbst die Schuld: „Was bist du nur für ein Versager; du hast es nicht besser verdient; geschieht dir ganz recht, dass du leidest.“
In einem gerechten und heilsamen Umgang mit der Schuld und den Schuldgefühlen geht es demnach zuerst darum, dass ich mich meinen unerfüllten Bedürfnissen und meinen tatsächlich oder vermeintlich unerfüllten Werten zuwende.
Dabei ist es notwendig, dass ich in mich hineinspüre und mit mir mit-fühle. Nur so kann ich wahrnehmen, woran es mir mangelt, welcher Hunger, welcher Durst, welche Sehnsucht in mir ungestillt sind. Solange ich nach einem (äußeren) bösen Verursacher – Schuldigen – meines Mangels und meines damit verbundenen Leids suche, versäume ich, meinem Mangel in mir selbst gerecht zu werden; nämlich meinen Hunger, meinen Durst, mein unerfülltes Bedürfnis, meine Sehnsucht zu stillen. Stattdessen befinde ich mich in einem heillosen Kampf, der meinen aktuellen Mangel überlagert, mich vom Mangel sowie vom Erfüllungsstreben ablenkt und so meine Entbehrung noch größer macht.
Es geht hier zunächst darum, dass ich mir immer wieder bewusst mache, dass Schuld und Schuldgefühle wertvolle Helfer sind. Sie zielen sowohl für mich und als auch fürsorglich bezüglich meiner Bezugspersonen auf die Erfüllung von Bedürfnissen und Werten ab. Schuld und Schuldgefühle stehen zwar – als deren Folge – mit einem leidvollen Verhalten oder einem leidvollen Nicht-Verhalten bzw. einer Unterlassung im Zusammenhang. Sie sind jedoch nicht das Verhalten oder die Unterlassung selbst. Sie sind informative Aspekte und Perspektiven eines mitfühlenden Menschen, der das mit Leid verbundene Verhalten respektive das Versäumnis über Zeiten hinweg bleibend anerkennt und würdigt.
Doch die traditionellen eingefahrenen Muster im Umgang mit der Schuld – Rechtfertigung, Gegenbeschuldigung, Verleugnung – machen es schwer, aus einem solchen zugleich wertschätzenden Schuldverständnis wirklich zu leben. Dies wird in der gewohnten Schuld-Fühl-und-Denkweise als kontraintuitiv empfunden. In diesem Schuldverständnis werden die Schuldgefühle gleichsam wie Hunger und Durst als Mahner und Unterstützer zur Erfüllung lebenswichtiger Bedürfnisse angenommen. Im Gegensatz zum vitalen Durstgefühl sind die Schuldgefühle später während der Sozialisation des Menschen und während seiner psychosozialen Bewusstseinsentwicklung entstanden. Das bedeutet, dass Schuldgefühle, anders als der Durst, nicht nur an der eigenen unmittelbaren „leibhaftigen“ Bedürfnislage orientiert sind, sondern auch an den Bedürfnissen der anderen und an der Gemeinschaft sowie ihren jeweiligen Werten. In meiner persönlichen, kulturell vorgeprägten psychosozialen Entwicklung lerne ich erst nach und nach – zunächst im Austausch mit den Eltern, später mit anderen Autoritäten – auch deren Bedürfnisse und Werte, die von meinen abweichen können, einzubeziehen und zu berücksichtigen. Ich mache als Kind zunehmend die Erfahrung, dass sich die Eltern und Autoritäten entweder von mir abwenden oder sich mir strafend zuwenden, wenn ich ihre Werte nicht genügend achte.
Während ich mir in meiner Durstsituation selbst etwas schulde – Trinken und Flüssigkeit – schulde ich im sozialen Kontext zunächst den Autoritäten und ihren Bedürfnissen oder Werten etwas. Die für mich schmerzlichen Reaktionen der Autoritäten in diesem Zusammenhang mit Ablehnung, Abwendung oder Bestrafung setze ich mit „Ich bin schlecht“ gleich; andernfalls würde man sich mir gegenüber nicht so verhalten. Erst durch die Reaktionen der Autoritäten werden mir die Werte und die von meiner aktuellen Bedürfnislage abweichenden Bedürfnisse der anderen bewusst. Im Verlauf der psychosozialen Entwicklung verschmelzen meist das „Ich fühle mich schlecht“ und das „Ich bin schlecht“ miteinander. Das geschieht umso mehr, je mehr die Eltern oder die Autoritäten – d. h. meine kulturellen Rahmenbedingungen – meinen Schmerz, mein Leid und meine Not in einen abwertenden Schuldzusammenhang stellen. So ist es bereits im Alten Testament vorgegeben: Wer blind ist oder krank, hat entweder selbst Schuld oder seine Eltern. Dabei forderte bereits der Prophet Hosea stattdessen Mitgefühl ein: „Ich habe Lust am Erbarmen, nicht am Opfer.“ Je mehr ich als Kind bei körperlichen oder seelischen Verletzungen gehört habe: „Das bist du selbst schuld“, „Wie hast du das denn wieder angestellt“, „Pass nächstes Mal besser auf“, „Ich habe dir doch gesagt, dass du das nicht sollst“ u. Ä., anstatt Mitgefühl und Trost zu erhalten, desto mehr glaube ich an den kausalen Zusammenhang von Leid, Schmerz und Not durch meine mich abwertende Schuld. Viele Menschen sehen dann ihr Unglück, ihre Verluste oder ihre Krankheit als Strafe – eventuell Gottes – für ihre Verfehlungen, Sünden bzw. ihre Schuld an. Doch auch solchen Äußerungen wie: „Warum bin ich nur so schwer krank? Ich habe doch keinem etwas getan“, gehen vom impliziten Glauben an eine solche Schuld-Leid-Kausalität aus. Natürlich ist es notwendig, in meiner psychosozialen Entwicklung auch die Bedürfnisse und Werte der anderen kennen und würdigen zu lernen. Das geschieht jedoch zunächst einmal in meinem eigenen Interesse und nicht, um damit einer Autorität gerecht zu werden. Nur wenn ich auch die Bedürfnisse und Werte meiner Lebensumwelt kenne und beherzige, kann ich mich in der Gemeinschaft zugehörig und geborgen fühlen. Dazu muss ich mich nicht zwangsläufig den Gesetzen oder Forderungen einer wie immer gearteten Autorität unterwerfen; jedenfalls nicht in demokratischen Gesellschaften. Es genügt mein Wille, mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Gemeinschaft zu erfüllen. Das ist etwas, was ich mir schulde, wie ich mir auch das Trinken und Essen schulde. Dass ich damit gleichzeitig den anderen gerecht werde und ihnen etwas erfülle, ist eine zusätzliche Gratifikation für mich. Es tut mir gut, wenn ich anderen Gutes tue.
Schaffe ich es aus irgendwelchen Gründen jedoch nicht, den Werten und Bedürfnissen der anderen gerecht zu werden und fühle mich dadurch ausgeschlossen oder „schlecht“, zeigt mir ein Minderwertigkeitsgefühl meine Selbstverurteilung an.
Eine Seite in mir verurteilt mich und erklärt mich für schuldig im Sinne des „Du hast was falsch gemacht und bist deshalb ein Versager“ oder ähnliche von strafenden Autoritäten übernommene Entwertungen. Stattdessen kann ich mitfühlend mit meiner Schuld – allgemeiner: Verursachung oder Verantwortlichkeit – bezüglich unerfüllter Bedürfnisse wie etwa Gemeinschaft, Harmonie, Zugehörigkeit, Wertschätzung oder Solidarität umgehen. Dieser andere verständnisvollere Umgang könnte so lauten: „Es tut mir leid, dass ich anderen nicht gerecht geworden bin; dass ich etwas nicht geschafft und nicht bekommen habe; dass ich mich ausgeschlossen und schlecht fühle.“ Ich kann verstärkend noch hinzufügen: „Auch damit habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.“
Mit dieser Annahme meiner Schuld bezüglich meiner unerfüllten Bedürfnisse oder Werte sowie dem damit verbundenen Leid erfülle ich mit meiner mitfühlenden Haltung das, was meine Schuld und meine Schuldgefühle eigentlich für mich erreichen wollen: Heilung durch Mitgefühl und Liebe. So wie es das Evangelium beschreibt: Die menschliche Schuld geht im Mitgefühl und in der Liebe des Heilands, des heilenden Gottessohns Jesu, auf. Dabei sei an die Worte Jesu anlässlich der von Pharisäern beklagten Schuld des Ährenpflückens am Sabbat erinnert: Hättet ihr doch nur verstanden: Barmherzigkeit will ich; nicht Opfer.
Dass die Schuld mit der Vermutung einer Schädigung der Autorität – Eltern, Lehrer, Staat, Gott – und ihrer Gesetze verknüpft und dafür mit Bestrafung bewehrt wird, hat fatale Folgen. Es wird dadurch ihr eigentliches Ziel, nämlich auf eigene unerfüllte Werte und Bedürfnisse zu verweisen, verschleiert. Eigentlich macht es keinen Sinn, dass ich einer Autorität opfere, indem ich ihr eine Strafe zahle und zusätzlich büße, während oder weil ich an irgendetwas Mangel leide. Es wird verkannt, dass es bei meiner Schuld zunächst um meine Bedürfnisse geht: Damit es mir wohlergehe. So soll ich für mich am Sonntag ruhen und nicht für den Sonntag oder für eine Autorität. Die damit verbundene Verkennung des Nutzens meiner Schuldwahrnehmung für mich führt dazu, dass ich die Schuld und damit auch Schuldgefühle einseitig negativ bewerte.
Daher will ich sie um jeden Preis vermeiden und sie nicht annehmen. Falls ich sie doch akzeptiere, will ich sie umgehend loswerden. Mit diesem Schuldverständnis fühle ich mich minderwertig oder gar wertlos, will mich rechtfertigen oder entschuldigen oder verstecken oder ich will mich gar bestrafen. Mit einem erweiterten Schuldverständnis erkenne ich die heilsame Bedeutung von Schuld und von Schuldgefühlen als nimmermüde Lotsen zur Erfüllung meines und aller Leben. Wie quälend die Schuld auch immer sein mag, gerade wenn ich geliebten Menschen nicht gerecht werde, ich kann sie als verkanntes Kind oder Schwester des Mitgefühls und der Liebe empfinden.
Es ist mir bewusst, dass solche Aussagen sehr problematisch sind; besonders, wenn ich sie als Christ gleichsam vor das Tribunal der Heiligen Schrift stelle. Aber wenn ich daran denke, dass Milliarden Juden und Christen seit Tausenden von Jahren das Erschlagen von Erstgeborenen als Befreiungs- und Liebestat eines Gottes der Liebe empfinden und feiern können (Exodus,12), ist es auch möglich, die demütige Annahme von Schuld und das Schuldempfinden als Ausdruck von Mitgefühl und Liebe zu würdigen, anstatt sich damit in die Hölle zu versetzen. Ich kann dann umso tiefer glauben, dass ich genau damit Jesus Christus nachfolge.
Doch auch ohne religiösen Bezug machen Schuld und Schuldempfinden einen zentralen Wesenskern unseres Menschseins aus. Dies umfasst Barmherzigkeit, Fürsorglichkeit, Verbundenheit, Gemeinschaft, Gerechtigkeit, Freiheit, Mitgefühl und Liebe. Bei der natürlichen Begrenztheit des Menschen, die zwangsläufiges Schuldig-Werden einschließt, halten Schuld und Schuldempfinden die Verbindung zu den eben aufgeführten Bedürfnissen und Werten.
Vor diesem Hintergrund darf ich mich gerade dann, wenn ich mich besonders mit meiner Schuld und meinen Schuldgefühlen quäle, dafür wertschätzen, wie groß meine Sehnsucht und meine Liebe bezüglich der genannten Werte sind. Ich darf mich dann dafür lieben, dass ich vermittels dieser quälenden Schuldgefühle die fühlende Verbindung zu all den Werten – von Barmherzigkeit und Fürsorglichkeit bis zu Gerechtigkeit und Liebe – halte.
Schuldhaftes Verhalten ist von schlechtem Gewissen und von Schuld zu unterscheiden
Unter einem schuldhaften Verhalten wird ein Verhalten verstanden, das zu einem Verlust oder zu einer Beschädigung oder zu einer Nichterfüllung eines Wertes führt. Dabei ist davon auszugehen, dass jedes Verhalten adaptiv ist. Es ist somit zunächst einmal lebensdienlich oder soll es zumindest sein. Insofern zielt es auf eine Werterfüllung ab. In diesem Zusammenhang ist jedes Verhalten erst einmal nützlich und nicht schuldhaft. Da jedes Verhalten eine unbewusste oder bewusste Entscheidung voraussetzt, geht die Entscheidung für einen Wert zugleich mit einer Vernachlässigung nicht berücksichtigter Werte einher. Diese Nichtberücksichtigung entspricht schuldhaftem Verhalten. Doch ob ein Verhalten als schuldhaft empfunden wird, ist in den allermeisten Fällen die Folge einer nachträglichen Bewertung durch das Gewissen; genauer: einer nachträglichen Schuldanerkennung. Dieser nachträgliche Gewissensprozess mit der entsprechenden Schuldanerkennung kann oft viele Jahre später nach dem indizierten Verhalten erfolgen.
Damit wird der Unterschied zwischen dem eigentlichen Verhalten, das später als schuldhaft empfunden wird, und dem diesbezüglichen Gewissensprozess mit seinem Schuldspruch deutlich. Dieser Bewusstseinsprozess hat dazu geführt, dass das vergangene, damals wertorientierte Verhalten nun aus der Perspektive einer Wertvernachlässigung gesehen und fühlend verstanden wird. Die damit einhergehenden Schuldgefühle können ein Spektrum von unangenehmen Gefühlen – Scham, Angst, Zerknirschung, Niedergeschlagenheit, schlechtes Gewissen, Not, Wut auf sich selbst, Verzweiflung und ein allgemeines Sich-schlecht-Fühlen – umfassen. Das eigentliche, nun als schuldhaft empfundene Verhalten ist Geschichte, während die Wertschätzung des früher vernachlässigten Werts aktuell vollzogen wird. Zugleich findet verbunden mit den belastenden Gefühlen, mit denen ich mich auch in einem moralischen Sinne schlecht und minderwertig fühle, eine Selbstentwertung statt.
Dabei habe ich berechtigte Gründe, mich gerade für diesen Gewissensprozess und mein Schuldbewusstsein mit der impliziten nachträglichen Anerkennung von Werten selbst wertzuschätzen. Ich habe damit mein Gewissen geschärft, mein Bewusstsein sowie meine Wertschätzung erweitert. Darüber hinaus habe ich meine faktische Freiheit befreit: Mein so verstandenes Schuldbewusstsein öffnet mein Bewusstsein und bereichert es um Werte. Es hebt auf diese Weise mein Selbstwertempfinden.
Schuld ist eine gute Idee – zugleich beängstigend und belastend
Schuldgefühle treten stets im Zusammenhang mit einem Mangel auf, den sie anzeigen. Das ist eine gute Idee. In Wirklichkeit gelten die Angst und die Ablehnung dem Mangelerleben. Doch im menschlichen Bewusstsein verschmelzen Mangelerleben und Schuldgefühl – beides sind Symptome und Symbole – mit dem eigentlichen Mangel. Als Beispiel für dieses Muster: Mir fehlt es an Nahrung, das ist der eigentliche Mangel, und mein Hunger ist das aufmerksam machende Symptom und das Symbol des Nahrungsmangels. Einerseits ist es angemessen, Hunger und Nahrungsmangel gleichzusetzen. Andererseits besteht ein gewaltiger Unterschied bezüglich des Lebenserhalts. Der Hunger ist im Gegensatz zum Nahrungsmangel lebenswichtig. Dies lässt sich verallgemeinernd von Mängeln und Fehlern im Verhalten in Beziehung zum Schuldbewusstsein übertragen. Fehlerhaftes Verhalten kann gefährlich und tödlich sein. Das Schuldbewusstsein will davor schützen. Da die Schuld symptomatisch und symbolisch für Fehlverhalten und für Sünde steht, wird traditionell nicht zwischen der Schuld und dem Fehlverhalten unterschieden. Das kann dazu führen, dass ich mehr Angst vor dem Schuldbewusstsein habe als vor einem Fehlverhalten. Das wiederum lässt mich glauben, dass ich alles richtig mache, solange ich kein Schuldbewusstsein zulasse oder die Schuld verleugnen kann. Da das unmöglich ist, lebe ich in ständiger Angst vor der Entdeckung.
Schuldgefühle zeigen ein Missverhältnis in Beziehungen an
Das gilt für die Beziehung zwischen Ist und Soll; wobei das Soll den angestrebten Wert angibt. Was Solls und Werte sind, ergibt sich zunächst aus meinen vitalen Bedürfnissen wie Nahrung, Berührung, Bewegung, Ruhe usw. Ein diesbezügliches Missverhältnis bzw. Defizit macht sich anfangs durch Unwohlsein und noch nicht durch Schuldgefühle bemerkbar. Mit zunehmender Entwicklung meines Selbstbewusstseins lerne ich immer mehr die Werte und die Solls meiner Umgebung einzubeziehen. Das sind in erster Linie die Bewertungen meiner ersten Autoritäten, meiner Eltern. Dadurch kommt eine andere Qualität im Zusammenhang der Sollerfüllung – hier das elterliche Soll Eltern – und der Schuld. Es entsteht nun nicht mehr nur ein Missverhältnis zwischen Ist und Soll. Zugleich kommt es dadurch zwischen mir und der elterlichen Autorität zu einem Konflikt. Dabei entwickle ich umso quälendere Schuldgefühle, je mehr ich die Ablehnung meiner Eltern spüre. Das Missverhältnis in der Beziehung zu ihnen rückt ins Zentrum meines Schuldbewusstseins. Da ich auf meine Eltern existenziell angewiesen bin, gebe ich dem möglichst ausgeglichenen Verhältnis zu ihnen die höhere Priorität.
Ich richte gerade in einer abhängigen Notsituation meine Aufmerksamkeit und damit auch mein Schuldbewusstsein umso einseitiger auf die Autorität aus, je strenger, anmaßender und strafender sie mir begegnet. Das impliziert, dass ich dagegen anderen meiner Werte oder Solls und meiner Beziehung zu ihnen Bedeutung entziehe. Das geschieht besonders unter autokratischen Strukturen; sowohl im familiären wie im politischen Umfeld. Konkret bedeutet das, dass ich mich dann gerecht fühle, wenn ich bedingungslos der Autorität folge; worin auch immer. Dieses Muster ist in patriarchalisch strukturierten Familien ebenso bestimmend wie in Religionen, Parteien, Gesellschaften oder Nationen. Die Namen der Autokraten lauten Patriarch, Papst, Führer, Pate, Patron oder Kaiser. Die folgsame Beziehung zur übermächtigen Autorität bestimmt mein Schuldbewusstsein. Diese strenge Autorität ist der alles bestimmende Wohltäter, dem ich in allem Gefolgschaft schulde.
Wenn ich mich ihm gegenüber schuldig mache, habe ich Strafe verdient. Ich muss dafür büßen, und zur Wiedergutmachung wird mir ein Sühneopfer auferlegt.
Dadurch lebe ich einerseits in permanenter Angst vor möglicher Schuld. Andererseits glaube ich, durch ständige Opfer und Wiedergutmachungsanstrengungen zur Versöhnung zu gelangen. In diesem Glauben lasse ich mich dann auch bereitwillig bestrafen. Dies entspricht auch meiner Kindheitserfahrung: Nachdem ich gestraft worden bin, war die Beziehung zu den Eltern wieder ausgeglichen und im Reinen. Diese komplexhafte Verknüpfung von Schuld, Bestrafung, schmerzhaften Opfern und „Versühnung“ bringt es dann auch mit sich, dass ich mich selbst mit solchen Opfern bestrafe, um wieder „ins Reine“ zu kommen. Spenden, Fasten, entbehrungsreiche Pilgerreisen, Selbstverletzungen wie Selbstgeißelungen sind Beispiele dafür. Auch der Glaube, dass allfälliges Leid eine Strafe für eine Schuld sei, entspringt diesem speziellen Schuldbewusstsein.
Eine weitere Folge dieser Fühl- und Denkkonstruktion ist entsprechend in der Umkehrung der Glaube, dass man als Gläubiger durch die Bestrafung des Schuldigen Genugtuung erfährt: Eine Seite in mir fühlt sich mit der Gewissheit wohl, dass der Schuldige leidet. Ich empfinde das Leid des anderen als meinen Gewinn und meinen Trost. Es ist eine schmerzliche Tatsache, dass ich wie jeder Mensch eine Veranlagung habe, mich am Leid – zumindest bestimmter anderer Menschen – zu erfreuen. Diese Art von Gerechtigkeit ist implizit tief im Menschen verankert. Explizit kommt sie im Talionsprinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ zum Ausdruck.
Aus dieser meiner Erfahrung heraus, dass das Leid anderer mir Genugtuung verschafft, entstehen dann meine aggressiven und verletzenden Verhaltensweisen. Ich suche mir Schuldige oder genauer gesagt „Minderwertige“, die nicht meinen Wertvorstellungen entsprechen, um sie zu attackieren. Woran ich ihre Schuld bzw. Minderwertigkeit festmache, ist nahezu beliebig: Aussehen, Figur, Kleidung, Religion, Vermögen, Ethnie, sexuelle Orientierung, Fußballverein, Nationalität usw.
In dieser Fühl- und Denkweise des Schuld-und-Strafe-Musters mit seinem impliziten Wertgefälle kann es weder Gerechtigkeit für alle noch Frieden geben. Den Schlüssel zur Befreiung aus diesem unseligen Kampf – Schuld wird mit Strafe bekämpft – habe ich wie jeder Mensch in der Hand.
Dazu ist es notwendig, dass ich mir bewusst mache, wann und wie ich immer wieder beschuldigend und verurteilend unterwegs bin. Dabei macht es prinzipiell keinen Unterschied, ob ich andere oder mich beschuldige und entwerte. Besonders meine Gefühle von Ärger, Aggression, Wut und Hass signalisieren mir Beschuldigung und Entwertung. Ich kann sie als Einladung verstehen, dem Wert oder den Werten, die ich vermisse, genauer nachzuspüren. Auch hier ist es zweitrangig, ob ich durch mich selbst oder durch andere Menschen Werte verletzt sehe. Ich kann in jedem Fall berechtigt für mich in Anspruch nehmen, dass ich mich implizit um Werte bemühe.
Dieses Bemühen um Werte ist selbst etwas Wertvolles, wofür ich mich auch wertschätzen darf.
Die Lösung aus dem Schuld-und-Strafe-Programm ist die Wertschätzung meines mitfühlenden Schuldbewusstseins als Wertbewahrer, die Schuldanerkennung und -annahme. Da genau dies dem Vorbild und der Botschaft Jesu entspricht, wird immer wieder darauf Bezug genommen. Dabei geht es nicht darum, für eine bestimmte Religion zu werben. Vielmehr soll damit ein Bewusstsein verständlicher gemacht werden, was seit zweitausend Jahren Menschen in aller Welt anspricht; allem Missbrauch und allen Verdrehungen bis heute zum Trotz.
Andere Umgangsweisen mit der Schuld wie Entschuldigung, Verzeihen, Vergeben und Rechtfertigung haben ebenfalls ihre befriedende Wirkung. Bei diesen schwingt jedoch mehr das Beseitigen von etwas Schlechtem mit. Hierbei wird zwischen der konkreten Verletzung eines Wertes wie etwa der körperlichen Unversehrtheit und der Schuld als Symbol bzw. Indikator für dieses Defizit nicht unterschieden. Dadurch behält die Schuld ihre einseitig negative Bedeutung, obwohl sie in Wirklichkeit der Gerechtigkeit und der Bedürfniserfüllung dient.
In einem erneuerten Schuldbewusstsein werden das Schuldempfinden und die Schuld umso befreiender und wertvoller, je tiefer dabei das schmerzliche Erleben geht. Auch für diesen Zusammenhang steht die christliche Botschaft: Der Menschensohn Jesus nimmt alle Schuld der Welt und das schrecklichste Leiden einschließlich aller Entwertungen auf sich, um gerade dadurch in seinem unendlichen göttlichen Wert aufzuerstehen. Jesus lebt vor, dass selbst das Allerschrecklichste durch mitfühlende Annahme in Göttliches verwandelt wird.
Auf diese Weise wird die Schuld als Indikator eines Missverhältnisses durch ihre Annahme in einem zur ausgleichenden Gerechtigkeit – zur Gerechtigkeit Gottes, des barmherzigen Vaters. Diese Gerechtigkeit ist im wichtigsten Gebot formuliert: Gott genauso wie den Nächsten und mich selbst zu lieben. Die Schuld, die ich durch die Verletzung dieses höchsten Werts auf mich lade, will mich an diesen unüberbietbaren Liebeswert erinnern und zu seiner Annahme einladen.
Die beiden entgegengesetzten Blickrichtungen der Schuld
Schuld und Schuldempfinden haben immer zwei Blickrichtungen. Die eine Blickrichtung ist auf das Defizit, den Mangel, das Versagen, den (Wert-)Verlust, die Verletzung und die damit assoziierte Schuld im engeren Sinne gerichtet. Der andere Blick geht in die Richtung der Erfüllung von Werten und Bedürfnissen. Die Schuld und das Schuldempfinden sind also notwendige und wertvolle Vermittler zwischen der Information über Defizite im weitesten Sinne mit dem dadurch verbundenen Leid einerseits und andererseits ihrer Erfüllung bzw. Wiedergutmachung. Das mit der Schuld und dem Schuldempfinden verbundene Leid ist gewissermaßen das Bindeglied zwischen Defizit, Mangel, Verletzung oder Verlust als dem einen Pol und dem Mitgefühl und der Liebe als dem anderen. Es gibt keine Schuld und kein Schuldempfinden ohne Mitgefühl. Beide, Mitgefühl und Schuld sowie Schuldempfinden sind Kinder der Liebe.
Diese komplexe Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit von Negativem und Positivem oder von Belastung und Befreiung gilt es mit der Annahme von Schuld fühlend zu verstehen und sich dadurch zu heilen. Damit sollen andere übliche Umgangsweisen mit der Schuld wie Rechtfertigung, Rationalisierung, Relativierung, Gegenbeschuldigung, Aufrechnung oder Entschuldigung keineswegs in Abrede gestellt oder verurteilt werden. Doch nur die mitfühlende, bedauernde Annahme von Schuld ermöglicht die Befreiung und die dem Schuldempfinden innewohnende Würde. Dies ereignet sich dann in einem als Versöhnung und Heilung.
Es gibt keine Schuld und kein Schuldempfinden, welche nicht gleichzeitig auf Wertvolles wie Gerechtigkeit, bergende Verbundenheit und Gemeinschaft, Mitgefühl und Liebe bezogen sind. Von daher kann ich bei allem Leid, das mit der Schuld verbunden ist, stets mit tiefer Überzeugung sagen: Auch mit dieser Schuld und diesem Schuldempfinden habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich und bleibe damit unverändert der unendlich wertvolle Mensch.
Schuldig-werden-Können, Schuld und Schuldempfinden unterscheiden uns von den Tieren. Mit der Schuldannahme bzw. der Schuldübernahme – bei primärer Unschuld – folge ich dem Vorbild des Gottessohns und Heilands Jesus Christus und werde ihm gleich. Ich erlöse und heile mich damit.
Da ich mich mein ganzes Leben lang immer wieder schuldig mache, bedeutet das auch einen lebenslangen Heilungsprozess, in dem ich lerne, mir immer mehr durch die Schuld auch meine und aller Menschen Werte und Würde zu erschließen.
In was für einer Welt würden wir leben, wenn wir uns in der Annahme unserer jeweiligen Schuld – jeder die seinige und zugleich mitfühlend mit der Schuld des Nächsten – überbieten wollten?
Schuldbewusstsein im evolutionären und gesellschaftlichen Zusammenhang
Es lässt sich folgender Zusammenhang resümierend beschreiben: Im Dienste des Lebens und Überlebens ist ein ständiger Austausch zwischen Systemen – hier der Mensch mit seiner Umgebung – notwendig. Lebensnotwendiges wie Sauerstoff, Wasser und Energie in Form von Nahrung und eine lebensfreundliche Umgebung mit hilfreichen Mitmenschen müssen in einem bestimmten Maß von außen gegeben sein. Diese Stoffe und Gegebenheiten sind für den Menschen zu erfüllende Sollwerte. Werden diese Werte verfehlt, dann besteht diesbezüglich eine Schuld und der Mensch fühlt sich schlecht. Für dieses Sicht-schlecht-Fühlen aufgrund von Mangelerleben hat die Menschheit seit Adam und Eva zunehmend die Verantwortung übernommen in Form von Sich-schuldig-Fühlen. Sie tut das bis heute in dem von Autoritäten vorgegebenen Glauben, etwas falsch gemacht zu haben, wenn ein Leid geschieht.
Dies lerne ich als Kind heute noch so. Aus diesem Grund fühle ich mich nicht nur einfach schlecht, wenn mir etwas fehlt, sondern zusätzlich minderwertig. Das aus dem natürlichen Mangelerleben heraus entstandene Schuldgefühl wird – parallel zum sich entwickelnden Selbstbewusstsein – mit Unrecht und diskriminierender Minderwertigkeit gleichgesetzt. Dadurch fühle ich mich aus der Gesellschaft der wertvollen und gerechten Menschen ausgegrenzt. Da die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft einen zentralen, unverzichtbaren Wert darstellt, wird mein Mangel- und Schulderleben noch schmerzlicher. Daher bin ich bereit, große Opfer zu bringen, um diesen Mangel bzw. diese Schuld auszugleichen. Ich will mir die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft verdienen, indem ich die in ihr geltenden Werte möglichst gut erfülle. Dazu gehören besonders Einfühlungsvermögen, Akzeptanz und die Bereitschaft, mich auch mit mir fremden Werten anderer Menschen zu identifizieren. Auf diesem Weg weite ich mein Repertoire sowie mein Bewusstsein für Werte aus. Dadurch lerne ich immer mehr Werte kennen und kann so auf diese zurückgreifen und entwickle zunehmend Verständnis auch für Menschen mit kulturfremden Werten. Zugleich habe ich damit zunehmende Wahlmöglichkeiten, mich mit Werten zu bereichern. Ich vermehre meine Freiheitsgrade und weite meine Freiheit aus.
Zugleich erweitere ich mit meinem Wertebewusstsein, was meinem Wissen von Werten entspricht, mein Gewissen und somit mein Schuldbewusstsein. Dadurch habe ich immer mehr Werte, die ich zwar erfüllen will, jedoch in meiner menschlichen Begrenztheit nicht erfüllen kann. Meinen wachsenden Wahlmöglichkeiten entsprechend muss ich mich auch zunehmend gegen Werte entscheiden und mache mich dabei ständig schuldig. Wachsende Freiheit geht mit größerer Verantwortung und expandierender Schuldhaftigkeit einher. Dies entspricht auch der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit im Allgemeinen und des jüdisch-christlichen Glaubensbewusstseins im Besonderen. Die Gebote und Regeln – das sind zu beachtende Werte im Zusammenleben – hatten bei den Juden in der Zeit Jesu ein sehr großes Ausmaß angenommen. Dies hatte zur Folge, dass deren Berücksichtigung immer mehr Aufmerksamkeit, Engagement und Zeit beanspruchte. Hierdurch wurde das freie Leben mit einer Bestimmung aus sich selbst zunehmend eingeschränkt und belastet.
In dieser Situation erschien Jesus Christus als Heiland und Erlöser. Er zeigte den Menschen einen Weg aus dem Dilemma zwischen Werten und diskriminierender sowie ausschließender Schuld. Er verkündete diesen Erlösungsweg und lebte ihn vor: Sich aller Schuld und allem Leid zu stellen, es auf sich nehmen und dadurch gerechtfertigt und erlöst zu sein. Das gilt auch für das Feindliche, Nötigende und Verletzende von außen: Wer dich auf die Wange schlägt, dem halte auch die andere hin, und wer dir dein Hemd nimmt, dem gib auch deinen Rock. Lk. 6,29. Ich sage euch: Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Mt.5, 44-45. Es geht darum, im eigenen Interesse stets kooperativ und wertschätzend mit allem umzugehen, was ist. Dazu gehört auch alles Leidvolle von innen, wie Schmerz, Schuld und Tod sowie das Leid von außen in Form von Feindseligkeit, Gewalt und Unterdrückung.
Diese Empfehlung ist praktisch eine Beschreibung des der Evolution innewohnenden Prinzips: Bei allen Verteilungskämpfen kommt es letztlich immer wieder zu einer Angleichung mit dem benachbarten Fremden im Sinne einer Symbiose. Dies soll am Beispiel der Geschichte des Menschen in Beziehung zu infektiösen Viren und Bakterien verdeutlicht werden:
Viren und Bakterien können tödliche Infektionskrankheiten hervorrufen. Sie tun das besonders dann, wenn sie für den Menschen neu und fremd sind. Haben sich die Menschen an die fremden Lebensformen anpassen können, sind sie gefeit. Ein Beispiel sind die von den Konquistadoren nach Amerika eingeschleppten Seuchen. Die Europäer hatten sich an die Erreger angepasst und waren immun. Die Südamerikaner waren dagegen schutzlos. Im Verlauf einer andauernden Koexistenz kommt es zu einer Angleichung und Symbiose. Darin sind beide – Mensch und Erreger – aufgehoben und