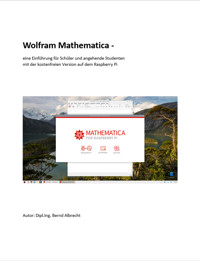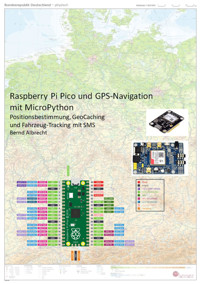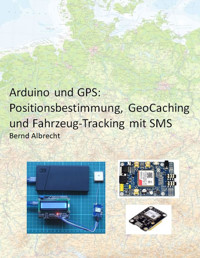3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sinn dieses Buches ist es, ein Maximum an Wissen über „Physical Computing“ und „Computational Thinking“ am Beispiel von ferngesteuerten bzw. mit Sensoren ausgestatteten Roboterautos zu erschwinglichen Preisen zu vermitteln. Als Basis dienen dazu verschiedene Chassis, die als Bausatz mit Motoren und Rädern für unter zwanzig Euro zu kaufen sind. Eine kleine Übersicht mit jeweiligen Vor- und Nachteilen wird im Kapitel 1 angeboten. Die Wahl des Chassis ist allerdings nur die erste Entscheidung. Es geht weiter mit dem bestgeeigneten Controller: ein Mikrocomputer wie der Raspberry Pi oder ein Mikrocontroller? Bei letzterem ein sogenannter „Arduino-kompatibler“ (Programmiersprache C/C++) oder ein mit MicroPython programmierbarer Mikrocontroller wie Raspberry Pi Pico oder einer von Espressif? Mehr dazu im Kapitel 2. Die kleinen Elektromotoren benötigen mehr Strom, als unsere Mikrocontroller abgeben können. Die erforderlichen Leistungsverstärker, die sogenannten Motorcontroller, werden exemplarisch in Kapitel 4 vorgestellt. Zuvor macht es jedoch Sinn, einige elektronische Grundlagen und ihre programmiertechnische Umsetzung anhand von Versuchen mit LEDs zu erklären. Das Dimmen (Reduzieren der Helligkeit) einer LED erfolgt nämlich nach dem gleichen Prinzip wie das Drosseln eines Elektromotors – mit Pulsweitenmodulation (PWM). Mehr dazu in Kapitel 3. Die folgenden Kapitel widmen sich verschiedenen Möglichkeiten der Fernsteuerung unsere Robot Cars. Beispielhaft werden Arduino Uno mit Motor Shield V1 sowie einer selbstentwickelten Fernsteuerung mit dem 433 MHz Transceiver HC-12, Uno mit Motor Shield V2 und 2,4GHz Fernsteuerung, Raspberry Pi mit der Bluetooth APP BlueDot von Martin O’Hanlon (Raspberry Pi Foundation) sowie Raspberry Pi Pico WH mit einer selbstentwickelten Android APP (MIT App Inventor) gezeigt. Die größte Herausforderung stellt das autonome Fahren des Robot Cars dar. Nur mit Sensoren, die die Steuerung beeinflussen, hat unser Modell den Beinamen „smart“ verdient. Bei der Auswahl der Sensoren, für die im letzten Kapitel beispielhaft Lösungsansätze gezeigt werden, wurde als Maßstab wieder ein schmales Budget angelegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort:
Kapitel 1: Chassis und Stromversorgung
Kapitel 2: Mikrocomputer oder Mikrocontroller?
Kapitel 3: Einführung in das Programmieren und Pulsweitenmodulation
Kapitel 4: Gleichstrommotoren und Motorcontroller
Kapitel 5: Ein zweirädriges Roboterauto mit Motor Shield V1 und 433 MHz Fernsteuerung
Kapitel 6: Roboterauto mit Arduino Uno mit Motor Controller L298N, HC-12 und Servomotor
Kapitel 7: Ein zweirädriges Roboterauto mit Motor Shield V2 und 2,4GHz Fernsteuerung
Kapitel 8: Robot Car steuern mit Raspberry Pi 3A+ und BlueDot
Kapitel 9: Ein Roboterauto mit Raspberry Pi Pico WH und L298N
Kapitel 10: Bluetooth-Steuerung mit einer selbst entwickelten Android App
Kapitel 11: Blaulicht und Sirene mittels PIO realisieren
Kapitel 12: Überlegungen für das autonome Fahren
Anhang:
Impressum
Vorwort:
Smart Robot Cars – ausgewählte Beispiele mit verschiedenen Fernsteuerungen und Lösungsansätze für das autonome Fahren
Sinn dieses Buches ist es, ein Maximum an Wissen über „Physical Computing“ und „Computational Thinking“ am Beispiel von ferngesteuerten bzw. mit Sensoren ausgestatteten Roboterautos zu erschwinglichen Preisen zu vermitteln. Als Basis dienen dazu verschiedene Chassis, die als Bausatz mit Motoren und Rädern für unter zwanzig Euro zu kaufen sind. Eine kleine Übersicht mit jeweiligen Vor- und Nachteilen wird im Kapitel 1 angeboten.
Die Wahl des Chassis ist allerdings nur die erste Entscheidung. Es geht weiter mit dem bestgeeigneten Controller: ein Mikrocomputer wie der Raspberry Pi oder ein Mikrocontroller? Bei letzterem ein sogenannter „Arduino-kompatibler“ (Programmiersprache C/C++) oder ein mit MicroPython programmierbarer Mikrocontroller wie Raspberry Pi Pico oder einer von Espressif? Mehr dazu im Kapitel 2.
Die kleinen Elektromotoren benötigen mehr Strom, als unsere Mikrocontroller abgeben können. Die erforderlichen Leistungsverstärker, die sogenannten Motorcontroller, werden exemplarisch in Kapitel 4 vorgestellt. Zuvor macht es jedoch Sinn, einige elektronische Grundlagen und ihre programmiertechnische Umsetzung anhand von Versuchen mit LEDs zu erklären. Das Dimmen (Reduzieren der Helligkeit) einer LED erfolgt nämlich nach dem gleichen Prinzip wie das Drosseln eines Elektromotors – mit Pulsweitenmodulation (PWM). Mehr dazu in Kapitel 3.
Die folgenden Kapitel widmen sich verschiedenen Möglichkeiten der Fernsteuerung unsere Robot Cars. Beispielhaft werden Arduino Uno mit Motor Shield V1 sowie einer selbstentwickelten Fernsteuerung mit dem 433 MHz Transceiver HC-12, Uno mit Motor Shield V2 und 2,4GHz Fernsteuerung, Raspberry Pi mit der Bluetooth APP BlueDot von Martin O’Hanlon (Raspberry Pi Foundation) sowie Raspberry Pi Pico WH mit einer selbstentwickelten Android APP (MIT App Inventor) gezeigt.
Die größte Herausforderung stellt das autonome Fahren des Robot Cars dar. Nur mit Sensoren, die die Steuerung beeinflussen, hat unser Modell den Beinamen „smart“ verdient. Bei der Auswahl der Sensoren, für die im letzten Kapitel beispielhaft Lösungsansätze gezeigt werden, wurde als Maßstab wieder ein schmales Budget angelegt.
Impressum:
Bernd Albrecht, Immenhagen 1b, 24576 Bad Bramstedt
Copyright-Hinweise:
Das eBook soll dazu beitragen, Interessierten die Themen Mikrocontroller, „Computational Thinking“ und „Physical Computing“ näher zu bringen. Verwendete Bilder und Code-Fragmente aus dem Internet dienen der Anschauung und sollen die jeweiligen Produkte bzw. Institutionen bewerben. Im Übrigen gilt GNU General Public License 3.
Kapitel 1: Chassis und Stromversorgung
Die meisten preiswerten Chassis-Bausätze bestehen aus durchsichtigen Acrylplatten, die zunächst noch zum Schutz beim Laser-Cut mit Papier beklebt sind. Zum Bausatz gehören zwei oder vier Elektromotoren (meist 6V) einschl. der Räder sowie ein Batteriekasten. Die zweirädrigen Roboterautos benötigen noch ein oder zwei Stützräder. Nicht enthalten sind meist Mikrocontroller, Motorcontroller und Batterien/Akkus. Die folgenden Bilder zeigen die am weitesten verbreiteten zwei- bzw. vierrädrigen Chassis.
Die Steuerung dieser Roboterautos erfolgt durch unterschiedliche Drehzahlen der Motoren. Und damit sind die Vor- und Nachteile schnell erklärt: Das zweirädrige kann „auf dem Teller drehen“, womit man schnell Aufmerksamkeit erregt. Allerdings ist der Geradeauslauf (gerade beim Anfahren) nicht so stabil wie bei den vierrädrigen, denn die billigen Motoren sind nie gleich in ihrem Verhalten. Anfahren und Geradeauslauf sind demnach die Stärken der vierrädrigen, die dafür allerdings einen relativ großen Kurvenradius haben.
Ausgesprochen beliebt – gerade bei Jungs - ist das nachfolgende Kettenfahrzeug:
Ebenfalls mit zwei Motoren ausgestattet ist es sehr manövrierfähig. Die 12V-Motoren sind deutlich besser, benötigen allerdings auch mehr Batterien/Akkus.
Der Verfasser konnte der Versuchung nicht widerstehen, auch zwei deutlich teurere Roboterautos zu bauen: Zum einen das Modell mit Servolenkung, also lenkbaren Vorderrädern und nur einem Antriebsmotor, zum anderen ein sechsrädriger „Mars Rover“, der auch Hindernisse überwinden kann.
Bei der Stromversorgung muss man sich zunächst entscheiden, ob man vier Alkaline-Batterien (je 1,5V) oder sechs wiederaufladbare NiCd-Akkus mit 1,2V verwenden möchte. Die gelben Motoren benötigen ca. 3 bis maximal 6V Spannung, die mittels Pulsweitenmodulation (siehe Kapitel 3) heruntergeregelt wird.
Eine Alternative, insbesondere für das Kettenfahrzeug mit den 12V-Motoren, bieten Lithium-Ion-Akkus mit einer Nennspannung von 3,7V, die tatsächlich jedoch je nach Ladezustand 3,2 bis 4,2V abgeben.
Aus praktischen Gründen wird ein geschlossener Batteriekasten mit Schalter empfohlen.
Zum Befestigen der Zusatzausstattung kann man einerseits Schrauben und Muttern verwenden, andererseits haben sich zweiseitiges (Teppich-) Klebeband oder selbstklebende Klettbänder (Velcro) bewährt. Bei den Platinen mit unebenen Unterseiten aufgrund von Lötstellen wird eine dünne Lage Schaumstoff (Verpackungsmaterial) empfohlen.