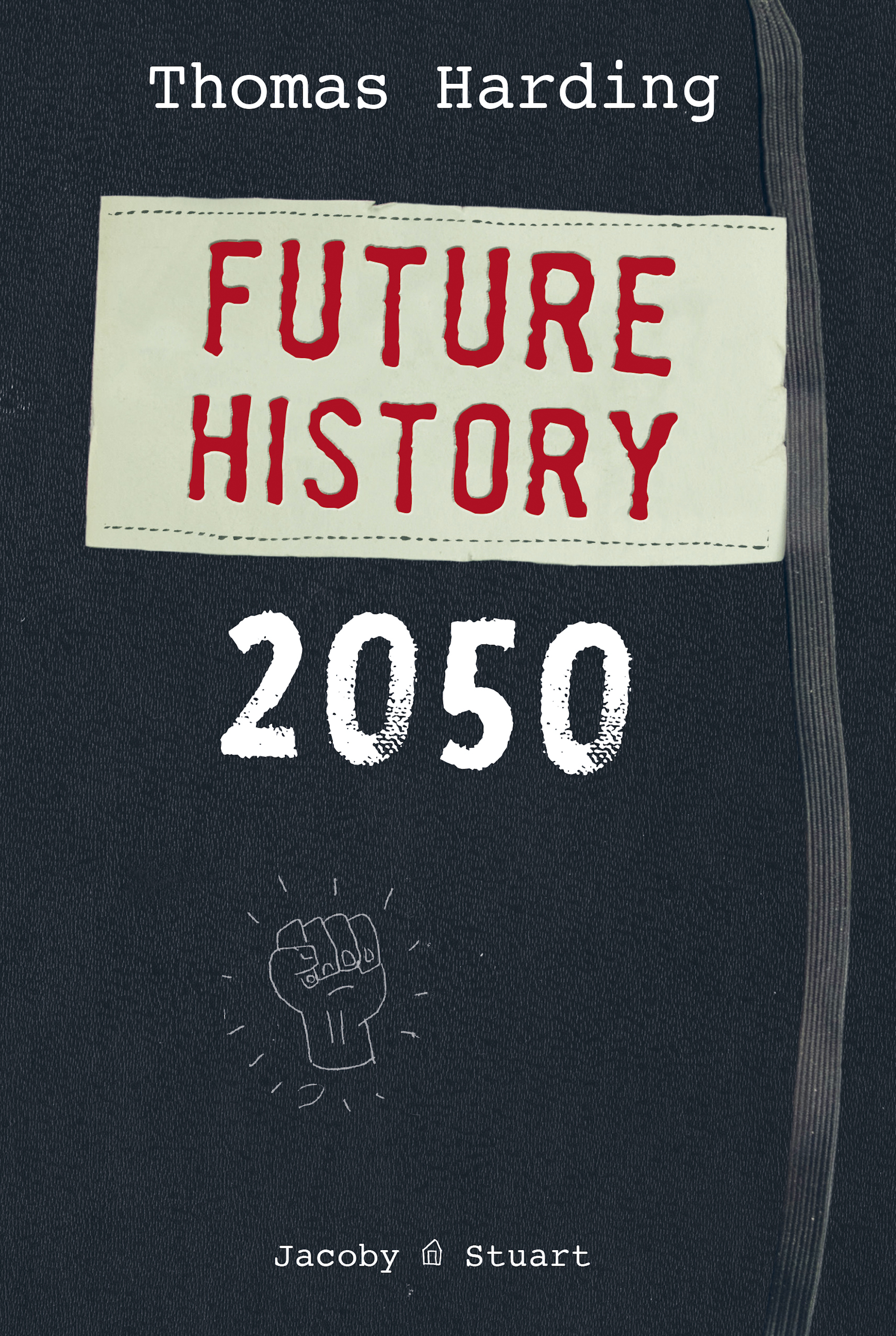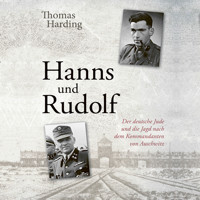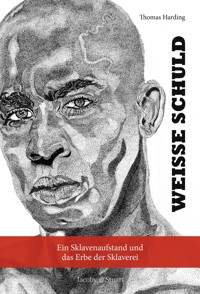9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Ein leidenschaftliches Erinnerungsbuch über Deutschland.« Neil MacGregor In den 1920er-Jahren war das Holzhaus am idyllischen See von Groß Glienicke das Ferienparadies für die jüdische Familie Alexander gewesen. Für Elsie Alexander, die Großmutter von Thomas Harding, blieb es trotz Verfolgung und Vertreibung durch die Nazis ein Ort für die Seele. Wie durch ein Wunder steht das Haus noch immer, über Jahrzehnte Zufluchtsort für fünf Familien, deren Schicksale das deutsche 20. Jahrhundert spiegeln. Nach Kriegsende lag es auf DDR-Gebiet. Die Mauer wurde durch den Garten gebaut, am Seeufer entlang. Zuletzt stand es leer, verfiel und sollte abgerissen werden. Doch Thomas Harding und seine Mitstreiter vor Ort sorgten dafür, dass dies nicht geschah. Er beschloss, dem Haus seine Geschichte wiederzugeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Thomas Harding
Sommerhaus am See
Fünf Familien und 100 Jahre deutscher Geschichte
Aus dem Englischen von Daniel Bussenius
Mit zahlreichen Abbildungen und Karten
Für Elsie
»… auch im märkischen Sande flossen und fließen überall die Quellen des Lebens, und jeder Fuß breit Erde hat seine Geschichte und erzählt sie auch – man muß nur willig sein, auf die oft leisen Stimmen zu lauschen.«
Theodor Fontane, 18. Januar 1864
Vorbemerkung des Autors
Bei der Erzählung der Geschichte des Sommerhauses stütze ich mich in erster Linie auf Berichte von Zeitzeugen, auf Menschen, die um das Haus und seine Geschichte wissen, und auf Berichte von Augenzeugen, also auf diejenigen, die die geschilderten Ereignisse selbst erlebt haben. Ich habe alles versucht, um ihre Aussagen durch weitere Quellen zu bestätigen.
Prolog
Im Juli 2013 flog ich von London nach Berlin, um das Sommerhaus zu besuchen, das mein Urgroßvater gebaut hatte.
Am Flughafen Schönefeld nahm ich mir einen Leihwagen, fuhr über die Autobahn bis zu einem Funkturm, der ein bisschen wie der Eiffelturm aussah, und von dort weiter Richtung Olympiastadion und Spandau. An einer Tankstelle bog ich nach links ab. Die Landstraße führte mich durch einen dichten Birkenwald, der nur gelegentlich den Blick auf ausgedehntes Ackerland freigab. Ich wusste, irgendwo zu meiner Linken floss die Havel, aber sie versteckte sich hinter Bäumen. Es war 20 Jahre her, dass ich zuletzt hier gewesen war, und nichts kam mir vertraut vor.
Nach 15 Minuten hieß mich ein Schild in der Ortschaft Groß Glienicke willkommen. Ein paar Meter weiter stand ein zweites Schild. Es markierte einen ehemaligen Grenzübergang zwischen Westberlin und Ostdeutschland. Ich drosselte das Tempo. Nach einem halben Kilometer sah ich den Orientierungspunkt, den ich gesucht hatte: einen cremefarbenen Torbogen gegenüber einer kleinen Feuerwache. Ich fuhr hindurch und parkte das Auto.
Ich wusste nicht mehr genau, welche Richtung ich einschlagen sollte. Ich hatte keine Karte der Ortschaft und es gab niemanden, den ich hätte fragen können, also verriegelte ich das Auto und ging ein paar Schritte auf einem kleinen Pfad entlang, der von Unkraut und Brombeersträuchern überwachsen war. Dann entdeckte ich ein Straßenschild mit der Aufschrift »Am Park«. War es das? War der Weg nicht sandig gewesen? Ich erinnerte mich vage an ein Gemüsebeet und eine Hundehütte, an einen ordentlich angelegten Garten und schmucke Blumenrabatten. 50 Meter weiter endete der Weg abrupt an einem breiten Metalltor mit dem Hinweis »privat«. Mir war bewusst, dass ich hier ohne Erlaubnis eindrang, dennoch duckte ich mich unter einem Stacheldraht hindurch und suchte mir einen Weg durch schulterhohes Gras in die Richtung, in der ich den See vermutete. Links stand eine Reihe moderner Backsteinhäuser und rechts erstreckte sich eine wild wuchernde Hecke. Und plötzlich sah ich es: das Haus meiner Familie. Es war kleiner, als ich es in Erinnerung hatte, nicht viel größer als ein Sportpavillon oder eine Doppelgarage, zugewachsen von Büschen, Kletterpflanzen und Bäumen. Die Fenster waren mit Sperrholzplatten zugenagelt, das nahezu flache schwarze Dach war rissig und mit herabgefallenen Zweigen bedeckt, die gemauerten Schornsteine bröckelten und wirkten einsturzgefährdet.
Sommerhaus, Juli 2013
Langsam umrundete ich das Haus, berührte abblätternde Farbe und verrammelte Türen, bis ich auf ein zerbrochenes Fenster stieß. Ich kletterte hinein. Mithilfe meines I-Phones beleuchtete ich das Innere. Was ich sah, waren Berge von schmutziger Kleidung und gammeligen Kissen, mit Graffiti beschmierte Wände, Schimmel, zerstörte Haushaltsgeräte, Teile der Einrichtung, verrottende Dielen und leere Bierflaschen. Ein Raum schien als Drogenhöhle genutzt worden zu sein; er war übersät mit kaputten Feuerzeugen und verrußten Löffeln. Ein trauriger Ort mit der Melancholie eines verlassenen Gebäudes.
Ich kletterte durch das Fenster wieder nach draußen und ging zu dem Haus nebenan. Vielleicht würde ich jemanden antreffen. Ich hatte Glück, eine Frau arbeitete im Garten. Unbeholfen stellte ich mich in gebrochenem Deutsch vor. Sie antwortete auf Englisch. Ich erklärte, dass ich zu der Familie gehörte, die in dem Haus gelebt hatte. Ob sie wisse, was damit passiert war und wem es gehörte. »Es steht seit mehr als einem Jahrzehnt leer«, sagte sie und deutete zum Ufer. »Die Berliner Mauer wurde dort errichtet, zwischen dem Haus und dem See«, erklärte sie. »Es hat viel durchgemacht, aber jetzt ist es ein Schandfleck.« Seltsamerweise schien sich ihr Ärger gegen mich zu richten. Ich nickte bloß.
Mein ganzes Leben hatte ich von dem Haus am See oder von »Glienicke« erzählen gehört. Für meine Großmutter Elsie war es zu einer fixen Idee geworden, sie sprach wie verzaubert davon; die Erinnerung daran beschwor für sie eine Zeit herauf, in der das Leben leicht und glücklich und das Haus ihr Ort für die Seele war.
Meiner Familie, den Alexanders, war es im liberalen Berlin der 1920er Jahre gut gegangen. Sie waren wohlhabende, weltoffene Juden, die die deutschen Werte teilten: Sie arbeiteten hart, gingen gern in die neuesten Ausstellungen, in Theateraufführungen und Konzerte und unternahmen ausgedehnte Wanderungen im Berliner Umland. Sobald sie es sich leisten konnten, bauten sie sich ein kleines Holzhaus am Groß Glienicker See, ein Symbol ihres Erfolgs. Hier verbrachten sie jeden Sommer und genossen ihr einfaches, rustikales Leben, das mit Gartenarbeit, Schwimmen im See und Partys auf der Terrasse ausgefüllt war.
Dem machte der Aufstieg der Nazis ein Ende. Sie waren gezwungen zu fliehen und ließen sich in London nieder, wo sie hart kämpfen mussten, um sich ein neues Leben aufzubauen. Zwar waren sie entkommen, was so vielen anderen nicht gelungen war, aber sie hatten Deutschland mit fast nichts verlassen. Und so war Glienicke für meine Familie im Rückblick ein einst geliebter Ort, der ihnen gestohlen wurde und nun in einem verabscheuten Land lag.
Soweit ich mich erinnern kann, mied meine Familie alles Deutsche. Wir kauften keine deutschen Autos, Waschmaschinen oder Kühlschränke. Wir machten überall in Europa Urlaub – in Frankreich, der Schweiz, in Spanien, Italien –, aber niemals in Deutschland. In der Schule lernte ich Spanisch und Französisch, sogar Latein, nur kein Deutsch. Die Älteren – meine Großmutter und mein Großvater, meine Großonkel und -tanten – erzählten kaum von ihrem Leben in Berlin, von den Jahren vor dem Krieg. Dieses Kapitel war abgeschlossen. Sie wollten sich nicht mehr mit der Vergangenheit befassen, sondern konzentrierten sich auf das neue Land. Jeder emotionale Bezug zu ihrem Leben in den 1920ern war abgerissen. Sie wurden britischer als die Briten, sie schickten ihre Kinder auf die besten Schulen und ermutigten sie, Ärzte, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer zu werden.
Als ich älter wurde, begriff ich, dass unsere Beziehung zu Deutschland nicht so schwarz-weiß war, wie man mich glauben gemacht hatte. Mein Großvater weigerte sich vom Tag seiner Ankunft in England an, je wieder ein Wort Deutsch zu sprechen, aber meine Großmutter Elsie pflegte ihr Deutsch. Sie begleitete als Reiseleiterin regelmäßig Busladungen deutscher Touristen durch England und hielt bewusst überschwängliche Lobreden auf Shakespeare, die Magna Charta und das, was sie »British Fair Play« nannte. Durch ihre Erinnerungen, Kommentare und gelegentlichen Witze bekam ich Spuren eines verlorenen Lebens mit.
1993, vier Jahre nach dem Mauerfall, sah ich das Haus zum ersten Mal. Ich war 25 Jahre alt. Zusammen mit Elsie und meinen Cousins und Cousinen unternahm ich damals einen Wochenendtrip nach Deutschland. Endlich war sie bereit, uns die Stadt ihrer Kindheit zu zeigen. Wir, die jüngere Generation, betrachteten es als einen schönen Familienausflug, eine Reise in die Vergangenheit unserer Großmutter. Doch erst während des Flugs nach Berlin begann ich zu verstehen, was diese Reise eigentlich bedeutete – was dieses andere Leben war. Im Flugzeug saßen wir getrennt. Irgendwann stand meine Großmutter auf, kam durch den Gang auf mich zu und setzte sich auf meine Armlehne. »Darling«, sagte sie mit ihrem starken deutschen Akzent, »ich will, dass du das siehst«, und gab mir einen braunen Umschlag. Darin befanden sich zwei olivgrüne Reisepässe aus der Nazizeit, die ihrem Ehemann und ihrem Schwiegervater gehört hatten, sowie ein gelbes Stück Stoff, auf dem ein schwarzes J prangte. Ich wusste, dass die Nazis die Juden gezwungen hatten, solche Kennzeichen zu tragen. Die Botschaft war klar: Das ist meine Geschichte, und das ist deine Geschichte. Vergiss das nicht.
Und ich vergaß es nicht. Als wir wieder in London waren, begann ich Fragen zu stellen – zur Vergangenheit meiner Familie und warum so sorgfältig vermieden wurde, darüber zu sprechen. Mein Interesse war geweckt und es sollte nie mehr nachlassen. Deshalb buchte ich zwei Jahrzehnte später einen Flug nach Berlin und kam zurück zum Sommerhaus – um herauszufinden, was mit dem »Seelenort« meiner Großmutter passiert war.
Am nächsten Tag fuhr ich zur Kommunalverwaltung in Potsdam, 20 Minuten südlich von Groß Glienicke. Dort fand ich im Keller des Verwaltungsgebäudes einen Informationsschalter, an dem eine ältere Dame vor ihrem Computer saß. Ich zog meinen Sprachführer heraus und bat stockend um die Grundakte des Hauses. Die Frau erklärte mir, ich bräuchte die Erlaubnis des Eigentümers, um die Dokumente einzusehen. Als ich sagte, dass mein Urgroßvater 1950 gestorben war, zuckte sie bloß mit den Schultern. Ich versuchte, sie zu überreden, und nachdem ich meinen Reisepass und Kreditkarten vorgelegt und einen groben Familienstammbaum aufgezeichnet hatte, gab sie schließlich nach und verschwand in ein Hinterzimmer. Mit einem Bündel Unterlagen tauchte sie nach einiger Zeit wieder auf. Sie tippte mit ihrem Finger auf das oberste Blatt und erklärte, das Haus und das zugehörige Grundstück seien nun Eigentum der Stadt Potsdam. Ich fragte, was das bedeute – was würde aus dem Haus werden? Sie wandte sich wieder ihrem Computer zu, tippte die Parzellennummer ein und drehte den Bildschirm in meine Richtung: »Es wird abgerissen«, sagte sie. Zwanzig Jahre war ich nicht mehr hier gewesen, und nun sah es so aus, als sei ich gerade rechtzeitig zum Abriss des Hauses zurückgekommen.
Ich verließ ihr Büro und sah mir die Tafel der Dezernate an, die in der Eingangshalle hing. Etwas stach mir ins Auge: »Einsichtnahme in historische Bauakten und Baupläne«. Mein Deutsch reichte aus, um zu verstehen, dass »Bau« Gebäude bedeutete und »historisch« etwas mit Geschichte zu tun hatte. Ich stieg die Treppen hinauf, betrat einen langen Korridor mit lauter weißen Türen und klopfte an einer an. In dem Raum waren zwei Denkmalschützer: eine großgewachsene, schlanke Frau in den Vierzigern und ein kleiner, bärtiger Mann gleichen Alters. Ich fragte, ob sie Englisch sprächen, und dann erzählte ich ihnen das Wenige, das ich von dem Haus wusste, und von den Plänen der Stadt, es abzureißen. Trotz meines unangemeldeten Besuchs und meiner bruchstückhaften Erklärung waren sie freundlich und wollten mir helfen. Der Mann zog ein Gesetzbuch aus dem Regal und blätterte darin, bis er den Abschnitt fand, den er suchte. »Die Schutzklausel«, sagte er und hielt mir das Buch hin. Wenn ich den Abriss des Hauses verhindern wolle, fuhr er fort, müsse ich belegen, dass es kulturelle und historische Bedeutung habe.
Bevor ich Berlin wieder verließ, kehrte ich noch einmal zu dem Haus zurück. War es zu retten? Es wäre eine riesige Aufgabe und eine kostspielige. Ich bemerkte neue Einzelheiten – zerbrochene Fensterläden am Boden, verrostete Dachrinnen und Bäume, die durch die steinerne Terrasse wuchsen. Ich lebte Hunderte von Meilen entfernt in England und sprach kaum Deutsch. Mein Leben war bereits hektisch genug. Ich hatte keine Zeit, mir ein weiteres Projekt aufzuladen, und sowieso schien es bereits zu spät zu sein.
Und außerdem: Warum sollte das Haus überhaupt gerettet werden? So, wie es vor mir stand, wirkte es wenig beeindruckend, ein Fragment einer halb vergessenen Erinnerung. Es war eigentlich ein Nichts, kaum mehr als eine Ruine. Doch irgendetwas war an dem Haus, etwas nicht Greifbares, etwas Unwiderstehliches. Vor allem war es für meine Großmutter immer sehr wichtig gewesen. Es hatte ihr enorm viel bedeutet und sie hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass es auch uns, ihren Enkeln, viel bedeuten sollte. Es wäre zu einfach gewesen wegzugehen.
Dies ist nun also die Geschichte eines Holzhauses an einem See in der Nähe von Berlin. Eine Geschichte von neun Zimmern, einer kleinen Garage, einer langgestreckten Grünfläche und einem Gemüsebeet. Die Geschichte, wie es zu seiner Errichtung kam, wie seine Bewohner es veränderten und wie sie im Gegenzug von ihm verändert wurden.
Es ist die Geschichte eines Hauses, das von fünf Familien geliebt und verloren wurde. Eine Geschichte der alltäglichen Momente, die aus einem Haus ein Zuhause machen: morgendliche Hausarbeiten, Familienmahlzeiten um den Küchentisch, Nickerchen an einem Sommernachmittag und Tratsch bei Kaffee und Kuchen. Es ist eine Geschichte von häuslichen Triumphen und Tragödien, von Hochzeiten und Geburten, heimlichen Rendezvous und Verrat, Krankheit, Einschüchterung und Mord.
Außerdem ist es die Geschichte Deutschlands in einem turbulenten Jahrhundert. Die Geschichte eines Hauses, das den seismischen Veränderungen, die die Welt erschütterten, widerstand. Denn auf seine eigene stille und vergessene Weise befand sich das Haus an der vordersten Front der historischen Ereignisse – die Leben seiner Bewohner waren voller Brüche und wurden immer wieder in neue Bahnen gelenkt, allein deshalb, weil sie hier stattfanden.
Vor allem aber ist es eine Geschichte des Überlebens, rekonstruiert aus Archivmaterialien und Bauplänen, kürzlich freigegebenen Dokumenten, Briefen, Tagebüchern und Fotografien sowie Gesprächen mit Historikern, Architekten, Botanikern, Polizeioffizieren, Politikern, Dorfbewohnern, Nachbarn und – am wichtigsten – den Bewohnern des Hauses.
Dies ist die Geschichte vom Sommerhaus am See.
Teil I:Glienicke
Kapitel 1Wollank
1890
Langsam ritt Otto Wollank zwischen reifenden Weinreben auf einen See zu, der im Morgenlicht schimmerte. Der Weg war sandig und gefährlich, er musste aufpassen, dass seine Stute nicht auf einem der vielen Steine ausrutschte oder an den knorrigen Zweigen entlangstreifte, die den Weg säumten. Aber er war nicht in Eile, sondern sann darüber nach, ob er die Ländereien erwerben sollte, auf denen er sich gerade bewegte.
Von durchschnittlicher Körpergröße, unscheinbarer Statur und mit seinem runden Kinn hätte der 27-Jährige kaum beeindruckt, wäre da nicht der enorme Schnurrbart gewesen, den er unter einem weißen Filzhut zur Schau trug, der schief auf seinem Kopf saß.
Vom Hangrand des Weinbergs blickte er auf das Land. Im Zentrum des Gutsbesitzes lag der schöne Groß Glienicker See. Mit einer Länge von zweieinhalb Kilometern und einer Breite von 500 Metern war er groß genug, um darauf mit einer Jolle zu segeln, aber kleiner als die meisten anderen Gewässer in der Mark Brandenburg. Man könne hier gut fischen, hatte man ihm gesagt: Karpfen und Aal oder – mit etwas Geschick – einen der Hechte, die, bis zu eineinhalb Meter lang, im tiefsten Bereich des Sees schwammen.
Otto Wollank
Im Osten und Westen reichte dichter Wald bis an das Seeufer: Schwarzerlen, hochragende Bäume mit schlanken schwarzen Stämmen und ausladenden Kronen sowie Trauerweiden, deren Äste über das Ufer hingen. Darunter wuchsen auf dem sandigen Boden Giersch, Flieder und Schwertlilien und verbreiteten einen süßlichen Geruch. Hohe Gräser wiegten sich im Flachwasser, abwechselnd mit Lilienfeldern in Pink, Weiß und Gelb. Auf der Nordseite des Sees erstreckte sich ein Sumpfgebiet und daran angrenzend ein alter Kiefern- und Eichenwald, in dem ganz unterschiedliche Tiere zu Hause waren – Rotwild, Wildschweine und Füchse – und ihn so zu einem attraktiven Jagdrevier machten. Westlich des Waldes lag die Döberitzer Heide, die seit mehr als 100 Jahren vom preußischen Militär als Truppenübungsplatz genutzt wurde.
Das Seeufer war nicht erschlossen, es gab kein einziges Haus, keinen Hafen, nicht einmal einen Steg. Kein Wunder, dass dieses Gebiet ein Paradies für Vögel war: große weiße Kraniche, die es auf ihrem Weg von Sibirien und Skandinavien nach Spanien passierten; Rohrdommeln, die ihre lauten Rufe aus dem dichten Schilf ertönen ließen; Schwäne, die paarweise über das Wasser schwammen; und Spechte, die gegen die Bäume hämmerten.
Der Gutsbesitz, der als einer der größten in der Mark Brandenburg beworben wurde, umfasste einige der schönsten und ertragreichsten Ländereien. Zudem war er trotz seines entschieden ländlichen Charakters lediglich einen Morgenritt von zwei bedeutenden Städten entfernt: Berlin und Potsdam. Das Anwesen hatte viele Namen. Einige kannten es als »Gut Ribbeck«, nach der berühmten Familie Ribbeck, der es von 1572 bis 1788 gehört hatte. Aber die Ribbecks hatten nicht mehr als ein Jahrhundert auf dem Gut gelebt, und da es seitdem so oft den Besitzer gewechselt hatte, nannte es die Dorfbevölkerung inzwischen »Rittergut Groß Glienicke« oder einfach »Gutshof«. Seit 60 Jahren waren die Landefeldts Eigentümer des Guts, eine ortsansässige Familie, der die Landwirtschaft im Blut lag. Aber nach Jahren der Misswirtschaft und fallender Gewinne waren sie gezwungen, den Besitz zu verkaufen.
Zum Verkauf standen 4000 Morgen Land (ein Morgen war die Fläche, die ein Mann mit einem Ochsen an einem Morgen pflügen konnte), insgesamt hatte der Gutsbesitz eine Länge von zweieinhalb Kilometern und eine Breite von vier Kilometern. Dazu gehörten eine Vielzahl landwirtschaftlicher Gebäude, die Rinder, Schweine, Ziegen, Gänse und Pferde, die die Weiden und Ställe bevölkerten, die Landwirtschaftsgeräte sowie der Jahresertrag.
Otto wendete sein Pferd und ritt zurück nach Groß Glienicke am nördlichen Ende des Westufers. Groß Glienicke war eine alte Siedlung, eine der ältesten in der Gegend, und ging auf das Jahr 1267 zurück. Der Ort war abgeschottet, die Familien lebten hier schon seit Generationen, kannten einander gut und fürchteten Fremde. Mit Ausnahme eines katholischen Ehepaars waren alle etwa 300 Ortsbewohner protestantisch. Kleine Steinhäuser säumten die Straße, die 100 Meter vom Wasser entfernt auf der Westseite des Sees verlief. Es gab ein Lebensmittelgeschäft, eine Bäckerei, ein kleines Schulgebäude mit Steinfassade und eine Windmühle. In der Ortsmitte befand sich der Gasthof Drei Linden, ein zweistöckiges Gebäude, das jahrhundertelang als Wasserstelle gedient hatte und vor dem drei Lindenbäume standen. Wie in anderen europäischen Ländern galt die Linde auch in Deutschland als ein heiliger Baum, der vor Unglück schützt.
Am Nordende des Sees, 200 Meter vom Ufer entfernt, stand das Schloss. Das dreistöckige Gebäude war aus weißen Ziegelsteinen gemauert, hatte ein Dach mit flacher Neigung und einen Turm, mehr als 20 Schlafzimmer und 16 Feuerstellen. Die Böden in den Wohn- und Esszimmern hatten weiße Eichendielen, die Treppen waren aus poliertem Marmor und die Wände mit feinstem Putz bedeckt. Fresken zierten die Decken im Eingangsflur: Eines zeigte einen fast nackten Mann, der mit einem Pfeil auf einen Kranichschwarm zielt; ein anderes, wie Engel Blütenblätter auf eine barbusige Frau herabregnen lassen, die geziert zur Seite blickt, und auf einer goldenen Harfe für sie musizieren.
Als er seinen Ritt über den Gutsbesitz fortsetzte, sah Otto überall geschäftige Arbeiter. Frauen mit weißen Kopftüchern, Holzschuhen und langen grauen Kleidern zogen große quadratische Bleche mit Brot aus dem Ofen. Eine Gruppe von Landarbeitern kniete in einem schlammigen Feld neben Holzkörben und setzte Kartoffeln in lange, gefurchte Reihen. Männer mit grauen Mützen, Hemden und Westen, die eines der vielen Felder pflügten, gingen hinter ihren Pferden her und trieben sie mit Peitschen an. Andere banden Weizen zusammen, während sich in ihrem Rücken die vier Flügel der Windmühle drehten. Ihre ernsten Gesichter waren vom Wetter gegerbt.
Otto gefiel der Gutsbesitz. Es war ein liebenswürdiger Ort voller Möglichkeiten, bot ein gemächliches, von Traditionen durchdrungenes Leben, und man fühlte sich nicht beengt.
Groß Glienicke lag 15 Kilometer westlich der Berliner Stadtgrenze. Während sich das Leben in der kleinen Brandenburger Ortschaft kaum verändert hatte, konnte man das von Berlin nicht behaupten, denn um 1890 war es zur wichtigsten Stadt in Deutschland aufgestiegen.
19 Jahre zuvor war Berlin Hauptstadt des neuen Deutschen Reiches geworden. Bis dahin war Deutschland ein fragmentiertes Land gewesen, ohne eine effektive, zentralisierte ökonomische, militärische oder wirtschaftliche Struktur. 1871 waren die 25 Staaten Deutschlands, darunter Königreiche, Großherzogtümer und freie Städte, zu einem einzigen Reich unter der Herrschaft von Kaiser Wilhelm I. vereinigt worden.
Im selben Jahr war Berlin zum Sitz des neuen Reichstags, des Parlaments, bestimmt worden. Seine Mitglieder wurden von den Männern, die mindestens 25 Jahre alt waren, direkt gewählt; der Kaiser ernannte den Kanzler. Als Regierungssitz zog die Stadt mächtige Interessenten an, für die Heerscharen von Fachkräften arbeiteten, jede mit ihrem Anhang, ihrer Familie und ihren Hausangestellten. Dann gab es noch das Militär mit seiner einflussreichen Offizierskaste, dessen Präsenz überall in der Stadt zu spüren war. Fast jeden Tag sah man Soldaten durch die Stadt paradieren und marschieren. Uniformen wurden sowohl im als auch außer Dienst getragen, sie waren zur Mode und zu Statussymbolen geworden. In den Kasernen in Berlin und im nahen Potsdam lebten Zehntausende Soldaten.
Zwischenzeitlich war die Stadt auch zu einem der führenden intellektuellen und kulturellen Zentren Europas aufgestiegen. Zu den ehemaligen Professoren, Dozenten und Studenten der Friedrich-Wilhelms-Universität zählten Arthur Schopenhauer, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx und Friedrich Engels. Das Kaiser-Friedrich-Museum präsentierte außergewöhnliche byzantinische und ägyptische Altertümer sowie Gemälde der Meister Raffael und Giotto, Rembrandt und Holbein; es gehörte zu den besten Museen Europas.
Im Jahr 1888 folgte auf Kaiser Wilhelm sein Sohn Friedrich III., der jedoch nach nur 99-tägiger Herrschaft an Kehlkopfkrebs verstarb. Daraufhin bestieg der erst 29 Jahre alte Wilhelm II. den Thron. Für das riesige weiße Barockschloss am Spreeufer – das Zentrum kaiserlicher Herrschaft und Patronage – arbeiteten Tausende von Höflingen und Bürokraten, Buchhaltern und Ingenieuren, Künstlern und Bankern.
Diese bedeutsamen Veränderungen führten dazu, dass sich die neue Reichshauptstadt in kurzer Zeit von einer schläfrigen Provinzstadt in eine der führenden europäischen Metropolen verwandelte. Ihre rasch wachsende Wirtschaft zog Massen von Zuwanderern an, zwischen 1871 und 1890 verdoppelte sich die Einwohnerschaft von 800000 auf 1,6 Millionen.
Im Zuge dieser Expansion wurden weite Gebiete am Stadtrand bebaut. Die große Mehrzahl der neuen Gebäude waren Wohnblocks, die häufig hastig und kostengünstig errichtet wurden. Bald machten Mieter zwei Drittel der Stadtbevölkerung aus. Die Bauunternehmer, von denen viele aus der Mittelklasse stammten, häuften schnell ein großes Vermögen an. Einer dieser Unternehmer war Otto Wollank.
Otto, geboren am 18. September 1862 in Pankow, einem nördlichen Vorort von Berlin, war der älteste Sohn unter fünf Kindern und erst fünf Jahre alt, als sein Vater Adolf Friedrich Wollank mit 34 Jahren verstarb. Zum Glück für die Familie hinterließ Adolf eine große Erbschaft; er hatte Mitte des Jahrhunderts, vor der Berliner Bevölkerungsexplosion, in Pankow Hunderte Morgen Land gekauft. Damals waren die Preise noch niedrig.
Nach seinem Schulabschluss 1881 besuchte Otto die landwirtschaftliche Hochschule in Berlin und sammelte Arbeitserfahrung auf verschiedenen Gütern in Norddeutschland. In dieser Zeit reiste er auch nach Frankreich, Italien, Nordafrika, Griechenland und in die Türkei. Mit 20 Jahren begann Otto seinen Militärdienst beim zweiten Garde-Dragoner-Regiment, wo er seine Reitkünste perfektionierte und eine militärische Grundausbildung absolvierte. Anschließend kam er zu den Danziger Totenkopfhusaren, die dafür bekannt waren, dass sich in ihren Reihen einige der besten deutschen Reiter befanden und militärische Berater von Kaiser Wilhelm aus ihnen hervorgingen.
Im Anschluss an den Militärdienst übernahm Otto das Immobiliengeschäft seines Vaters und vergrößerte es in den folgenden Jahren rasch. Es war relativ leicht, Geld zu verdienen. Alles, was Otto tun musste, war willige Käufer zu finden – kein schwieriges Unterfangen angesichts des Wohnraummangels in der Stadt. Schon nach kurzer Zeit erzielte er große Gewinne. Die Frage war, wie er sie investieren sollte.
Otto war ein ehrgeiziger Mann. Er wollte über den Status seines Vaters als Geschäftsmann hinaus vorwärtskommen. In seiner Zeit als Offizier im Heer und beim Grundstücksverkauf in Berlin hatte er begriffen, dass die Macht in den Händen der Aristokratie lag. Wie viel Reichtum man auch erlangte, er brachte nicht die gleiche gesellschaftliche Anerkennung wie die Zugehörigkeit zum Adel. Um diese Barriere zu überwinden, müsste er ein Rittergut erwerben und darauf hoffen, in eine Adelsfamilie einheiraten zu können. – Das hatte Otto Wollank dazu gebracht, den Gutsbesitz Groß Glienicke zu inspizieren.
Am 18. Februar 1890 gab er, offenbar zufrieden mit dem, was er gesehen hatte, ein Kaufangebot ab, das angenommen wurde. Vier Tage später, am 22. Februar, trafen sich der Gutsbesitzer Johann Landefeldt und der Käufer am Spandauer Gericht. Dort unterschrieben sie morgens um Viertel nach elf den Kaufvertrag: Für den Kaufpreis von 900000 Mark war Otto Wollank nun Rittergutsbesitzer von Groß Glienicke.
In den nächsten Jahren arbeitete Otto unermüdlich an der Modernisierung des Guts. Er wollte unbedingt die wissenschaftlich fundierten Methoden anwenden, die er auf der Landwirtschaftsschule gelernt hatte, und reorganisierte den Betrieb. So setzte er Düngemittel und Pestizide ein, um die Erträge zu steigern; er baute eine neue, dampfgetriebene Mühle, damit der Weizen besser gemahlen werden konnte; und er führte aus Gründen der Haltbarkeit die Pasteurisierung in die Milchproduktion ein. Dann etablierte er eine Reihe von Läden in Berlin, um die Milch dort zu verkaufen. Als Nächstes errichtete er eine Ziegelei, die Steine für den Hausbau auf dem Rittergut und in der Ortschaft produzierte, und verschaffte dem Gut so eine neue Einkommensquelle jenseits der traditionellen Landwirtschaft.
Am sandigen Nordufer des Sees legte er einen Weinberg an. Junge Reben wurden in langen Reihen angepflanzt, gehalten von Gittern, die vom Eingang des Gutshofs am Potsdamer Tor bis zum oberen Rand des Hangs über dem See reichten. Sobald geerntet werden konnte, wurden die Trauben von Landarbeitern gelesen, anschließend gepresst und schließlich in großen Metallbottichen, die Otto in einer Scheune untergebracht hatte, vergoren.
Aus Fürsorge für seine Arbeiter baute Otto ein altes Landwirtschaftsgebäude zu einer Kinderkrippe um. Bald kamen ein Kindergarten und eine Schule hinzu. Anfangs blieben die ortsansässigen Gutsbesitzer reserviert gegenüber dem Eindringling aus Berlin, der sich in ihren exklusiven Kreis eingekauft hatte, aber die Dorfbewohner entwickelten Sympathien für ihn. In einer unveröffentlichten Familiengeschichte beschreibt ein Mitglied der Wollanks Otto als einen »gütigen, mitfühlenden Gutsherrn«.
Am 15. Juni 1894, vier Jahre nachdem er sich hier niedergelassen hatte, heiratete Otto 31-jährig Katharina Anne Marie von Brietzke, eine aus dem Ort stammende 23-jährige junge Frau aus einer etablierten Brandenburger Familie. Ein Jahr später bekamen sie ihr erstes Kind, Marie Luise, und dann, elf Monate später, ein zweites, Ilse Katharina. Fast genau ein Jahr darauf wurde eine dritte Tochter, Irmgard, geboren, aber sie starb, als sie gerade einmal zwei Tage alt war. Schließlich wurde ihnen im Januar 1900 ein Sohn geboren. Er wurde im Schloss getauft und erhielt den Namen Horst Otto Adolf. Otto war dankbar, dass er endlich einen männlichen Erben hatte.
Das Schloss war für die Kinder ein wunderbarer Ort zum Aufwachsen. Marie, Ilse und Horst wurden zu Hause unterrichtet und hatten viel Zeit, um in den Feldern und Wäldern zu spielen. Ihr Vater baute ihnen ein hölzernes, mit Schnitzereien verziertes Kinderhaus, das hoch genug war, dass ein Erwachsener darin stehen konnte, und groß genug, um Freunde zu einer Feier einzuladen.
Sobald sie alt genug waren, durften die Kinder im See schwimmen und auf ihm segeln, seine Inseln und versteckten Strände und Buchten erkunden. Horst lernte – auch wenn er wegen seines dauerhaft schlechten Gesundheitszustandes oft nicht an den anstrengenderen Freizeitaktivitäten teilnehmen konnte – ein Pferd zu reiten und mit einer Luftpistole zu schießen, später auch mit einem Jagdgewehr. Derweil erhielten die Mädchen Gesangsunterricht.
Jedes Jahr im Oktober kamen die Dorfbewohner und die Wollanks zum Erntedankfest zusammen, um das Einbringen der Ernte und das glückliche Schicksal des Dorfes zu feiern. Die Dorfbewohner versammelten sich im Schlosshof und warteten auf die Ankunft des Gutsherrn. Die Männer trugen ihre Sonntagsanzüge, die wohlhabenderen dazu Filzhüte und Krawatten, andere Schirmmützen. Die festlich gekleideten Frauen wurden von Jungen in Lederhosen und Mädchen in hübschen Kleidern begleitet. Anwesend waren auch die Feuerwehrmänner, mit glänzenden Gürteln und Koppeln, der Gemeindepfarrer und der Nachtwächter, der im Haus neben dem Gasthof Drei Linden lebte und, da es keine lokale Polizei gab, für die Sicherheit in der Ortschaft sorgte.
Nach einer Weile erschien die Gutsherrnfamilie auf der Eingangstreppe des Schlosses und wurde von den Dorfbewohnern begrüßt. Dann wurden Kinder nach vorne geschoben, die die Erntekrone, einen Kranz aus Weizen und Blumen, an langen Stangen trugen, von denen bunte Bänder herabhingen. Nachdem der Gutsherr allen für ihr Kommen gedankt hatte, führte er sie, zusammen mit seiner Familie an der Spitze, entlang des sandigen Weges um das Nordende des Sees, vorbei an Wirtschaftsgebäuden und dem neuen Weinberg. Am Ende des Weges schritten sie durch das Potsdamer Tor, den Steinbogen, der den Eingang zum Schloss und dem Gutspark bildete und auf dem das Wollank’sche Familienwappen prangte: ein schwarzer Wolfskopf und eine Krone in den Farben Groß Glienickes: rot und weiß. Auf der Potsdamer Chaussee wandte sich der Festzug an der Feuerwache nach links und ging die Straße hinunter zur Gemeindekirche aus dem 14. Jahrhundert.
Während die übrige Gesellschaft die Kirche durch die große Holztür an der Nordseite des Langhauses betrat, benutzten die Wollanks den Privateingang des Gutsherrn an der Ostseite des Gotteshauses. Das Innere der Kirche glänzte nach der Renovierung, die Wollank bezahlt hatte: Eine Krone aus mit Goldfransen besetztem Alabaster hing über der Kanzel, die in Grün-, Blau- und Rottönen gestrichen war; ein großes Ölgemälde Christi, beschriftet mit den Worten Ecce Homo, befand sich hinter dem Altar; ein weiteres Ölgemälde mit dem Motiv des Letzten Abendmahls zeigte einen der früheren Gutsbesitzer, Hans Georg von Ribbeck, als einen der Jünger; und in der Mitte der Decke schien die Sonne durch eine Lücke in den gemalten Wolken, auf der das hebräische Wort für Gott stand: הוהי.
Alles machte auf Otto Wollank einen geordneten und gesicherten Eindruck. Der Gutsbesitz entwickelte sich erfreulich, die Dorfbewohner waren gut genährt, seine Frau und die drei Kinder zufrieden und glücklich. Er saß in der Gutsherrenloge, die sich links neben dem Altar befand und an der Seite mit dem Familienwappen geschmückt war, und sang die Erntedanklieder. Nie schien sein Leben besser gewesen zu sein.
Kapitel 2Wollank
1913
1913 war das Rittergut zu einem landwirtschaftlichen Musterbetrieb geworden und erwirtschaftete endlich Gewinne.
Beeindruckt von Ottos unermüdlicher Arbeit, seinem ertragreichen Ackerland, seinen Viehherden und dem schönen Gut brachten ihm die örtlichen Gutsbesitzer inzwischen widerwillig Respekt entgegen. Er und seine Familie wurden nun zu Abendessen und anderen Anlässen eingeladen, seine jugendlichen Töchter vom lokalen Adel hofiert. Sein Sohn besuchte das Potsdamer Gymnasium. Er war dazu bestimmt, in das Offizierskorps einzutreten und vielleicht später die Beamtenlaufbahn einzuschlagen.
Bald waren die Verwandlung Groß Glienickes und die Leistungen seines Gutsherrn nach Berlin durchgedrungen. Am 16. April 1913 schrieb Otto Wollank ein Immediatgesuch an Kaiser Wilhelm II., in dem er um die Erhebung in den Adelsstand bat. Das war typisch für die Zeit, in der junge, aufstrebende Gutsbesitzer die Nähe zum kaiserlichen Hof suchten. In seinem Gesuch fasste Otto seinen Werdegang zusammen und erklärte dann unter der Überschrift »Politischer Standpunkt«, er sei in einer »politisch durch und durch konservativen Familie erzogen« worden und stehe »aus innerster Überzeugung fest auf königstreuem Boden«. Er schrieb weiter, dass er glaube, der königlichen Sache »trotz der Verhetzung der hiesigen Arbeiterbevölkerung durch Spandauer Agitatoren« in seiner Umgebung »mit gutem Erfolg« gedient zu haben.
Der Regierungspräsident von Potsdam, der in die Bearbeitung des Gesuchs durch die Staatsbehörden einbezogen wurde, bestätigte in seinem Bericht, dass Otto Wollank wahrheitsgetreue Angaben gemacht hatte, und listete sein Vermögen auf: das etwa 1000 Hektar große Rittergut Groß Glienicke (mit einem Wert von eineinhalb Millionen Mark), drei Häuser in Berlin (418638 Mark), Grundbesitz in Pankow (645667 Mark) und Kapitalvermögen (2127250 Mark).
Vier Monate später, am 19. August, wies Wilhelm II. in seinem Amt als preußischer König seine Regierung an, Otto Wollank zu adeln, und am ersten September erhielt Otto gegen die Entrichtung einer Gebühr von 4800 Mark vom preußischen Heroldsamt den Adelsnachweis. Die offizielle Bekanntgabe erfolgte im ›Staats-Anzeiger‹. Einen Empfang beim Kaiser persönlich gab es nicht, Otto feierte seine Standeserhebung mit seiner Familie und Freunden auf seinem Schloss.
Von nun an trug er den Namen Otto von Wollank. Das verschaffte ihm nicht nur Respekt und sozialen Status, sondern brachte ihm auch zusätzlich Aufgaben. Als Mitglied des Landadels wurde von ihm erwartet, dass er in Groß Glienicke die Führungsverantwortung übernahm. Auf Gelegenheit dazu musste er nicht lange warten.
Am Morgen des 30. Juni 1914 las Otto von Wollank im Esszimmer die Tageszeitung. Die ›Norddeutsche Allgemeine Zeitung‹ war ein konservatives Blatt, eine standhafte Unterstützerin des Kaisers.
Otto war schockiert. Laut dem Bericht auf der Titelseite waren der österreichische Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin am 28. Juni von einem serbischen Nationalisten in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo erschossen worden. Österreich-Ungarn galt als der wichtigste Verbündete des Kaisers; viele betrachteten einen Angriff auf die Habsburgerfamilie als einen Angriff auf Deutschland. Die ›Norddeutsche Allgemeine Zeitung‹ schrieb: »Erzherzog Franz Ferdinand ist mit unserem Kaiser in herzlichster gegenseitiger Neigung verbunden gewesen … Die Herzogin erfreute sich, wie allgemein bekannt ist, am Berliner Hofe lebhafter Sympathien … So wird unser Kaiserhaus von dem Heimgang des Erzherzogs und seiner Gemahlin aufs schmerzlichste getroffen. Wärmstes Mitleid wendet sich den drei Fürstenkindern zu, die so früh und so jammervoll verwaist sind.« Kaiser Wilhelm werde am Begräbnis in Wien teilnehmen.
In den nächsten Tagen und Wochen verfolgte Otto die Nachrichten mit zunehmender Beklemmung: Journalisten forderten die Festnahme des Attentäters, Regierungen stellten Ultimaten und Truppen wurden mobilisiert. Am 28. Juli erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg, am 1. August folgte die deutsche Kriegserklärung an Russland, und am 5. August 1914 standen in Ottos Zeitung die bedrohlichen Schlagzeilen: »Großbritannien erklärt Deutschland den Krieg« und »Jetzt gegen die Russen, die Franzosen und Engländer!« Der Erste Weltkrieg hatte begonnen.
Glaubte man den Zeitungen, würde Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach bald den Sieg davontragen. Mit seiner überwältigenden Heeresstärke, seiner unübertroffenen Militärausbildung und seiner modernen Kriegstechnik könne man sich, wie die Leitartikler meinten, einen längeren Krieg kaum vorstellen. Einen Patrioten und Anhänger des Kaisers wie Otto werden solche Argumente mit Sicherheit überzeugt haben, doch dürfte er als früherer Kavallerieoffizier auch Zweifel gehabt haben – wegen der generellen Unvorhersehbarkeit von Kriegen, der schieren Zahl der beteiligten Länder und ihrer noch nicht erwiesenen militärischen Stärke.
Bis Mitte August wuchs das deutsche Heer von 800000 auf mehr als dreieinhalb Millionen Soldaten an. Größtenteils ging der Zuwachs auf die Einberufung von Reservisten zurück, aber es hatten sich auch 185000 Kriegsfreiwillige gemeldet. Zu dieser Zeit gab es in Groß Glienicke etwas mehr als 120 Männer im arbeitsfähigen Alter. 80 von ihnen wurden nun einberufen, wodurch sich die männliche arbeitende Bevölkerung in der Ortschaft um zwei Drittel reduzierte. Bald litt das Rittergut unter Arbeitskräftemangel. Die Frauen waren gezwungen, die Aufgaben ihrer Männer, Brüder, Väter und Söhne zu übernehmen, und fuhren das Gros der Ernte in diesem Sommer ein. Bei der Erntedankfeier im Oktober, zwei Monate nach Kriegsbeginn, war die Abwesenheit der Männer wegen der vielen leeren Bänke in der Kirche nicht zu übersehen.
Mit 52 Jahren war von Wollank zu alt, um in den Krieg zu ziehen. Um seinem Vaterland trotzdem zu dienen, meldete er sich als Freiwilliger im Range eines Hauptmanns für das Zentral-Pferde-Depot 3 in Potsdam. Später wechselte er zum Generalkommando nach Berlin, wo er für die Verteilung von Nahrungsmitteln und anderen Vorräten an Krankenhäuser zuständig war.
Ottos militärische Laufbahn und seine Loyalität zum Kaiser legten die Vermutung nahe, dass sich sein 14-jähriger Sohn Horst so bald wie möglich zum Militär melden würde. Horst hatte bereits erlebt, wie zwei Jahrgänge über ihm das Abitur machten und anschließend direkt zum Militärdienst eingezogen wurden. Ein paar seiner Klassenkameraden, von denen einige nicht älter als 14 oder 15 Jahre waren, hatten sich als Freiwillige gemeldet. Horst aber setzte den Schulbesuch fort.
In den Zeitungen und über seine Verbindungen in Berlin informierte sich Otto über den Fortgang des Krieges. Seit Dezember 1914 hatte sich in Frankreich eine große Frontstellung entwickelt; Deutschlands 5. Armee aus Hunderttausenden Soldaten stand französischen Truppen gegenüber. Um den Stillstand zu beenden, startete das deutsche Heer im Februar 1916 einen Großangriff auf die französische Stadt Verdun. Nach anfänglichen Geländegewinnen führte die Schlacht, die 300000 Soldaten aufseiten des Kaisers das Leben kostete, zu einem blutigen Patt. Otto war inzwischen bewusst, dass wenig Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende bestand.
Konservativ eingestellt, wie er war, schickte er seine Töchter nicht auf eine höhere Schule und beteiligte sie auch nicht an der Leitung des Ritterguts. Stattdessen waren die jungen Frauen zu Hause bei ihrer Mutter, übten sich in Handarbeit, lasen und unterhielten Gäste. Während Horst, so es seine Gesundheit erlaubte, die landwirtschaftliche Hochschule besuchen und dann eine Ausbildung in einem Landwirtschaftsbetrieb durchlaufen würde, bestand der Zukunftsplan für die Töchter lediglich darin, passende Ehemänner für sie zu finden.
Auch wenn gesellschaftliche Anlässe seltener wurden, fanden gelegentlich noch Nachmittagstees und sonntägliche Mittagessen mit älteren Herrschaften und jüngeren Frauen aus der Umgebung statt. Was die Verheiratung von Marie Luise und Ilse betraf, bestand das Problem darin, dass die meisten der infrage kommenden Männer abwesend waren; sie wurden entweder gerade an Militärakademien ausgebildet oder dienten bereits an der Front. Solche Überlegungen wurden durcheinandergeworfen, als Ottos Ehefrau am 11. November 1916 im Alter von nur 45 Jahren plötzlich verstarb. Die Todesursache ist nicht überliefert. Nach einem Trauergottesdienst, an dem die meisten Ortsbewohner teilnahmen, wurde Katharina im Gutspark neben dem Schloss beigesetzt.
Otto verbrachte den Rest des Krieges damit, das Gut bestmöglich zu bewirtschaften. Am 29. Januar 1918 heiratete er Dorothea Else Müller, eine 19 Jahre jüngere Adelige aus Berlin. Alle Kinder Ottos nahmen an der Hochzeit teil, auch Horst, der zwar inzwischen Abitur gemacht hatte, aber wegen seines schlechten gesundheitlichen Allgemeinzustandes nicht eingezogen worden war.
Als seine neue Ehefrau im Schloss die Leitung des Hauspersonals übernommen hatte und sich um die Kinder kümmerte, hob sich Ottos Stimmung. Den Aussagen von Dorfbewohnern zufolge, die sich an Dorothea von Wollank erinnern konnten, war sie eine freundliche, zugängliche Frau, die von allen schnell ins Herz geschlossen wurde. Mit ihrer Ankunft verband sich die Hoffnung, die Dinge würden eine Wendung zum Besseren nehmen.
Am 11. November traf in der Ortschaft die Nachricht ein, dass der Krieg zu Ende sei. Eine deutsche Delegation unter Führung von Matthias Erzberger hatte Vertreter Englands und Frankreichs getroffen und einen Waffenstillstand unterzeichnet. Ottos Erleichterung über das Kriegsende wurde überschattet durch den Sturz des Kaisers, der infolge einer im Land aufgeflammten Soldatenrevolte in die Niederlande hatte fliehen müssen und bald darauf abdanken sollte. Er sorgte sich, was dies für das Rittergut und sein Ansehen in der Gesellschaft bedeuten würde.
Dorothea von Wollank
Im November und Dezember 1918 bemühten sich Politiker der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) in Zusammenarbeit mit dem Militär, das politische Vakuum zu füllen, aber die Interimsregierung war nicht in der Lage, die Ordnung lange aufrechtzuerhalten. Radikale linke Gruppen, inspiriert von der russischen Oktoberrevolution ein Jahr zuvor, stellten sich dem Streben nach parlamentarischer Demokratie entgegen. Ihre Proteste führten am 4. Januar 1919 zum sogenannten Spartakus-Aufstand, bei dem die Aufständischen Barrikaden in Berlin errichteten und mehrere Zeitungsredaktionen besetzten, darunter die des SPD-Zentralorgans. Zur Unterstützung des Aufstands rief die gerade gegründete Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) einen Generalstreik aus, dem sich in Berlin 500000 Arbeiter anschlossen. Eine der Hauptforderungen der Radikalen war die Umverteilung des Großgrundbesitzes. In den nächsten Tagen stießen die Aufständischen brutal mit Verbänden aus Kriegsveteranen zusammen, und Hunderte wurden getötet. Die Veteranen gewannen die Oberhand und eroberten das Stadtzentrum mit Unterstützung von Regierungstruppen zurück. Aber in den folgenden Monaten gab es in Berlin erneut Straßenkämpfe und weitere Aufstände in Hamburg und Frankfurt. In München wurde nach sowjetischem Vorbild eine Räterepublik ausgerufen, die von rechten paramilitärischen Verbänden gewaltsam niedergeschlagen wurde. Tausende starben in den Kämpfen.
Ottos Angst flaute ein wenig ab, als nach Wahlen am 19. Januar 1919 eine Verfassunggebende Nationalversammlung im thüringischen Weimar zusammentrat, die mehrheitlich die Absicht verfolgte, das Land zu stabilisieren, und bedeutende Veränderungen an den Machtstrukturen im Deutschen Reich vorsah. Frauen waren nun wahlberechtigt, ebenso alle Männer, die älter als 20 waren (zuvor hatte das Mindestwahlalter 25 Jahre betragen). Deutschland hatte als Staatsoberhaupt nun einen Präsidenten, der den Kanzler berief und entließ und der nach Artikel 48 der neuen Verfassung über die Macht verfügte, im Krisenfall Grundrechte außer Kraft zu setzen. Zudem wurde ein Reichsgericht geschaffen und die schwarz-weiß-rote Flagge des Kaiserreichs durch die schwarz-rot-goldene Trikolore ersetzt. Schließlich formulierte die Verfassung die Grundrechte der deutschen Bürger, Artikel 115 etwa bestimmte: »Die Wohnung jedes Deutschen ist für ihn eine Freistätte und unverletzlich.«
Die Regierungspolitiker verkündeten mit der neuen Verfassung und dem gestärkten Parlament den Beginn einer neuen Ära: die deutsche Republik. Später erhielt die neue Epoche den Namen »Weimarer Republik«. Das 1871 durch die deutsche Vereinigung begründete Kaiserreich mit seinem System kaiserlicher Patronage war offiziell Geschichte. Damit verlor der Adel alle seine Standesvorrechte. Otto konnte aber das »von« weiterhin als Teil seines Namens tragen und auch sein Gutsbesitz wurde nicht angetastet.
Die Bemühungen der Regierungspolitiker, den inneren Frieden wiederherzustellen, wurden durch den Friedensvertrag mit den Westmächten vom 28. Juni 1919, der als Versailler Vertrag bekannt wurde, stark beeinträchtigt. Der Vertrag empörte rechte und nationalistische Gruppen, sie sahen ihn als verräterisch und demütigend an. Deutschland musste den Alliierten als Wiedergutmachung für die Kriegsschäden erhebliche Reparationen zahlen und es verlor große Teile seines Territoriums, darunter Elsass-Lothringen an Frankreich und Teile von Oberschlesien an Polen. Am schlimmsten war aber wahrscheinlich – zumindest für die Soldaten und Offiziere, die im Krieg gekämpft hatten –, dass Deutschland seine Truppenstärke auf 100000 Mann senken und den Großen Generalstab auflösen musste und nur noch zwei Militärakademien unterhalten durfte: jeweils eine für das Heer und die Marine.
In der Nacht vom 12. auf den 13. März 1920 marschierte die Marinebrigade Ehrhardt in das Berliner Stadtzentrum, um die Regierung zu stürzen. Der Staatsstreich wurde als »Kapp-Putsch« bekannt, benannt nach einem seiner Anführer, Wolfgang Kapp. Die Reichsregierung und der Reichstag reagierten auf den Putsch, indem sie zunächst nach Dresden und dann weiter nach Stuttgart flohen. Um zu zeigen, dass sie noch immer die Unterstützung des Volks hatten, riefen die Politiker den Generalstreik aus und hatten Erfolg: Am 14. und 15. März gingen mehr als zwölf Millionen Menschen nicht zur Arbeit. Die Auswirkungen waren sofort spürbar: Das Verkehrs- und Transportwesen kam zum Erliegen und die öffentlichen Versorgungsbetriebe, wie Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke, mussten ihren Dienst einstellen. Nach wenigen Tagen brach der Putsch zusammen und die Regierung kehrte nach Berlin zurück. Trotz dieses glücklichen Ausgangs hatten die Ereignisse die tiefe Spaltung des Landes in linke und rechte politische Gruppierungen erkennen lassen.
Bald stand die Regierung vor dem nächsten gravierenden Problem: Ihr drohte das Geld auszugehen. Die Reserven waren im Krieg aufgebraucht worden und die schwache Wirtschaftslage und die politische Instabilität verschärften das Problem. Diese Situation spitzte sich weiter zu, als Deutschland damit begann, die enormen Reparationen an die Alliierten zu zahlen, die dem Land dringend benötigte Devisen entzogen. Die politische und wirtschaftliche Krise verbesserte auch nicht die Lage des Guts Groß Glienicke, das sich nur langsam von der Not der Kriegsjahre erholte. Mehr als 20 Männer aus der Ortschaft waren im Krieg gefallen und viele andere waren schwer verletzt worden, so dass sich die Zahl der arbeitsfähigen Männer um mehr als 30 Prozent verringert hatte.
1923 geriet Deutschland nicht zuletzt wegen des finanziell ruinösen Widerstands gegen die französische Ruhrbesetzung in eine Hyperinflation. Ende des Jahres 1921 war eine Goldmark zehn Papiermark wert gewesen, ein Jahr später waren es 10000 Papiermark und 1923 hundert Millionen Papiermark. Die Hyperinflation hatte unmittelbare Auswirkungen auf das Rittergut. Die Preise für Agrarprodukte brachen ein, während die für Dünger und Futter sowie die Löhne explodierten. Otto war angesichts der galoppierenden Geldentwertung nicht mehr in der Lage, seine Arbeiter zu bezahlen. Die ausbleibende Entlohnung demoralisierte die Arbeitskräfte und viele erschienen nicht mehr zur Arbeit. Das Gut stand vor dem Ruin.
Ottos einziges kleines Glück war seine Familie. Von 1920 an verheirateten sich innerhalb von vier Jahren alle seine Kinder. Seine ältere Tochter, Marie Luise, heiratete einen Grundbesitzer aus Bayern und ein Jahr später folgte die Hochzeit zwischen Horst und einer 22-Jährigen aus Oranienburg, einer kleinen Stadt nördlich von Berlin. Doch von allen Schwiegerkindern war Otto am meisten von Ilse Katharinas Bräutigam, Robert von Schultz, angetan.
Robert von Schultz, der 1897 in eine adelige Grundbesitzerfamilie auf Rügen geboren wurde, war von konservativen Traditionen durchdrungen. Mit 17 Jahren hatte er sich gleich zu Beginn des Weltkriegs als Kriegsfreiwilliger gemeldet, war drei Mal schwer verwundet worden und für seine Tapferkeit mit dem Eisernen Kreuz Erster Klasse und dem österreichischen Militärverdienstkreuz Dritter Klasse ausgezeichnet worden. Er hatte nach Kriegsende, wie viele seiner früheren Kameraden, in einem Freikorps gegen die Kommunisten in Berlin gekämpft und im Anschluss daran ein landwirtschaftliches Studium aufgenommen. Er war ein kleingewachsener, rundlicher Mann mit hoher Stirn und Doppelkinn und strahlte Selbstvertrauen und Wagemut aus.
Otto hatte viele Gemeinsamkeiten mit seinem Schwiegersohn: Sie waren beide glühende Monarchisten, hatten beide im Militär gedient und teilten die Leidenschaft für die Landwirtschaft. Nach der Hochzeit mit seiner Tochter bot Otto Robert an, an Horsts Seite mit ihm zusammenzuarbeiten. Eines Tages würde er einen der beiden jungen Männer auswählen, die Leitung des Guts zu übernehmen. Einstweilen ließ Otto wissen, dass er sich noch nicht entschieden hatte, ob es sein Sohn oder sein Schwiegersohn sein würde.
Binnen kurzer Zeit füllte sich der Gutshof mit Kinderwagen und Kindermädchen. Nichts tat Otto lieber, als auf der Terrasse zu sitzen und dabei zuzuschauen, wie seine Enkelkinder über die Wiese vor dem Anwesen tapsten oder den Gänsen und Enten am Seeufer hinterherliefen. Mit dem Schwinden der Kriegsfolgen kehrte langsam der alte Lebensrhythmus auf den Gutshof und in das Dorf zurück. Die Erntedankfeiern waren wieder besser besucht, ebenso die Gottesdienste an Ostern und Heiligabend. Eine der Mitarbeiterinnen des gutseigenen Molkereibetriebs, Frau Mond, eröffnete gegenüber dem Gasthaus Drei Linden einen Laden, in dem sie Milch, Käse und Butter verkaufte. Und ein Fleischer aus Kladow, einer Ortschaft auf der Ostseite des Sees, eröffnete eine Filiale in Groß Glienicke, in der er erstklassige Steaks, Koteletts und Würste verkaufte. Für den Ort schienen bessere Zeiten anzubrechen.
Doch ungeachtet der Tatsache, dass sich die allgemeine Wirtschaftslage nach dem Ende der Hyperinflation verbesserte, erholten sich die Finanzen des Guts nach den verheerenden Verlusten der Vorjahre nicht vollständig. 1926 realisierte Otto, der fast 65 Jahre alt und durch mehrere Krankheiten geschwächt war, dass er die Defizite in den Bilanzen verringern musste. Mit Unterstützung seiner Kinder und Schwiegerkinder, die um die finanzielle Notlage wussten, entwickelte er einen Plan: Er würde die Ausgaben senken, indem er die Aufwendungen für den Haushalt reduzierte, und er würde vom Gutsverwalter verlangen, den Ertrag der diesjährigen Ernte zu erhöhen.
Aber diese Maßnahmen allein, das wusste Otto, würden nicht ausreichen. Sie waren bereits zuvor ausprobiert worden und hatten die Bilanz nur geringfügig verbessert. Um die finanzielle Lage grundlegender zu verändern, entschied sich Otto daher, Teile des Grundbesitzes zu verpachten. Durch seine Berliner Freunde war er darauf aufmerksam geworden, dass in Berlin das Bedürfnis nach Zweitwohnsitzen auf dem Lande wuchs. Sollte es nicht möglich sein, einige dieser reichen Berliner nach Groß Glienicke zu locken? Es war schließlich ein schöner Fleck und lag nur eine kurze Fahrt vom Berliner Stadtzentrum entfernt.
Kapitel 3Alexander
1927
An einem Frühlingsmorgen im März 1927 stiegen Dr. Alfred Alexander und seine Familie vor ihrem Wohnhaus in Berlin-Wilmersdorf in ihren dunkelblauen, offenen Mercedes-Benz Modell S und fuhren hinaus nach Groß Glienicke.
Alfred und seine Frau, die mit warmen Winter- beziehungsweise Nerzjacken, Hüten und Handschuhen bekleidet waren, saßen vorne, während sich die vier Kinder – Bella, Elsie, Hanns und Paul – auf der Rückbank drängten. Alfred wollte das Auto selbst steuern; deshalb hatte der Chauffeur an diesem Tag freibekommen. Ihre Route führte sie durch volle Innenstadtstraßen, entlang der Heerstraße über die schmale Freybrücke, eine Stahlbrücke, die die Havel überspannte, und links auf die schnurgerade Potsdamer Chaussee, auf der sie nach einer längeren Fahrt durch ein Waldgebiet nach Groß Glienicke gelangten. Die Fahrzeit hatte insgesamt lediglich 40 Minuten betragen.
Mit seinen bescheidenen Häusern, den gemauerten Scheunen und der mittelalterlichen Kirche erschien der Ort Alfred klein, wie aus einer anderen Zeit. Was für ein Unterschied zu den hohen Wohnhäusern, den vollen Straßen und den anspruchsvollen Geschäften im Neuen Westen Berlins! Im Zentrum der Ortschaft bog er an der Feuerwache nach links ab, fuhr durch das Potsdamer Tor und parkte das Auto nach einigen Metern auf einer Schotterstraße. Ein Gutsverwalter begrüßte sie.
Das Grundstück, das er ihnen zeigte, war rechteckig; 30 Meter breit, erstreckte es sich über 200 Meter vom Potsdamer Tor hinunter zum Ufer des Groß Glienicker Sees. Der lange schmale Streifen war groß genug, um Privatsphäre zu gewähren, und zugleich klein genug, um nicht zu viel Arbeit zu machen. Er bestand aus drei Bereichen: einer hoch gelegenen ebenen Fläche, voll mit knorrigen Rebstöcken und verbogenen Gittern, die zum alten Weinberg gehört hatte, ungefähr 150 Meter lang war und auf einem Vorsprung endete, von dem aus man über den ganzen See blicken konnte; einem Hang, der beinahe senkrecht abfiel und mit Steinen und wilden Bäumen bedeckt war; und schließlich am unteren Ende aus einer sandigen Fläche von 25 Metern Länge, auf der Schwarzerlen und Weiden wuchsen.
Groß Glienicker See
Das Schönste war der See am Fuße des Grundstücks. Nachdem sie eine Weile auf dem Vorsprung gestanden und den Ausblick genossen hatten, kletterten die Alexanders hinunter zum Wasser. Der See war klein, aber es musste wunderbar sein, hier im Sommer zu schwimmen. Links konnten sie das Schloss erspähen, das kaum sichtbar hinter Bäumen versteckt lag. Rechter Hand, in der Mitte des Sees, befanden sich zwei kleine Inseln, die mit Bäumen bewachsen waren. Mit einem Boot könnten sie zu ihnen hinauspaddeln und vielleicht sogar dort campieren.
Alfred John Alexanders Leben hatte zunächst einen guten Anfang genommen. Am 7. März 1880 wurde er in Bamberg geboren, der malerischen oberfränkischen Stadt an den Ufern der Regnitz. Seine Familie, bestehend aus Ärzten und Rechtsanwälten, gehörte zur Mittelklasse und ihre Mitglieder genossen als ehrliche, fleißige Bürger und regelmäßige Besucher der Bamberger Synagoge Ansehen in der Stadt.
In seinen ersten Lebensjahren jedoch wurde er von einer Schwermut ergriffen, die er nie mehr ganz abschütteln konnte. Als er fünf Jahre alt war, starb seine Schwester Paula an einer Lungenentzündung und nur wenige Monate später, kurz vor Weihnachten 1885, sein 44 Jahre alter Vater an Blutkrebs. Am Tag darauf bemerkte er, dass das kastanienfarbene Haar seiner Mutter Bella über Nacht weiß geworden war, dabei war sie erst 30 Jahre alt.
Alfred war ein freundlicher, aber ernster und wenig humorvoller Junge, ein fleißiger Schüler, oft Klassenbester. Zugleich war er sensibel und neigte dazu, bei den geringsten Anlässen in Tränen auszubrechen, sei es, dass ihm ein anderes Kind wehtat oder dass er ein besonders schönes Musikstück hörte. Am wichtigsten war ihm die Anerkennung seiner Mutter; wenn sie zeigte, wie stolz sie auf ihn war, hatte er seine glücklichsten Augenblicke.
Mit 15 Jahren kündigte Alfred seiner Mutter an, er beabsichtige, Arzt zu werden und ein Heilmittel für die Krankheit seines Vaters zu finden. So löblich das war, reagierte seine Mutter doch enttäuscht. Sie hätte ihn lieber Jura studieren sehen, um wie sein Vater Rechtsanwalt zu werden. Da Alfred sich nicht umstimmen ließ, bat sie ihren Vater und ihre Brüder um Unterstützung, aber auch sie waren nicht imstande, ihm seine Idee auszureden. Also gab sie ihm, als er 17 Jahre alt war, widerwillig ihr Einverständnis, aber, wie er später erinnerte, unter einer Bedingung: »Du musst ein guter Arzt werden, das musst du mir versprechen!« Unter einem »guten Arzt« verstand sie jemanden an der Spitze seines Berufsstandes, jemanden, der als Allgemeinmediziner und nicht in der Forschung arbeitete, jemanden, der allen Kranken half, unabhängig davon, wie viel Geld sie hatten.
So kam es, dass Alfred nach seinem Abitur an die Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin und anschließend an die Ludwig-Maximilians-Universität in München ging, um Medizin zu studieren. Von mittlerer Größe, mit breiten Schultern, kräftigen Lippen, dunklem lockigen Haar und einem schmalen Schnurrbart war Alfred nicht unattraktiv, doch sein durchdringender Blick und sein ernstes Auftreten schreckten viele Frauen ab.
Alfred arbeitete hart, bestand das Physikum mit hervorragenden Noten und machte sein Staatsexamen innerhalb von drei Jahren. Bella war entzückt von ihrem Wunderkind und am Morgen des 19. Juni 1903 traf um Viertel vor elf ein Telegramm für Alfred auf dem Münchner Telegrafenamt ein:
FREUDIGUEBERRASCHTGRATULIRENHERZLICHSTGRUSS = MAMA
Nach Abschluss seines Studiums trat Alfred eine Stelle in Odelzhausen an, einer kleinen Stadt 50 Kilometer nordwestlich von München, und begann mit seiner Forschungsarbeit, die, so hoffte er, zu einem Heilmittel für Blutkrebs führen sollte. Sobald er seinen ersten Gehaltsscheck erhielt, gab er das Geld seiner Mutter. Zwei Jahre später, 1905, wurde dem jungen Dr. Alfred Alexander die prestigeträchtige Position des Ersten Assistenten des Direktors der Freiburger Universitätsklinik angeboten. Es gab jedoch eine Bedingung: Um sie übernehmen zu können, so hieß es, müsse er zum Christentum konvertieren. Seine einzige Alternative war eine schlechtere Stelle mit weit niedrigerer Bezahlung in Berlin. Alfred entschied sich für Berlin.
Im folgenden Jahr wurde Bella, inzwischen 51 Jahre alt, von schweren Herz- und Asthmaanfällen niedergeworfen. Als Alfred diese Nachricht erreichte, bat er seinen Vorgesetzten um Sonderurlaub und eilte an ihre Seite. Ihr Zustand schockierte ihn: Sie atmete flach, ihr Brustkorb wurde von Schmerzen geschüttelt und sie war sehr schwach. Daraufhin suchte er ihre Ärzte auf: den ihm kaum bekannten Dr. Guntzberg und Dr. Julius Kahn, den er schon seit längerer Zeit kannte und dem er vertraute. Als er sie nach den Heilungsaussichten seiner Mutter fragte, sagten sie, dass es für sie keine Hoffnung mehr gebe. In seinen privaten Memoiren schrieb Alfred später:
Da frug ich die Ärzte ob sie ihr Leben, das Kostbarste, das ich auf Erden hatte, verlängern könnten, aber sie zuckten die Schultern; da wusste ich, was ich zu tun hatte; es war Liebe u. Dankbarkeit gegen diese verehrteste Frau und Mutter als ich meinen Freund Julius Kahn bat ihr Morphium zu geben, was ihr wenigstens nach damaliger ärztlicher Auffassung würde gegen ihre Schmerzen helfen, aber auch zugleich dem Leben ein Ende machen. Guntzberg war außer sich über diesen »schädlichen« Vorschlag, aber Julius Kahn gab ihr die Spritze, die sie bald beruhigte und bevor sie dann schmerzlos hinüberschlief sagte sie noch mit einem unvergesslichen lieben Blick: »Ich danke dir, mein lieber Bub.« Das waren ihre letzten Worte, und so schwer mich ihr Tod traf ich habe es nie bereut, den Rat gegeben zu haben u. bin heute noch meinem guten Freund Julius von Herzen dankbar. Sie war nicht zu retten, aber ich durfte mir sagen, dass sie schmerzlos einen Euthasintod hatte. – Mit ihr ging die wunderbarste Frau von dieser Erde.
Nach dem Tod seiner Mutter beschloss Alfred, die wissenschaftliche Forschung aufzugeben und ein »guter Arzt« zu werden, wie sie es sich gewünscht hatte; zurück in Berlin begann er, eine allgemeinmedizinische Praxis aufzubauen. Drei Jahre später, 1909, begegnete Alfred bei einem Besuch in Frankfurt Henny Picard. Henny war mollig, hatte ein rundes Gesicht und kräftige Arme, doch obwohl sie weder über Idealmaße verfügte noch modisch gekleidet war, gab sie mit ihrem Witz und dem Funkeln in ihren Augen eine attraktive Figur ab. Während Alfred aus einer Mittelklassefamilie von Ärzten und Rechtsanwälten kam, stammte sie aus zwei der erfolgreichsten jüdischen Familien Europas: Ihr Vater Lucien Picard war ein sehr respektierter Bankier, Direktor der Commerzbank und Schweizer Konsul in Frankfurt; ihre Mutter Amelia war eine Schwarzschild, die gleich nach den Rothschilds zu den einflussreichsten jüdischen Familien in Frankfurt zählten.
Alfred und Henny verliebten sich sofort ineinander, und obwohl Henny über seine dunklen Stimmungen beunruhigt war, waren sie nur ein paar Monate nach ihrem ersten Treffen miteinander verheiratet. Henny zog in Alfreds kleine Junggesellenbude am geschäftigen Kurfürstendamm ein. Ein Jahr später wurde sie schwanger und die Alexanders zogen um die Ecke in eine herrschaftliche Wohnung, die die gesamte erste Etage des Hauses Kaiserallee 219/220 einnahm. Die Kaiserallee (heute: Bundesallee) war eine der besten Adressen im Neuen Westen. Die Wohnung hatte 22 Zimmer, darunter fünf Schlafzimmer, drei Wohnzimmer, ein Badezimmer, zwei Zimmer für die Dienstmädchen und eine große Küche. Das vordere Zimmer hatte zwei Balkone auf die Kaiserallee und nahm die Breite der gesamten Wohnung ein, groß genug, um bequem 40 Personen für ein Abendessen unterzubringen.
Am 18. März 1911 wurde ihr erstes Kind geboren, das sie, nach Alfreds so geliebter Mutter, Bella nannten. Knapp zwei Jahre später, am 3. Dezember 1912, kam ein zweites Mädchen zur Welt, Elsie. Während Alfred schwer arbeitete, sich um seine Patienten kümmerte und seine Praxis aufbaute, verbrachte Henny Zeit mit den Töchtern und schuf ein Zuhause für die wachsende Familie. Bald dirigierte sie ein umfangreiches Hauspersonal, darunter ein Kindermädchen, einen Koch, eine Putzfrau, einen Chauffeur und sogar einen Mann, der einmal die Woche kam, um die Uhren aufzuziehen.
Trotz ihrer Herkunft blieb Henny eine natürliche, bescheidene und selbstbeherrschte Frau, die eine beruhigende Wirkung auf ihren aufbrausenden Ehemann ausübte. So schrieb Alfred in seinen Memoiren:
Ja, meine liebe Mami, Du wärst sehr nach meiner Mutter Sinn gewesen und sie hätte ohne Zögern, wenn sie Dich gekannt hätte uns ihren Segen gegeben. Du hast so viel von ihr, in Deinen lieben Zügen, in Deinem Lächeln und in Deinem ganzen Wesen. – Dies liebevolle Verständnis, diese grosse Hilfsbereitschaft nicht nur für Deine Familie, sondern für alle, die sich an Dich wenden. Du hast ein Verständnis für alles, eine Geduld und ich muss gestehen, ich habe es Dir, trotzdem ich Dich aus tiefstem Herzen liebe, nicht immer leicht gemacht, mit meinem aufbrausenden, oft schlecht temperierten Wesen.
Fünf Jahre nach ihrer Hochzeit wurde Alfred mit Kriegsbeginn 1914 zum Sanitätsdienst des deutschen Heeres eingezogen und ins Elsass geschickt, wo er ein Feldkrankenhaus zur Behandlung von Opfern von Gasangriffen leitete. Wann immer möglich, nahm er einen Zug zurück nach Berlin, um Henny und die Kinder zu sehen. Bei einem dieser kurzen Heimatbesuche wurde Henny erneut schwanger und am 6. Mai 1917 gebar sie eineiige Zwillinge, Hanns und Paul – Hanns war 15 Minuten älter als sein Bruder. Als Elsie und Bella die beiden Jungen zum ersten Mal sahen, hielten sie sie für kleine rote Puppen. Sie schnappten sich die beiden Babys, als wären sie Spielzeug: Elsie nahm Paul und Bella nahm Hanns – eine Wahl, aus der bei beiden Schwestern jeweils ein lebenslanges Verantwortungsbewusstsein resultieren sollte.
Das Militär verlieh Alfred in Anerkennung seiner Verdienste im Krieg als einem der wenigen Juden, denen eine solche Ehrung zuteilwurde, das Eiserne Kreuz Erster Klasse. Mit dem Kriegsende im November 1918 kehrte Alfred nach Berlin zurück und begann, seine Geschäfte wiederaufzunehmen. Innerhalb weniger Jahre hatte er eine gutgehende Arztpraxis aufgebaut und wurde einer der prominentesten Ärzte in Berlin. 1922 baute er ein Sanatorium in der Achenbachstraße 15 (heute: Lietzenburger Straße), ein vierstöckiges Gebäude nicht weit von der Wohnung der Familie entfernt, und stattete es mit den modernsten Apparaten wie Röntgengeräten sowie mit einem Labor und einer Dachterrasse aus, auf der sich die Patienten an der frischen Luft erholen konnten. Bald waren alle Betten belegt. Darüber hinaus unterhielt Alfred weiterhin Praxisräume in der Familienwohnung an der Kaiserallee. Zu seinen Patienten zählten nun Albert Einstein, Marlene Dietrich und Max Reinhardt, der Direktor des Deutschen Theaters.
1927, nach den turbulenten Jahren der Hyperinflation und wirtschaftlichen Ungewissheit, war Alfred schließlich erschöpft. Auch die frühen Verluste seiner Kindheit lasteten noch auf ihm und er sehnte sich nach einem Ort zum Entspannen.
Eines Tages im Frühjahr 1927 kam Dorothea von Wollank zu Dr. Alexander in die Sprechstunde. Nach der Untersuchung erwähnte sie, dass ihr Ehemann Grundstücke am Ufer des Groß Glienicker Sees verpachte, und fragte, ob der Doktor vielleicht jemanden kenne, der daran interessiert sein könnte.
Noch am selben Tag kündigte Alfred beim Abendessen an, dass er im Westen der Stadt ein Haus an einem See errichten wolle. Sie könnten dort die Wochenenden verbringen, sagte er seiner Frau und den Kindern, vielleicht auch die Sommer. Mit seinem Wunsch nach einem Wochenendhaus stand Alfred nicht allein – viele seiner Freunde und Kollegen hatten bereits Landhäuser. Der Maler Max Liebermann etwa besaß eine große Villa direkt am Wannsee und der Architekt Erich Mendelsohn hatte einige Kilometer weiter nördlich ein traumhaftes, ebenfalls an einem See gelegenes Haus. Das Besondere an Alfreds Plänen war, dass er lediglich ein kleines Holzhaus bauen wollte, keine große Villa oder ein Chalet.
Elsie und ihre Geschwister kannten die Seen am Berliner Stadtrand. Im Sommer, bei Temperaturen bis zu 35 Grad, fuhren ihre Eltern mit ihnen zum Strandbad Wannsee, dem größten Freibad Europas. Hier hatte man ein sandiges Seeufer in einen über einen Kilometer langen und 80 Meter breiten Familienstrand verwandelt – einen Strand, den mehr als 900000 Berliner pro Jahr besuchten: Männer in Anzügen und Frauen in langen Kleidern, die unter Strohdächern Tee tranken; Kinder, die zusammen mit ihren Eltern Sandburgen bauten; Frauen in kurzen Badeanzügen, die unerhörterweise mit Männern badeten, die lediglich eine halblange Hose trugen.
Alfred jedoch suchte Einsamkeit abseits des bunten Treibens am Wannsee, Erholung vom hektischen und lärmenden Leben in Berlin. Die inzwischen 14-jährige Elsie befürchtete, dass das auf lange Wochenenden allein mit ihren Eltern hinauslief – oder schlimmer noch: mit deren spießigen Freunden –, in irgendeiner kleinen Hütte in den Wäldern, weit weg von den Abenteuern der Großstadt.
Am 30. März 1927, ein paar Tage nachdem die Familie Groß Glienicke zum ersten Mal besucht hatte, einigte sich Alfred mit Otto von Wollank: Die Alexanders würden das Grundstück für 15 Jahre pachten. Sie hatten das Recht, darauf ein Haus zu bauen und den See zu nutzen, und sie hatten die erste Kaufoption auf das Grundstück, sollte sich von Wollank einmal zum Verkauf entschließen.