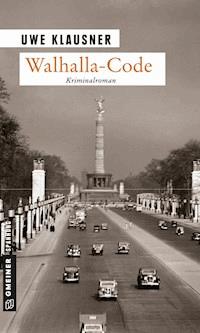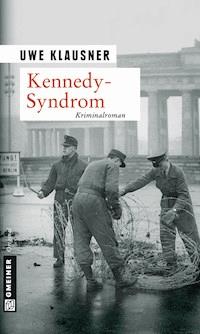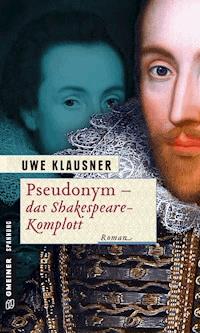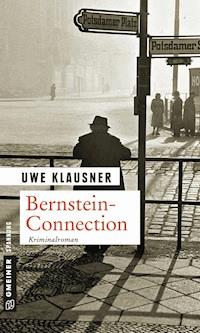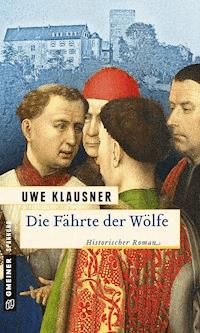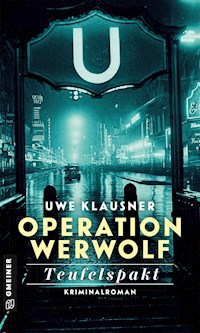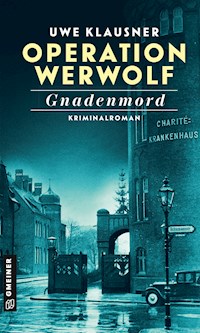Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Tom Sydow
- Sprache: Deutsch
Auf der Mülldeponie in Berlin-Wannsee wird die grausam zugerichtete Leiche eines Drogendealers entdeckt. Konkurrenzkampf im Milieu, Racheakt unter Drogenhändlern? Tom Sydow, Hauptkommissar der Kripo Berlin, tappt zunächst im Dunkeln. Doch dann ergibt sich eine erste Spur. Sie führt zu Dietrich H. Garskiewicz, Herr über ein Immobilienimperium, das Gerüchten zufolge kurz vor dem Zusammenbruch steht. Doch je tiefer Sydow in den Sumpf aus Korruption, Bestechung und Vetternwirtschaft vordringt, desto mehr setzen ihm die Recherchen zu …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Klausner
Stadtguerilla – Tage der Entscheidung
Tom Sydows 11. Fall
Zum Buch
Berliner Filz West-Berlin 1975. Kurz vor der Wahl wird Gero von Drewitz, Spitzenkandidat der CDU, von Linksextremisten entführt. Das Ultimatum: Austausch des Gekidnappten gegen fünf inhaftierte Gesinnungsgenossen. Tom Sydow, Hauptkommissar der Kripo Berlin, wird derweil anderweitig gebraucht. Auf der Mülldeponie in Berlin-Wannsee wurde die Leiche eines Drogendealers entdeckt. Sydow und seine Kollegen tappen zunächst im Dunkeln. Doch dann ergibt sich eine erste Spur. Sie führt zu Dietrich H. Garskiewicz, parteiinterner Konkurrent des entführten CDU-Spitzenkandidaten und Herr über ein Immobilienimperium, das Gerüchten zufolge kurz vor dem Zusammenbruch steht. Und als sei all das noch nicht genug, erreicht Sydow die Nachricht, dass seine inhaftierte Stieftochter auf der Liste der Gefangenen steht, die im Austausch gegen von Drewitz freigepresst werden sollen. Doch so schnell, wie seine Widersacher hoffen, gibt der Hauptkommissar mit dem gewöhnungsbedürftigen Humor nicht auf …
Uwe Klausner wurde in Heidelberg geboren und wuchs dort auf. Sein Studium der Geschichte absolvierte er in Mannheim und Heidelberg, die damit verbundenen Auslandsaufenthalte an der University of Kent in Canterbury und an der University of Minnesota in Minneapolis/USA. Heute lebt er mit seiner Familie in Bad Mergentheim. Neben seiner Tätigkeit als Autor hat er bereits mehrere Theaterstücke verfasst, darunter »Figaro – oder die Revolution frisst ihre Kinder“ (2007). Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Reformation wurde sein Einakter „Mensch, Martin!“ im Rahmen einer Freilichtaufführung erstmals dem Publikum präsentiert.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag: -
- Kriminalromane -
Staatskomplott (2017)
Blumenkinder (2016)
Führerbefehl (2015),
Stasi-Konzern (2014)
Walküre-Alarm (2014)
Eichmann-Syndikat (2012)
Kennedy-Syndrom (2011)
Bernstein-Connection (2011)
Odessa-Komplott (2010)
Walhalla-Code (2009)
- Historische Romane -
Die Ehre der Prätorianer (2018)
Sisis letzte Reise (2018)
Der Sturz des Ikarus (2017)
Pseudonym – das Shakespeare-Komplott (2016)
Die Fährte der Wölfe (2015)
Die Stunde der Gladiatoren (2013)
Engel der Rache (2012)
Die Bräute des Satans (2010)
Pilger des Zorns (2009)
Die Kiliansverschwörung (2009)
Die Pforten der Hölle (2007)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – Klaus Mehner
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6132-3
VORBEMERKUNG
1. Die Handlung des Romans wurde durch die Geschehnisse des 27. Februar 1975 in West-Berlin und die daraus resultierende Fahndung nach den Entführern von Peter Lorenz (1922–1987) inspiriert und stellt eine Mischung aus realem und fiktionalem Geschehen dar.
2. Um Missverständnissen vorzubeugen, wurden die Namen aller am Geschehen Beteiligten geändert.
3. Personen der Zeitgeschichte, die an der Handlung des Romans nicht direkt beteiligt sind, werden unter ihrem angestammten Namen aufgeführt.
HAUPTFIGUREN
(alphabetisch)
Claus-Peter Aalberg, Polizeipräsident von West-Berlin
Anonymus, neben weiteren Mitgliedern und Sympathisanten der »Bewegung 2. Juni« ab dem 10. April 1978 im sogenannten »Lorenz-Drenkmann-Prozess« vor Gericht; Urteilsverkündung am 13. Oktober 1980, Haftstrafen zwischen fünf und fünfzehn Jahren
Simon de Montfort, genannt »Monty«, Privatermittler
Josef Eicken, Sozialrentner aus Berlin-Steglitz
Dietrich H. Garskiewicz, Bauunternehmer und Mitglied der CDU
Desirée Garskiewicz, seine Tochter aus zweiter Ehe
Li Hua Garskiewicz, Garskiewiczs dritte Ehefrau
Vera Hallberg, Studentin der Kriminologie in Tübingen und Praktikantin bei der Kripo Berlin
Gerd Heidebrecht, Gymnasialprofessor a.D.
Karl Jannowitz, Kripo-Beamter im Ruhestand und Sydows Partner im Mordfall Orgozow
Martha Kohlmeyer, langjährige Haushälterin bei Dietrich H. Garskiewicz
Manfred Konopka, Leiter der Spurensicherung
Eduard Krokowski, Kriminalkommissar und Sydows langjähriger Partner bei der Kripo Berlin
Hertha Lubitsch, Kioskbesitzerin
Veronika Marquard, inhaftierte Unterstützerin der RAF und Sydows Stieftochter
Prof. Dr. Heribert Peters, Pathologe und Leiter des Gerichtsmedizinischen Instituts
Jenny Plaschke, Drogenabhängige und Freundin von Mark Strehlitz
Paul Siegel, Mitarbeiter der Stadtreinigung von West-Berlin (BSR)
Mark Strehlitz, Drogenkonsument
Tom Sydow, Hauptkommissar der Kripo Berlin
Lea Sydow, seine Frau
Gero von Drewitz, Rechtsanwalt und Spitzenkandidat der West-Berliner CDU
Dr. Dirk Voßkamp, stellvertretender Leiter des Staatsschutzes von West-Berlin
Sven Waldenmaier, Kriminalassistent und einer von Sydows Partnern
Erich Wischulke, Fahrer des Gekidnappten
Des Weiteren:
Kneipenwirt
Junkie etc.
PROLOG
GESTÄNDNIS (I)
1
West-Berlin, 21.02.1975
»Informationen über die linke Szene? Ab sofort nur noch gegen Cash.«
»Sag das noch mal, du hinterhältige Ratte!« Erst war ich baff. Aber dann machte es klick bei mir. Der Hurensohn wollte mich erpressen. Ausgerechnet mich. Das war ja wohl ein ziemlich dicker Hund. »Gegen Cash? Wohl nicht ganz dicht, wie?«
»Das Gleiche könnte ich Sie fragen, oder?«
Um den Mistkerl bei Laune zu halten, hatte ich sämtliche Register gezogen. Hatte ihm eine Bleibe besorgt, seinetwegen Kopf und Kragen riskiert, ihm die Kohle vorn und hinten reingeschoben.
Und wozu? Für nichts und wieder nichts.
Und dann muckte der abgefuckte Junkie auch noch auf. Ausgerechnet jetzt, im denkbar ungünstigsten Moment. Von nichts eine Ahnung, aber groß die Klappe aufreißen. Der Klugscheißer kam mir gerade recht. Hängte den Großkotz raus und wollte mir Vorschriften machen. Da hörte sich ja wohl alles auf.
Und dann erst diese Frisur. Zum Abgewöhnen. Die Putzwolle sah wirklich verboten aus. Wenn ich so rumliefe, ich würde mich in Grund und Boden schämen.
Mission gescheitert, die Mühe hätte ich mir sparen können.
Aber wie hieß es doch so schön: Aus Schaden wird man klug. Egal wann, wo oder unter welchen Umständen, das würde mir nicht noch mal passieren.
Jede Wette.
»Du tickst wohl nicht mehr richtig, wie? Das ist Erpressung, damit kommst du bei mir nicht durch.« Um Eindruck zu schinden, legte ich eine Kunstpause ein. Dann fügte ich süffisant hinzu: »Du weißt doch: Der nächste Trip könnte der letzte sein. Ein Drogentoter mehr oder weniger, wen juckt das schon.«
»Hätten Sie wohl gern«, widersetzte sich das verwahrloste Wrack. Auf Turkey, wie konnte es anders sein. »Sorry, den Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. Da können Sie warten, bis Sie schwarz werden. Ich sag’s nicht noch mal: Entweder Sie lassen kräftig Kohle rüberwachsen, oder …«
»Oder was?«
»Umsonst ist der Tod. Ich hab keinen Bock mehr, mir den Arsch für euch Schreibtischhengste aufzureißen. Ohne Knete läuft da überhaupt nichts mehr, merkt euch das.«
»Wie darf ich das verstehen?«
»Na, wie wohl!«, geiferte der Freak, die Stimme schrill wie eine übertourige Kreissäge. »Sitzen Sie auf der Leitung, oder was? Dann eben noch mal, zum Mitschreiben: Der Job hängt mir zum Hals raus, wie sehr, kann ich gar nicht sagen. Ich hab keine Lust mehr, für andere die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Wenn Sie Informationen aus erster Hand brauchen, besorgen Sie sich die doch selbst. Die Zeiten sind vorbei, schreiben Sie sich das hinter die Ohren.«
»So, meinst du.«
»Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Entweder Sie machen ordentlich was locker, oder ich packe aus. Was glauben Sie, wie sich die Zeitungsfritzen freuen! Der Spiegel wird sich um die Story reißen, hundertpro. Die Jungs in Hamburg sind nicht auf den Kopf gefallen, die werden sich den Deal was kosten lassen.«
Wie konnte man nur so gierig sein. Wäre er auf Draht gewesen, der Pennbruder hätte das schönste Leben gehabt. Na ja, jedenfalls das, was man in der Drogenszene darunter verstand. Hätte gelebt wie die Made im Speck, ohne einen Finger krumm zu machen. Pünktlich zum Ersten hätte er seine Provision kassieren und nach Belieben Joints qualmen oder sich am Fließband Heroin spritzen und was weiß ich für Zeugs einwerfen können. Für das Wohlergehen der Kanalratte wäre gesorgt gewesen – und für seine Hippie-Nutte auch.
Merke: Streckst du dem Abschaum den kleinen Finger hin, dann packt er zu und nimmt die ganze Hand. Wenn er sie dir nicht gleich abreißt, sollte man hinzufügen. Jeder geht nun mal so weit, wie er kann. In meinem Metier, wo es von Zockern nur so wimmelt, war das schon immer so gewesen.
Wie gesagt, jeder geht so weit, wie er kann. Aber nur, wenn man ihn lässt.
Und genau das ist bei mir nicht drin. Erpressung schon gar nicht, da kenne ich nichts. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ihn als V-Mann einsetze, bündelweise Geld lockermache, damit er sich einen schönen Lenz machen kann, dann muss ich mich auf ihn verlassen können.
Falls nötig, blind.
Ist dies nicht der Fall, ist der Betreffende reif. Reif zum Abschuss, wie es landläufig heißt.
Im vorliegenden Fall, da war ich mir sicher, würde dem nichts im Wege stehen. Der Rest war ein Kinderspiel, eine meiner leichteren Übungen sozusagen. Einem Junkie aus Steglitz würde niemand nachtrauern – und kaum einer würde einen Finger krumm machen, wenn er verschwand. Aktuell passierte das am laufenden Band, beinahe jeden dritten Tag. Hier in Berlin trieben sich alle möglichen Freaks herum, auf einen mehr oder weniger kam es nicht an.
Und falls doch, musste ich meine Beziehungen spielen lassen. Aber so weit würde es bestimmt nicht kommen. Ich war Profi genug, um meine Spuren zu verwischen. Schließlich war es nicht das erste Mal, dass ein unsicherer Kantonist Zicken machte. Wie lautete die Spruchweisheit doch gleich: Übung macht den Meister. Auch, wenn es darum ging, einen Erpresser mundtot zu machen.
Ein für alle Mal.
Und zwar so, dass er wie vom Erdboden verschluckt zu sein schien.
»Und du bist dir sicher, dass das eine kluge Entscheidung ist?«, gab ich so gelassen als nur möglich zurück, die Hand am Griff meiner Walther PPK, die in der Tasche meines sündhaft teuren Kaschmirmantels steckte. »Ich finde, du solltest dir die Sache noch mal überlegen.«
»Da gibt es nichts zu überlegen«, raunzte der Junkie, fuhr mit dem Zeigefinger an der Nase entlang und trippelte wie ein läufiger Köter auf der Stelle. Dann fingerte er an seiner schwarz-gelb-grün gestreiften Strickmütze herum, vor Wut kaum noch zu bremsen: »Jetzt hören Sie mir mal gut zu, Sie feiner Pinkel. Entweder Sie rücken genug Kohle raus, oder wir beide sind geschiedene …«
»Schon gut«, lenkte ich mit beschwichtigendem Tonfall ein, kein bisschen nervös, sondern bester Stimmung, während sich der Zeigefinger um den Abzug meiner Waffe krümmte. »Ich hab’s kapiert. Und wie viel wird mich der Spaß kosten?«
»100 Riesen. Bar auf die Hand. Und keinen Pfennig weniger.«
100.000 D-Mark, exakt das Zehnfache, was die Niete für ihre Dienste abkassierte. Monatlich, versteht sich, zu Lasten von Vater Staat.
»100.000 Deutsche Mark«, echote ich, die Stimme hart wie Granit, was mein Gegenüber jedoch nicht bemerkte. »Na, das ist ja mal ein Wort!«
»Heißt das, wir kommen ins Geschäft?«
»Könnte sein.«
»Na also, warum nicht gleich.« Der Junkie bleckte die ungepflegten Zähne. Fast ein Drittel befand sich nicht mehr an Ort und Stelle, Resultat einer Schlägerei, bei der er mit der Konkurrenz aneinandergeraten war. »Dann wären wir uns ja einig«, frohlockte er, ein Grinsen im Gesicht, das förmlich danach schrie, ihm eins auf die Kinnlade zu geben. Verzeihlich oder nicht, es wäre das Dümmste gewesen, was ich hätte tun können. An diesem Versager wollte ich mir nicht die Finger schmutzig machen, deshalb riss ich mich notgedrungen am Riemen. »Und wann ist Zahltag, wenn man fragen darf?«
»Erst die Ware, dann das Geld«, antwortete ich in barschem Ton und deutete auf den Mantel, unter dem sich die Konturen meiner Brieftasche abzeichneten. Dass sie nicht annähernd so viel Knete enthielt, wie sich mein Gegenüber erträumte, das konnte der vor Naivität strotzende Vollidiot nicht wissen. Wäre er so clever gewesen, wie er tat, er hätte mir die Nummer nicht abgekauft. Da er jedoch das ziemliche Gegenteil davon war, hatte ich leichtes Spiel. Ein wenig zu leicht, aber das tat der Freude keinen Abbruch.
Die Ratte hatte es auf die Spitze getrieben, also würde sie die Konsequenzen tragen. Wie du mir, so ich dir. So war das in unserem Geschäft. Wer aus der Reihe tanzte, war weg vom Fenster. Und zwar schneller, als er piep sagen konnte. »Nun leg schon los, sonst stehen wir noch heute Abend hier rum!«
»Halten Sie mich für so dämlich, dass ich …«, begann mein Informant, die Augen weit aufgerissen, als würden sie demnächst aus den Höhlen springen. Und überlegte es sich in letzter Sekunde anders: »Na gut, weil Sie es sind. Eine Hand wäscht bekanntlich die andere.«
Oder drückt ab, um vollendete Tatsachen zu schaffen. Wie die meinige.
»So könnte man es ausdrücken«, gab ich mit nur mühsam kaschiertem Abscheu zurück, klopfte auf meine Brusttasche und sülzte: »Wie du zu sagen geruhtest, umsonst ist der Tod. Lassen wir das – und kommen wir zur Sache.«
Der verlauste Fixer hatte sein Todesurteil unterschrieben. Einfach so, aus purer Naivität.
Aber das wusste er nicht.
Noch nicht.
»Wie gesagt, es gibt Neuigkeiten.«
»Und die wären?«
Mein Gegenüber antwortete nicht sofort, sah sich ruckartig nach allen Seiten um, wie ein Aasgeier vor dem Zerlegen seiner Beute. Doch da war nichts, keine Stimmen, keine Schritte, auch kein Knacken im wild wuchernden Gestrüpp. Nur der Wind in den Wipfeln der Kiefern, die am Ostufer der Havel in den Morgenhimmel ragten.
Leuchtend rot, mit einem Schuss Purpur. So hatte ich es gern.
Da machte einem der Job erst richtig Spaß.
»Eins gleich vorweg: Wenn Sie glauben, Sie könnten mich aufs Kreuz legen, dann …«, japste er, eine Mischung aus Gier und aufkeimender Furcht im eingefallenen Gesicht.
»Dann was?«
»Ach, vergessen Sie’s.« Der Junkie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Bringen wir’s hinter uns, damit ich meine Ruhe habe.«
»Dein Wunsch ist mir Befehl.«
Der Dealer atmete keuchend aus, unterdrückte einen Hustenanfall und japste: »Wie gesagt, es gibt Neuigkeiten.«
»Und die wären?«
»Die Freaks vom 2. Juni sind dabei, einen neuen Coup zu planen. Wie man hört, haben sie Großes vor.«
»Nämlich was?«
Der Mann, dessen Zeit längst abgelaufen war, trat einen Schritt näher, zog lautstark die Nase hoch und wisperte: »Mit anderen Worten, sie wollen jemand ganz Bestimmtes entführen. Einen Polit-Promi, der jedem in Berlin ein Begriff ist.«
»Wie sieht es aus, hat dieser Jemand auch einen Namen?«, fuhr ich mein Gegenüber an, aus dessen Mund der Geruch von billigem Fusel drang. »Jetzt komm schon, mach’s nicht so spannend!«
Nicht im Mindesten beunruhigt, griff der Junkie in seine zerknitterte Pumphose, zog einen Joint hervor und steckte ihn sich mit Genießermiene an. Nicht lange, und ein süßliches und mir bestens vertrautes Aroma erfüllte die Luft, für meinen Gesprächspartner Genuss pur, für mich dagegen eine Provokation, wie ich sie mir dreister und unverfrorener nicht vorstellen konnte. »Was heißt hier spannend, man wird ja wohl noch einen Joint qualmen dürfen.«
»Um wen es geht, will ich wissen – aber dalli!«
»Sie brauchen nicht so zu schreien, ich höre gut.« Die Augen halb geschlossen, blies mir der Junkie den Rauch ins Gesicht, tänzelte auf mich zu und nannte mir einen Namen, bei dem selbst ich, gegen Überraschungen so gut wie immun, wie elektrisiert aufhorchte. »Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen?«
Die Frage verhallte ungehört. »Und wann wird der Coup über die Bühne gehen?«
»In sechs Tagen, am 27.«
»Wo genau?«
»Fragen Sie mich was Leichteres. Mein Gewährsmann hat was von Zehlendorf gefaselt und gemeint, es gäbe da eine Stelle, die sei für eine Entführung wie ge…«
»Schon gut, mehr wollte ich nicht wissen«, fiel ich dem auskunftsfreudigen Wichtigtuer ins Wort, wandte mich ab und schlug den Weg zu der Stelle ein, wo ich meinen Wagen geparkt hatte. »Gut gemacht, aus dir könnte noch was werden.«
»Danke für das Kompliment.«
»Gern geschehen«, erwiderte ich, zog meine Brieftasche hervor und vollführte eine Kehrtwende, die einem Balletttänzer alle Ehre gemacht hätte. Man konnte über ihn sagen, was man wollte, aber was die Informationen betraf, hatte sich mein V-Mann die Knete verdient. Ohne Wenn und Aber. Gerade eben hätte ich nicht gezögert, dem hintertriebenen Schlitzohr eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Doch davon konnte jetzt keine Rede mehr sein. »Hier, nimm – das ist für dich. Eine Art Anzahlung, wenn man so will. Der Rest folgt in Kürze, so viel, wie dir vorschwebt, kann ich auf die Schnelle nicht lockermachen. Wirf es nicht gleich zum Fenster raus, so schnell kommt die Gelegenheit nicht wieder. Und vor allem: dranbleiben an der Sache, haben wir uns verstanden? Und jetzt bloß nicht leichtsinnig werden, das wäre fatal. Je mehr Informationen, desto besser. Ich brauche Namen, kapiert? Namen und möglichst viele Details. Wer sind die Rädelsführer, wer sorgt für die Logistik, wer gehört der Unterstützerszene an – alles Fragen, die noch zu klären wären. Und vor allem: Was haben die Kidnapper vor?« In meinem Element, ließ ich mein Gegenüber nicht zu Wort kommen: »Sei mir bloß vorsichtig, hörst du? Mit Kriminellen dieses Schlages ist nicht zu spaßen. Wenn die rauskriegen, für wen du arbeitest, kannst du dein Testament machen – und ich vermutlich auch, wenngleich aus anderen Gründen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, ich hoffe, wir beide sind uns da einig!«
»Ich werd’s mir merken«, nuschelte das abgetakelte Wrack, riss mir die Scheine aus der Hand und ließ sie in seiner Pumphose verschwinden. »Schönen Dank auch, war mir ein Vergnügen.«
»Keine Ursache, das Vergnügen war ganz auf meiner Seite.« Auch wenn es einem nur schwer über die Lippen kam, der Mann hatte gute Arbeit geleistet. Bei allem Widerwillen gegenüber seiner Person, er hatte sich die Knete verdient. Kein Scherz, das war mein voller Ernst. In Momenten wie diesem, wo man auf eine Goldader stieß, kam es auf ein paar Tausender mehr oder weniger nicht an. Die Nachricht, so unvollständig sie auch sein mochte, war das Honorar allemal wert. Und das Wichtigste dabei: Die Ader war längst noch nicht erschöpft.
Ergo: Um ihn bei Laune zu halten, würde ich Strehlitz weiterhin mit Stoff versorgen. Je hochwertiger die Qualität, desto ergiebiger würde die Quelle sprudeln. Auch hier kam es auf ein paar Kilo mehr oder weniger nicht an. Als Dealer hatte mein V-Mann reichlich Erfahrungen gesammelt, insofern würde ihm der Schneeregen nicht ungelegen kommen.
Oberstes Gebot: Man musste das Eisen so lange schmieden, wie es heiß war. Später dann, wenn es zu nichts mehr taugte, würde ich weitersehen. Und diesen Abschaum, so er seine Schuldigkeit getan hatte, über die Klinge springen lassen.
»Einen Augenblick noch, Strehlitz«, rief ich meinem Gewährsmann hinterher. Auf halbem Weg zu seiner Rostlaube, die er in Sichtweite des Treffpunkts abgestellt hatte, drehte sich der Junkie um. »Es gibt da noch ein paar Dinge, über die wir reden müssen«, fügte ich hinzu, die Hände in der Tasche, um sie vor der morgendlichen Kühle zu schützen. »Einen kurzen Moment noch, dann …«
Weiter kam ich nicht.
Unweit von mir, im dichten Unterholz, war ein Geräusch zu hören.
Ein Laut, den ich nur zu gut kannte. Kaum hörbar, wie das Zischen eines undichten Ventils.
Doch da war es bereits zu spät.
Sekundenbruchteile darauf, wie aus dem Nichts, brach das Inferno über mich herein.
Kaum war der Schuss abgefeuert, löste sich der Schädel von Strehlitz in seine Einzelteile auf. Ein Gemisch aus Blut, Hirnmasse und Knochensplittern spritzte mir ins Gesicht, besprenkelte meinen Mantel, besudelte mich von Kopf bis Fuß. Unfähig, klar zu denken, wischte ich die dickflüssige Brühe ab, riss den Mantel auf und tastete nach meiner Waffe.
Doch es war zu spät.
Ich hätte mir die Mühe sparen können.
Binnen Sekunden, als sei dies der Showdown in einem Horrorfilm, hatte sich Strehlitz in einen Zombie verwandelt. In einen Untoten, dessen Kopf wie ein Sprengsatz explodiert zu sein schien. Die Verwandlung kam so plötzlich, dass mir keine Zeit zum Nachdenken blieb, geschweige denn zum Reagieren. Und so stand ich einfach nur da, kurz vor dem Erbrechen, blutbeschmiert, zur Tatenlosigkeit verdammt. Zutiefst abgestoßen von dem bizarren Spektakel, das sich vor meinen Augen abspielte.
Das Ende kam schnell. Eine Weile noch hielt sich das, was von meinem Informanten übriggeblieben war, auf den Beinen. Kurz darauf geriet der Torso ins Schlingern, torkelte bald nach links, bald nach rechts, vollführte eine Drehung um die eigene Achse.
Dann aber, die Arme weit ausgestreckt, taumelte der Zombie auf mich zu. Meter um Meter, Schritt für Schritt, Zoll um Zoll. Vor Schreck wie gelähmt, wich ich zurück – verhakte mich in einer Wurzel, geriet ins Taumeln, verlor das Gleichgewicht – und fiel zu Boden.
Das Schlimmste stand mir aber noch bevor.
Im Begriff aufzustehen, verharrte ich wie gelähmt auf der Stelle.
Nur eine Armlänge von mir entfernt ragte der Körper des Getöteten in die morgenklare Luft.
Dann senkte er sich im Zeitlupentempo auf mich herab.
REMINISZENZEN
2
West-Berlin, 06.03.1975
Die Chancen, dass sie mich am Wickel kriegen, stehen nicht schlecht. Fifty-fifty, würde ich sagen.
Optimistisch betrachtet.
Aber egal. Unkraut vergeht nicht. Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann hilft kein Lamentieren. Dann musst du in die Trickkiste greifen, so tief wie möglich, ob regelkonform oder nicht, spielt keine Rolle.
Einstweiliges Fazit: Entweder ich laufe zur Form auf, oder sie ziehen mir das Fell über die Ohren. Und ich bekomme eine Kugel verpasst.
Kugel – gutes Stichwort. Es gibt da nämlich ein paar Leute, die mir liebend gern ein Projektil durch die Rübe jagen würden. Oder gleich mehrere hintereinander.
Um auf Nummer sicher zu gehen.
Und was lernen wir daraus? Überleben ist heutzutage Glückssache. Doch mit Dusel allein, das weiß ich aus Erfahrung, bekommst du keinen Fuß auf den Boden. Jedenfalls nicht auf Dauer, selbst wenn dir das Bluffen zur zweiten Haut geworden ist. Daraus folgt, um über die Runden zu kommen, musst du abgezockt sein. Das war so, ist so und wird auch in Zukunft der Fall sein.
Gesetzestreue hin oder her.
Abgezockt und bereit, alles auf eine Karte zu setzen.
Ende der Durchsage.
Der Showdown steht kurz bevor, wenn ich Pech habe, noch in dieser Nacht. Daher wird es Zeit, dass ich die Kurve kriege. Je früher ich selbige kratze, desto besser. Wenn nicht, kann ich einpacken. Dann werden die mir eine Lektion verpassen, die sich gewaschen hat.
Allein gegen den Rest der Welt. Hab ich mir immer schon gewünscht.
Merke: Ohne Tricks, Finten und Bluffs bist du aufgeschmissen, das lehrt zumindest die Erfahrung. Da knipsen sie dich aus, bevor du piep sagen kannst.
Eins gleich vorweg, mein Humor ist nicht jedermanns Sache. Aber was soll’s. Da müssen meine Weggefährten durch. Wir Berliner sind halt nun mal so. Frei nach Schnauze, auch wenn wir damit anecken. Und immer einen flotten Spruch parat, sonst würde ja was fehlen. Anders kann man den Schlamassel, in dem ich stecke, nicht überleben.
Apropos überleben. Was das betrifft, kenne ich sämtliche Tricks. Wie oft ich auf der Kippe stand, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Irgendwann, vor zehn Jahren oder so, habe ich aufgehört zu zählen. Doch egal, wer mir ans Leder wollte, ich hatte Glück. Mehr Glück als Verstand, um es unverblümt zu formulieren.
Tja, so ist das nun mal. Ohne Dusel, das sage ich aus voller Überzeugung, wäre ich längst dabei, die Radieschen von unten anzugucken. Das ist nicht einfach so dahergeredet, sondern eine Tatsache. Bei der Kripo lebt man gefährlich, vor allem dann, wenn man ein loses Mundwerk besitzt. Niemand weiß das besser als ich, mehr als 30 Jahre in Diensten von Vater Staat bleiben dir nicht in den Klamotten kleben. Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber die jüngeren Kollegen können da nicht mitreden. Klingt überheblich, ich weiß. Ist aber leider so. Einer wie ich, der zur Kripo kam, als ein gewisser Heinrich Himmler zum Chef der Deutschen Polizei ernannt wurde, so jemand weiß, wie der Hase läuft. Damals, anno 1936, herrschten andere Gesetze. Da machst du dir keinen Begriff. Im Zwölfjährigen Reich war Duckmäusertum angesagt, je höher das Quantum, desto besser. Jeder, der auch nur einen Funken Ahnung und den Schlamassel am eigenen Leib miterlebt hat, wird das bestätigen. Soll mir ja keiner rumtönen, er habe von nichts gewusst. Wer das behauptet, der lügt. Um nicht mitzubekommen, was da am Laufen war, musste man mit Scheuklappen durch Berlin spazieren. Oder blind, taub und nicht mehr ganz richtig im Oberstübchen sein.
Trotz allem Abscheu, der einen überkommt, eins muss man den Nazis lassen. Die hatten den Bogen raus, wenn es darum ging, den Leuten die Hucke voll zu lügen. Ich erinnere mich noch genau, als Anfang August die Olympiade eröffnet wurde, auf den Tag genau zwei Monate, nachdem ich meinen Dienst angetreten hatte. Wie durch ein Wunder gab es auf einmal keine Straftaten mehr, zumindest nicht offiziell. Dafür wurde gesorgt, hinter den Kulissen, versteht sich, und unter tätiger Mithilfe eines gewissen Joseph Goebbels, der den Zeitungen einen Maulkorb verpasste. So ein Schwachsinn, als ob sich das Milieu über Nacht in Luft aufgelöst hätte. Ganoven gab es nämlich weiterhin, wie Sand am Meer, fast so viele wie Bordsteinschwalben, die aus sämtlichen Himmelsrichtungen herbeigeflattert waren. Ein Freund von mir war damals bei der Sitte, von daher wusste ich Bescheid. Die Herren Diplomaten, Funktionäre des IOC und vor allem die Parteibonzen wollten schließlich bei Laune gehalten werden, Ringelpietz mit Anfassen inklusive. Offiziell wurde zwar nichts bekannt, aber dass da allerhand am Laufen war, darüber wusste jeder im Präsidium Bescheid.
Not macht bekanntlich erfinderisch, vorausgesetzt, man verfügt über ein Minimum an Fantasie. Oder, auf die Nazis bezogen, über ein Höchstmaß an krimineller Energie. Nehmen wir zum Beispiel die Sache mit der Schutzhaft. Von der wurde im Vorfeld der Olympiade reichlich Gebrauch gemacht. Um der Welt vorzugaukeln, dass Berlin von Kriminellen gesäubert worden sei, war den Nazis jedes Mittel recht gewesen. Dass es mitunter die Falschen traf, schien niemanden zu interessieren, auch meine Herren Vorgesetzten nicht. Schon damals konnte die Gestapo nach Belieben schalten und walten, und als das Schaulaufen vor der Weltöffentlichkeit beendet war, wurde es erst richtig schlimm. Wie schlimm, brauche ich nicht auszuführen. Aufgemuckt hat natürlich keiner, wie auch, wenn die Fahrscheine nach Oranienburg schon bereitlagen. Einfach, versteht sich, bei so etwas war mit den Nazis nicht zu spaßen. Frei nach dem Motto, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Kurzum, die Kollegen, die den Mund aufgemacht haben, konnte man an einer Hand abzählen. Tja, was soll man machen. Jeder ist sich selbst der Nächste, wie das sattsam bekannte Sprichwort sagt.
»Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von vier Jahren, und dann urteile und richte uns!« Soweit der größte Verbrecher aller Zeiten, O-Ton vom 1. Februar 1933. Schauen wir uns doch die Zahlen an, im Gegensatz zu den Nazis lügen die wenigstens nicht. Von Berufs wegen hatte ich häufig in der Gerichtsmedizin zu tun, deshalb war ich auf dem Laufenden. Ich könnte mir weiß Gott etwas Schöneres vorstellen, aber das nur am Rande.
An ungeklärten Todesfällen, das weiß ich aus berufenem Munde, herrschte anno ’36 kein Mangel. Im Gegenteil. Um den Bedarf decken zu können, waren im Vorjahr eigens sieben neue Sektionstische angeschafft worden. Und das beileibe nicht ohne Grund. Gut 3.000 Leichenöffnungen in einem Jahr, im Schnitt knapp zehn am Tag. Ich finde, hier erübrigt sich jeder Kommentar. Auffällig auch die vielen ungeklärten Todesfälle, nachzulesen im Sektionsbuch, wo sie akribisch festgehalten wurden. Beispiele gefällig? Daran soll es nicht scheitern. Da wäre etwa ein Pensionär, der sich am 1. August im Bahnhof Treptow vor einen Zug wirft. Oder ein 58-Jähriger, der erhängt aufgefunden wird. Oder ein Arzt, der sich eine Überdosis Morphium spritzt. Oder ein Ehepaar aus meiner Nachbarschaft, das an einer Gasvergiftung stirbt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Allein zwischen dem 1. und dem 16. August 1936, während die Nazis ihre Kabarettnummer abziehen, gibt es sage und schreibe 77 ungeklärte Todesfälle zu verzeichnen, davon allein 27 durch Gasvergiftungen, 23 durch Erhängen, zwölf durch Ertrinken, insgesamt sechs durch Schusswaffengebrauch, vier, indem sich die armen Teufel vor einen Zug warfen, drei durch Medikamentenmissbrauch und ganze zwei – na, durch was denn wohl? Genau! –, durch übermäßigen Alkoholkonsum. Knapp 10 Obduktionen an einem Tag, verheerender hätte die Bankrotterklärung nicht ausfallen können. All die Morde, die auf das Konto der SA oder der Gestapo gehen, nicht mitgerechnet.
77 ungeklärte Todesfälle in nur 15 Tagen. Da sage mal einer, unter den Nazis sei es bergauf gegangen. Pustekuchen. Bergab ist es gegangen, und zwar mit Karacho. Und dann kommt dieser Großkotz daher und tut so, als brächen bessere Zeiten an. Ich darf gar nicht dran denken, sonst dreht es mir den Magen um. Auch jetzt noch, fast 40 Jahre später. Und daher, liebe Mitbürger: bitte keine faulen Ausreden mehr.
Wir alle, die wir im Präsidium Dienst geschoben haben, waren im Bilde.
Bis ins kleinste Detail, ohne Ausnahme.
Wenn wir gerade vom Präsidium reden, mein Büro befand sich in der »Roten Burg«, unter Zugereisten auch als Polizeipräsidium am Alexanderplatz bekannt. Wurde kurz vor Kriegsende 1945 zerstört, ein Schicksal, das es mit einem Großteil von Berlin gemeinsam hatte. Was sich dort abgespielt hat, lässt sich schwer in Worte kleiden, und wenn, wird man den Geschehnissen nicht gerecht. Solange die Nazis noch nicht richtig im Sattel saßen, ging am Alex alles seinen geregelten Gang. Zumindest halbwegs. Aber dann, unmittelbar nach der Olympiade, wurde auf einmal alles anders. Wie oft ich mit Hilfspolizisten von der SA oder mit der Gestapo aneinandergeraten bin, habe ich nicht gezählt. Dass ich mir damit Ärger eingehandelt habe, lässt sich unschwer nachvollziehen. Auch jetzt, knapp 40 Jahre später, packt mich immer noch die Wut, wenn ich nur dran denke. Behaupte nur ja niemand, er wisse nicht, was sich im Zellentrakt des Präsidiums abgespielt hat. Alle, die in der Roten Burg ein- und ausgingen, haben es gewusst.
Auch ich.
Und genau das ist der Punkt. Auch ich, der 23-jährige Jungspund, war über die Vorgänge im Bilde. Die Schreie waren ja nicht zu überhören – und die Transporter, mit denen die Delinquenten zwecks »Sonderbehandlung« in die Prinz-Albrecht-Straße gekarrt wurden, nicht zu übersehen. Wie gesagt, um nicht mitzukriegen, was da lief, musste man blind, taub oder völlig meschugge sein.
Wie ich?
»Moment mal, ich kann das erklären!« Keine Angst, dieser Satz wird mir nicht über die Lippen kommen. Wie all die übrigen Kollegen, vom Pförtner bis zum Polizeipräsidenten, wusste ich Bescheid. Zuerst in die »Rote Burg«, wo die gravierenden von den minder schweren Fällen getrennt wurden, danach in die Prinz-Albrecht-Straße, wo Heydrich & Co. sämtliche Register zogen, um Gegnern des Regimes das Fürchten zu lehren, und dann, so man die Tortur in den schalldichten Zellen überstanden hatte, ab nach Tegel, wo man das Privileg genoss, die Zelle mit gewöhnlichen Kriminellen zu teilen. Oder mit Spitzeln, je nachdem. Wie jedermann weiß, hatten die Denunzianten damals Hochkonjunktur, vor allem in unseren Reihen. »Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen.« So lautete bei etlichen Kollegen die Devise.
Warum dann nicht wenigstens ich den Mund aufgemacht habe?
Gute Frage.
Antwort: Dafür gibt es keine Entschuldigung. Ich war 23 – und somit erwachsen, stammte aus gutem Haus, verfügte über eine exzellente Erziehung, war in Eton und im Gymnasium zum Grauen Kloster zur Schule gegangen und nach Auskunft der Unterrichtenden nicht auf den Kopf gefallen, meine Mathematiklehrerin selbstredend ausgenommen. Um ein Haar hätte ich die nämlich in den Wahnsinn getrieben.
Ich wiederhole, für mein Verhalten gibt es keine Entschuldigung. Weder war ich verheiratet, noch hatte ich Kinder, noch gab es Leute, für die mein Wohlbefinden von Vorteil gewesen wäre. Auch das hört sich reichlich makaber an, ich weiß. Aber es war so, ob einem die Wortwahl behagt oder nicht. Meine Eltern lebten bereits getrennt, und da ich mit meinem alten Herrn zeitlebens über Kreuz gelegen bin, war mein Bedarf in puncto Familie gedeckt.
Der geneigte Leser ahnt es bereits, in meinen Adern fließt blaues Blut. Mir persönlich war und ist das schnurzpiepegal, meinem Vater dagegen nicht. Wer weiß, vielleicht tue ich ihm unrecht, aber mein alter Herr konnte nun mal nicht aus seiner Haut. Aristokrat der alten Schule, stolzer Besitzer eines Rittergutes in der Nähe von Neuruppin, Ministerialdirigent im Reichsaußenministerium und enger Berater respektive Intimus von Joachim von Ribbentrop. Das sagt ja wohl alles. Kurzum, zwischen uns beiden gab es so gut wie keine Gemeinsamkeiten. Ich weiß noch genau, wie Vater reagiert hat, als er erfuhr, dass ich Kriminalbeamter werden will. Mannomann, da war vielleicht was los. Ein Wunder, dass er mich nicht hochkant rausgeworfen hat.
Und meine Mutter? Nun, was das betrifft, halten sich meine Emotionen ebenfalls in Grenzen. Seit der Trennung meiner Eltern Anfang 1929 und der anschließenden Heimkehr nach England habe ich sie nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Eine Karte zum Geburtstag, eine weitere an Weihnachten. Mehr war nicht. Schade drum, aber was will man machen.
Schon gut, ich weiß. Wenn ich mich über meine Vita auslasse, komme ich vom Hundertsten ins Tausendste. Tut mir leid, soll nicht wieder vorkommen. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Und reden wir lieber über die Gegenwart, das ist besser so. Momentan habe ich weiß Gott andere Sorgen, und was für welche. Wenn du befürchten musst, dass dir jeden Moment eine Kugel durch den Kopf gejagt wird, dann hast du in der Regel andere Sorgen. Überleben ist bekanntlich Glücksache, und ohne Glück, wie eingangs vermerkt, wäre ich nicht mal 30 geworden.
Aber lassen wir das. Und kommen wir zum Thema, will heißen zu den Vorgängen, die mir das Prädikat »meistgesuchter Kripo-Beamter von West-Berlin« beschert haben.
Bevor ich es vergesse, mein Name ist Sydow – ohne das »von«, wenn ich bitten darf. Im Folgenden meine Personalien, dann wäre auch das geklärt. Vorname: Thomas. Familienstand: verheiratet. Leibliche Kinder: keine, soweit ich weiß.
Ist ja gut, soll nicht wieder vorkommen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Je aussichtsloser die Lage, desto dichter sitzt mir der Schalk im Nacken.
Noch Fragen? Zugegeben, über mein Alter rede ich nicht gern. Aber wenn wir schon mal dabei sind: Ich bin 61 – aber nicht mehr lange. So ich meinen 62., der am 13. März dieses Jahres anliegt, noch erleben werde. Körpergröße: 1,92 Meter, die blauen Augen und das einstmals rotblonde Haar nicht zu vergessen. Gewicht: Geht niemanden was an. Besondere Kennzeichen: Narbe knapp oberhalb der Gürtellinie, zurückzuführen auf eine Schussverletzung aus dem Jahr 1942.
Wie ich mir die eingehandelt habe?
Ein wunder Punkt, sowohl wortwörtlich als auch im übertragenen Sinn. Darüber zu reden fällt mir schwer, auch jetzt noch, knapp 33 Jahre danach. Damit wir uns richtig verstehen, bei der Schramme, die von einer Schießerei mit der Gestapo herrührt, handelte es sich um einen Streifschuss, weder lebensgefährlich noch sonst wie von Bedeutung. Nur ein Kratzer, um mit den Helden eines drittklassigen Vorabendkrimis zu reden.
Ich will es mal so sagen, die Erinnerung an damals lässt mich nicht mehr los. Speziell jetzt, wo ich die 60 überschritten habe, vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht an den 7. Juni 1942 denke. Egal, was ich tue, um das Datum aus meinem Gedächtnis zu streichen – ich komme auf keinen grünen Zweig. Kaum denke ich an die Schießerei, muss ich an Rebecca denken, der ich es zu verdanken habe, dass ich der Gestapo um Haaresbreite entkommen bin. Hört sich nach Hollywoodschinken an, ich weiß. Ist aber nicht so. Wenn es jemanden gibt, dem ich mein Leben zu verdanken habe, dann dieser Frau. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Abschließend nur so viel: Wäre ich der Gestapo in die Hände gefallen, hätte ich nichts zu lachen gehabt. Eher durch Zufall und im Zuge der Ermittlungen im Mordfall Möllendorf war ich in den Besitz des zu jener Zeit bestgehüteten Staatsgeheimnisses gelangt, weswegen ich bei meinen Vorgesetzten ein für alle Mal unten durch gewesen bin. Dass das Protokoll der »Besprechung über die Endlösung der Judenfrage« vom 20. Januar 1942 unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit kommen durfte, verstand sich aus Sicht des Reichsführers-SS von selbst. Die Konferenz am Großen Wannsee 56–58 ging denn auch in aller Heimlichkeit über die Bühne, dank eines gewissen Reinhard Heydrich, der die Fäden fest in der Hand gehalten und Bedenken, so sie geäußert wurden, mit Herrschergebärde vom Tisch gewischt hatte. Dass es sich beim Autor des Protokolls um Adolf Eichmann handelte, setzte dem Mordkomplott hinter verschlossenen Türen die Krone auf.
Warum ich das an dieser Stelle erzähle?
Ganz einfach. Weil die Methoden, mit denen man mich zum Schweigen bringen will, die gleichen wie Anfang Juni 1942 geblieben sind. Um es erneut zu betonen: Ich übertreibe nicht. Damals wie heute gibt es jede Menge Leute, denen man nicht über den Weg trauen kann. Leute mit Beziehungen, die bis hinauf in höchste Kreise reichen und die bei Bedarf aktiviert werden können, um die Politiker nach Gutdünken zu manipulieren. Unter uns: Im Grunde ist es egal, wo die Leute ihr Kreuz auf dem Wahlzettel machen. Die Herren – und spärlich vertretenen Damen – im Schöneberger Rathaus stecken allesamt unter einer Decke. Soweit die Lehren, die ich in meiner Eigenschaft als Staatsdiener gezogen habe.
Und noch etwas. Ich bin beileibe kein Revoluzzer, sondern so ziemlich das genaue Gegenteil. Meine Frau sagt immer, ich sei Preuße durch und durch, und ich befürchte, sie hat Recht damit. Sagen wir mal so, wenn deine Familie König, Volk und Vaterland über 200 Jahre treu gedient hat, dann färbt das irgendwann auf dich ab. Dann kannst du gar nicht anders, als dich über die Zustände, wie sie hierzulande herrschen, grün und blau zu ärgern. Erfinderisch, wie wir Berliner nun mal sind, wurde eigens ein Begriff für diese Zustände kreiert: Berliner Filz.
»Sie sollten sich was schämen, und so was ist Beamter!« Ich fürchte, mit dem Vorwurf muss ich leben. Und ja, hin und wieder schieße ich übers Ziel hinaus, das ist leider so. Mein Unbehagen, um es dezent zu formulieren, kommt jedoch nicht von ungefähr. Nur ein Beispiel, dann werde ich das Thema nicht mehr anschneiden. Es ist gerade mal ein Jahr her, dass die Bauarbeiten am Steglitzer Kreisel auf Betreiben des Senats eingestellt wurden. Bis dahin waren in den Bau des Gebäudekomplexes sage und schreibe 35 Millionen DM geflossen, die Schulden der Architektin, auf denen das Land Berlin aufgrund einer Bürgschaft sitzen blieb, nicht mitgerechnet. Letztere beliefen sich auf stolze 42 Millionen Mark, Grund genug, den Staatsanwalt auf den Plan zu rufen. Das Ende vom Lied: Verfahren eingestellt.
77 Millionen Mark an Steuergeldern mal eben so in den märkischen Sand gesetzt, ohne dass auch nur einer der Beteiligten hinter Gittern gelandet wäre. Wenn das nicht zum Himmel schreit, weiß ich auch nicht mehr.
Ach so: Der Finanzsenator musste zurücktreten, und der Oberfinanzpräsident wurde in den Ruhestand versetzt. Dabei ist es geblieben. Und die Moneten, die in irgendwelchen Kanälen versickert sind? Na, die können wir getrost abschreiben.
Warum ich das in epischer Breite schildere? Nur Geduld, auf den Grund werde ich noch zu sprechen kommen.
Wechseln wir das Thema, bevor mir endgültig der Kragen platzt. Damals gab und heute gibt es bedauerlicherweise Leute, denen ich ein Dorn im Auge bin. Gestern Abend, genauer gesagt kurz nach acht, war es dann – wieder mal – so weit. Ich befand mich gerade auf dem Nachhauseweg, da kam mir eine dunkle Limousine entgegen, ein Szenario wie in einem Gangsterfilm, nur leider mit fatalen Folgen. Wie immer war ich am U-Bahnhof Kleistpark ausgestiegen, hatte mir am Kiosk von Mutter Lubitsch ein paar Glimmstängel gekauft, noch ein bisschen rumpalavert und mir ein eisgekühltes Berliner Kindl genehmigt. Am Ende eines 12-Stunden-Tages musste das einfach sein. Ja, und dann habe ich mich zu Fuß auf den Nachhauseweg gemacht. Auf meine Umgebung habe ich nicht groß geachtet, zumal ich die Grunewaldstraße in- und auswendig kenne. Bei uns kennt jeder jeden – aber das nur am Rande.
Etwa 100 Meter von meinem Domizil entfernt, in Höhe des Kurt-Hiller-Parks, ist es dann passiert. Hätte man mir geschildert, was jetzt gleich über die Bühne gehen würde, ich wäre mir veräppelt vorgekommen.
Klein-Chicago in Schöneberg? Nie und nimmer. Zustände wie anno ’42, als ich dem Teufel in letzter Sekunde von der Schippe gesprungen bin? Hier doch nicht, alles nur Schwarzmalerei. Ein Killerkommando, das den Auftrag hatte, einen hartnäckigen Widersacher aus dem Weg zu räumen? Alles erstunken und erlogen.
Schön wär’s, ich wollte, es wäre so gewesen.
Wenn ja, mir wäre einiges erspart geblieben.
DOKU (I)
So wurde Berlins
CDU-Chef entführt
100.000 DM Belohnung ausgesetzt
Berlin, 28. Februar 1975
Der entführte CDU-Chef hat um sein Leben gekämpft. Seine Kidnapper haben ihn wahrscheinlich mit einer Betäubungsspritze während der Fahrt betäubt. In seinem Dienst-Mercedes wurde eine Schutzhülle für eine Injektionsspritze gefunden. Außerdem ist der Innenspiegel abgerissen, die Windschutzscheibe zertrümmert …
Die Nachricht von der Entführung hatte gestern Menschen gelähmt und aufgeschreckt. Es war die erste Entführung eines deutschen Politikers. Sie war eiskalt geplant.
Rechts aus dem Ithweg schoss plötzlich ein Mercedes LKW der Autovermietung Karolewicz heraus, blockierte die ganze Fahrbahnbreite des Quermatenwegs. In diesem Augenblick fuhr ein roter Fiat auf den Mercedes auf.
Aus: Bild BERLIN, 28. Februar 1975 (gekürzt)
*
Hubschrauber bei der Jagd auf die Gangster
CDU-Chef
mit Waffen entführt
Eigenbericht »Der Abend«
Berlin, 27. Februar
Der Berliner CDU-Vorsitzende ist heute früh von bisher noch unbekannten Tätern entführt worden. Nach ersten Berichten der Polizei wurde der schwarze Mercedes-Dienstwagen des 52-jährigen Politikers unweit seines Wohnhauses in Höhe des Quermatenwegs 101 in Zehlendorf von einem bisher noch unbekannten Fahrzeug blockiert und zum Halten gezwungen. Die Täter schlugen den Fahrer des Dienstwagens zusammen, zerrten ihn aus dem Auto und warfen ihn auf die Straße. Wie »Der Abend«erfuhr, soll sich dann einer der Entführer an das Steuer des Autos des CDU-Vorsitzenden gesetzt haben. Mit hoher Geschwindigkeit raste das Fahrzeug davon.
Die West-Berliner Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein. Sie verlief bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe ohne Erfolg. Der Fahrer des Dienstwagens, der ersten Berichten zufolge das Bewusstsein verloren hatte, lief, nachdem er wieder zu sich gekommen war, zu einem nahegelegenen Wohnhaus, von dem aus er die Polizei alarmierte.
Aus: »Der Abend«, Donnerstag, 27. Februar 1975 (gekürzt)
ERSTER TAG
(Donnerstag, 27.02.1975)
BEWEISAUFNAHME (I)
3
Berlin-Zehlendorf, 8.50 Uhr
Alles, was recht ist, Herr Vorsitzender. Aber das mit der Entführung, das konnte man doch nicht vorausahnen. Also ich jedenfalls nicht, dazu fehlt mir die Fantasie. Und was Ihre Frage betrifft, wenn dir ein Viertonner die Vorfahrt nimmt, dann denkst du nicht lange nach. Dann latschst du auf die Bremse, volle Pulle, bis dir die Socken qualmen. Das heißt, falls du überhaupt dazu kommst. Falls nicht, hast du ein Problem an der Backe. Aber egal. Was ein alter Hase ist, der weiß, was er zu tun hat. Mit anderen Worten, ausweichen war nicht. Deshalb habe ich eine Vollbremsung hingelegt.
Gekracht hat es aber trotzdem. Und wie. Der Fiat ist mir volle Pulle hinten reingefahren. Aber selbst da, ein, zwei Sekunden später, hab ich keinen Verdacht geschöpft. Wenn man wie ich jahrelang Leute durch die Gegend kutschiert, dann kann einen nichts mehr erschüttern. Wollte man die Idioten, die hinterm Steuer sitzen, aus dem Verkehr ziehen, dann gäbe es endlich Platz auf den Straßen.
Jede Wette.
So wahr ich hier stehe, ich war völlig ahnungslos. Der Chef auch, sonst hätte er mich nicht aufgefordert, nach dem Rechten zu sehen. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen, denn ich hatte eine Mordswut im Bauch.
An das, was danach passierte, kann ich mich kaum erinnern. Aber die Nummer des Fiats, die habe ich mir gemerkt. B-P 8077. Wenigstens das, besser als nichts. Hinter dem Steuer saß eine Frau, ziemlich jung, lange blonde Haare und Sonnenbrille. Und das Ende Februar, in aller Herrgottsfrühe. Die Temperaturen waren zwar schon recht mild, aber bis die Sonne rauskam, hat es noch gedauert.
Na schön, spätestens da hätte ich merken müssen, dass etwas im Busch ist. Hab ich aber nicht. War ja wohl verständlich, oder? Auf die Gefahr, mich zu wiederholen: Auf die Idee, dass mir jemand eins über den Schädel ziehen würde, bin ich nicht gekommen.
War aber leider so, ich kann’s nicht ändern. Ich weiß, jetzt stehe ich da wie der letzte Idiot. »Da haben sie dich aber ganz schön reingelegt, Erich.« Sie glauben nicht, was ich mir alles anhören musste. Mehr als drei Jahre lang, aber das nur nebenbei.
Jeder andere an meiner Stelle hätte das Gleiche getan. Wer auch immer damals am Steuer gesessen hätte, er oder sie wäre ausgestiegen, hätte geguckt, ob der Mercedes etwas abbekommen hat. Das tut man ja wohl automatisch, es sei denn, jemand wurde verletzt. Bei meinem Chef und der Blondine hinter dem Steuer des Fiats war das nicht der Fall, deshalb habe ich getan, was in solchen Fällen üblich ist. Das heißt, ich bin auf den Fiat zugegangen, um die Dame hinterm Steuer ins Gebet zu nehmen.
Doch da hatte ich die Rechnung ohne diese Verbrecher gemacht. Die schrecken vor nichts zurück, das ist nun mal leider so. Eine Eisenstange mit Klebeband umwickeln und unbescholtenen Bürgern wie mir eins über den Schädel ziehen. Hinterrücks, versteht sich, und ohne Rücksicht auf Verluste. Ich sage nur: »Mogadischu.« Oder »Hanns Martin Schleyer«, wenn die Spät-Hippies im Saal nichts dagegen haben. Ja, grinsen Sie nur, das Lachen wird Ihnen noch vergehen! Wie man für so jemanden Verständnis haben kann, das will mir nicht in den Kopf. Das geht über meinen Horizont. Ich bin zwar nur ein einfacher Mann, aber wenigstens weiß ich, was Anstand ist. Unbescholtene Bürger niederknüppeln, das ist ja wohl das Letzte.
So, jetzt ist aber Schluss. Ich merke schon, ich bin dabei, übers Ziel hinauszuschießen. Nichts für ungut, Herr Vorsitzender. Soll nicht wieder vorkommen. Schließlich geht es hier nicht um mich, sondern um meinen Chef.
Moment, ich muss nur mal kurz meine Tabletten nehmen. Die Aufregung, Sie verstehen.
Herr von Drewitz hatte niemandem etwas getan, das sagte ich bereits. Nicht mal im Traum wäre ich auf die Idee gekommen, dass es Leute gibt, die zu so etwas imstande sind. Aber so ist das nun mal im Leben, ob es einem in den Kram passt oder nicht. Wenn du prominent bist, musst du mit allem rechnen, gerade als Politiker. Aber gleich mit so was, mit einer Entführung? Ich denke, das wäre ein bisschen viel verlangt. Kriminelle gibt es ja weiß Gott genug, aber das mit meinem Chef, das schlägt dem Fass den Boden aus. Selbst ich komme da nicht mehr mit, und ich habe schon allerhand erlebt, das können Sie mir glauben.
Ich möchte wissen, was in solchen Köpfen vor sich geht. Herr von Drewitz war doch keiner von denen, die einen auf harten Hund gemacht oder damit gedroht haben, nach der Wahl andere Saiten aufzuziehen. Ich jedenfalls kann nichts Schlechtes über ihn sagen, dafür aber jede Menge Gutes. Den Leuten Honig um den Mund schmieren, das ist nicht mein Ding. Wenn, dann nenne ich das Kind beim Namen, da brauchen Sie keine Angst zu haben. Herr von Drewitz war ein Chef, wie man ihn sich nur wünschen kann, der hatte immer ein offenes Ohr für mich. Zu dem konnte man mit allem kommen, auch wenn er vor lauter Arbeit nicht mehr aus noch ein wusste.
Zu tun gab es damals eine Menge, kein Wunder, waren ja nur noch drei Tage bis zur Wahl. Wie immer war ich Punkt acht zur Stelle, egal an welchem Tag, der Ablauf war stets der gleiche. Bin kurz ausgestiegen, habe geklingelt und gewartet, bis sich der Chef oder Frau von Drewitz über die Sprechanlage melden. Bis zum Morgen des 27. war das immer so gewesen, beinahe 13 Jahre, in denen ich als Chauffeur tätig gewesen bin. An eine Ausnahme von der Regel kann ich mich nicht erinnern, da kann ich mir den Kopf zerbrechen, wie ich will.
Doch, die gab es. Jetzt, wo ich es sage, fällt’s mir wieder ein. Anders als sonst, wo er Punkt acht auf der Matte stand, musste ich am 27. eine geschlagene Dreiviertelstunde warten. Irgendein Telefonat, was weiß ich. Um mir die Zeit zu vertreiben, habe ich eine geraucht. Dann habe ich mich ins Auto gefläzt und mir die Zeit mit Radio hören vertrieben. Viertel vor neun war der Chef dann endlich so weit. Konnte ja mal vorkommen, was soll’s.
Auch die Route war stets die gleiche. Nach circa 50 Metern nach rechts, an der Kreuzung Schillerstraße/Klopstockstraße nach links und dann immer geradeaus. Am Hüttenweg, also nach fünf Kilometern oder so, ging’s dann auf die Avus. Und von dort aus weiter ins Westend, wo der Chef seine Kanzlei hat – beziehungsweise hatte. Wenn nichts los war, haben wir für die Strecke so um die 20 Minuten gebraucht, im Berufsverkehr natürlich länger. Am 27., nach etwa 1,5 Kilometern, war dann aber frühzeitig Endstation. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht zum Reagieren gekommen. An der Ecke Quermatenweg/Ithweg ist es dann passiert, das hat der Herr von der Kripo ja bereits erwähnt. Ein Viertonner von rechts, wie aus dem Nichts. Sicht gleich Null, wegen der Bäume. Beschauliche Ecke, da kannst du nicht meckern. Eine Villa neben der andern, eine protziger als die nächste.
Nobel geht die Welt zugrunde.
Sonst noch was von Bedeutung? Nee, ich denke, damit ist alles gesagt. Um es nochmals zu betonen, auch wenn ich Ihnen damit auf die Nerven gehe: Wir, das heißt der Chef und ich, wir beide hatten nicht die geringste Chance. Der Herr Kommissar hat es ja schon gesagt, die haben das bis ins Detail geplant. Die haben nichts dem Zufall überlassen, das ging ruck, zuck. Zwei, drei Minuten, wenn es hoch kommt.
Dann war es vorbei.
Wissen Sie, was mich dabei wundert? Dass ich nicht mehr abbekommen habe. Für mich grenzt das an ein Wunder, denn wenn dir jemand eine Eisenstange über den Schädel zieht, ist normalerweise Feierabend. Aber nicht bei mir. Glück gehabt. Eine Weile war ich ziemlich benommen, aber dann, nachdem die Halunken verduftet waren, habe ich mich aufgerappelt und an der nächstbesten Tür geklingelt.
Da war es 8.53 Uhr, auf die Minute genau.
BEWEISAUFNAHME (II)
4
Berlin-Zehlendorf, 8.50 Uhr
Alle Achtung, Herr Staatsanwalt. Sie wollen es aber genau wissen. Na schön, wenn’s der Wahrheitsfindung dient. Dann will ich mal nicht so sein.
Denken Sie bloß nicht, ich bin so redselig, weil ich meinen Hintern retten will. Tut mir leid, was das betrifft, sind Sie auf dem Holzweg. Und kommen Sie mir bloß nicht mit Versprechungen, von wegen Kronzeugenregelung und so. Die Mühe können Sie sich sparen. An mir beißen Sie sich die Zähne aus, also versuchen Sie es gar nicht erst.
Eins gleich vorweg. Wir von der Bewegung 2. Juni, wir sind keine gewöhnlichen Verbrecher. Auch wenn es die Springer-Mafia und das politische Establishment anders sehen. Wir sind Revolutionäre. Tupamaros. Also, wenn mich einer als Terrorist bezeichnen würde, dem würde ich was erzählen. Bei uns ist Gewalt nicht an der Tagesordnung, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Wir greifen zur Knarre, wenn es nicht mehr anders geht, und nur dann. Glauben Sie, es macht mir Spaß, mit einem Schießprügel rumzufuchteln oder einen Geldsack wie von Drewitz zu kidnappen und das Risiko einzugehen, für den Rest meines Lebens eingebuchtet zu werden? Alles, was recht ist, Herr Staatsanwalt, aber das glauben Sie ja wohl selbst nicht.
Und daher noch mal, auch für die Damen und Herrn Zuschauer. Wir sind keine gewöhnlichen Kriminellen. So einfach werden wir es den Monopolkapitalisten nicht machen. Wir sind Tupamaros. Stadtguerilleros. Schon mal davon gehört, Herrschaften? Es soll nämlich Leute geben, die haben damit ihre Schwierigkeiten. Schließlich leben wir nicht in Südamerika, sondern in Berlin. Bei allen Unterschieden, eins haben wir mit den Genossen dort gemeinsam, nämlich die Willkür der herrschenden Klasse. Sie merken, worauf ich hinauswill? Dann bin ich ja zufrieden. Stadtguerilla, das ist bewaffneter Kampf, gegen das System an sich sowie gegen seine Handlanger, will heißen gegen Polizei und Klassenjustiz. Deshalb werden wir ja auch bekämpft, weil wir einen klaren Trennungsstrich ziehen. Auf der einen Seite steht der Feind, also die Ausbeuter, und auf der andern, aufseiten des Proletariats, da stehen wir. So einfach ist das. Wenn auch nicht einfach genug, wie ein Blick in die BILD-Zeitung lehrt.
Bitte nehmen Sie es nicht persönlich, Herr Staatsanwalt, aber das musste mal gesagt werden. Sie haben mich nach meinen Motiven gefragt, und ich habe Ihnen eine Antwort gegeben.
Und noch etwas. Unser Kampf richtet sich gegen die Repräsentanten des Systems, nicht etwa gegen das Volk. Gegen die Leute, die Holger Meins auf dem Gewissen haben. Den Zuhörern hier im Saal wird der Name zwar nichts sagen. Aber uns, das heißt den Genossen vom 2. Juni, sagt er umso mehr. Ich weiß ja nicht, wie Sie darüber denken, aber es gibt da eine Sache, die will mir ums Verrecken nicht in den Kopf. Ich verstehe nicht, wieso man die Genossen in den Gefängnissen behandelt, als habe man es mit Schwerstkriminellen zu tun. Das sind politische Gefangene, ist das denn so schwer zu kapieren. Und weil das so ist, haben sie das Recht, miteinander zu kommunizieren. Solange die Isolationshaft nicht aufgehoben wird, solange wird der bewaffnete Kampf weitergehen. Egal wie lange ich in den Knast wandere, die Repräsentanten des Systems werden keine ruhige Minute mehr haben.
So weit meine Motive.
Noch Fragen?
Stimmt, Sie wollten ja wissen, wie wir uns auf die Entführung vorbereitet haben. Und ab wann. Nun ja, was Letzteres betrifft, konkret wurde es ab Weihnachten 1974. Da haben wir angefangen, uns Gedanken über den genauen Ablauf zu machen. Ich weiß, kein Mensch traut uns Chaoten sowas zu, aber bei der Planung wurde nichts dem Zufall überlassen. Das ging sogar so weit, dass wir das Szenario mit Spielzeugautos simuliert haben. Wenn schon, denn schon. Und dann, so um die Jahreswende 1974/75, haben wir den Herrn von und zu näher unter die Lupe genommen. Nicht aufzufallen war ziemlich schwer, von wegen lange Haare und so. In einem Villenviertel kennt bekanntlich jeder jeden, das kam erschwerend hinzu. Egal, am Ende haben wir es irgendwie hingekriegt. Ab da lief die Sache wie am Schnürchen. So merkwürdig es klingt, unter anderem war das auch von Drewitz zu verdanken. Sein Tagesablauf war nämlich immer der Gleiche, und wir hätten uns ziemlich dämlich anstellen müssen, um die Sache zu vergeigen.
Der Herr Staranwalt, das war ein Gewohnheitsmensch. Das haben wir sofort spitzgekriegt. Jeden Morgen die gleiche Leier, wie beim Militär. Ich muss sagen, ich hatte mir das schwieriger vorgestellt. Der Mann war sowas von leicht auszurechnen, da konnte man nichts falsch machen. Kurz vor acht ist der Chauffeur vorgefahren, hat geklingelt und gewartet, bis sein Brötchengeber so weit war. Übermäßig lange hat das nicht gedauert, zwei, drei Minuten, wenn überhaupt. Tja, und dann kam der Herr Anwalt aus dem Haus spaziert, hat sich auf den Beifahrersitz gesetzt und so getan, als seien sein Fahrer und er die dicksten Freunde. Das ist ja gerade die Kunst, nämlich so zu tun, als ob. In Wirklichkeit war es ihm doch egal, wie es dem Typen geht, selbst ein Blinder hätte das gemerkt. Aber was soll ich sagen, wenn Wahlen sind, dann herrschen andere Gesetze.
Eins sollte ich noch dazusagen. Am Tag der Entführung, also am 27., da drohte die Sache aus dem Ruder zu laufen. Von Drewitz hatte Verspätung. Keine Ahnung, was los gewesen ist, aber er war eine Dreiviertelstunde über der Zeit. Ich war kurz vor dem Ausflippen, so sehr ist mir die Warterei auf den Zeiger gegangen. Da zerbrichst du dir monatelang den Kopf, planst, machst, tust und malochst dir einen ab, nur damit der Coup über die Bühne geht – und dann so etwas. Das geht einem an die Nieren, und wie. Um ganz ehrlich zu sein, wäre es nach mir gegangen, ich hätte Order gegeben, die Sache abzublasen. Das Kollektiv hat jedoch anders entschieden, mit welchen Folgen, wissen Sie so gut wie ich.
Zum Schluss noch ein paar Worte über die Logistik, damit es nicht heißt, ich hätte was verschwiegen. Alles in allem waren fünf Genossen mit von der Partie, aber das wissen Sie ja bereits. Einen Kleinlaster zu mieten war nicht schwer, ein gefälschter Führerschein, und fertig ist der Lack. Den Fiat zu klauen auch nicht, Glück muss der Mensch haben. Aber was heißt hier »Glück«, wenn du dich so dämlich anstellst wie der Besitzer, dann hast du nichts Besseres verdient. Also wirklich, das muss man sich mal vorstellen. Parkt dieser Typ doch tatsächlich vor der Post, lässt den Motor laufen und steigt aus, um in aller Seelenruhe einen Brief einzuwerfen. Der hat förmlich drum gebettelt, dass wir seine Karre klauen, ob Sie’s glauben oder nicht. Egal, auf die Art sind wir zu dem Fiat gekommen, zum Nulltarif, und ohne einen Finger krumm zu machen. Ein Alfa wäre uns zwar lieber gewesen, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen.
Und noch etwas. Ich kann zwar nur für mich sprechen, aber bevor Sie mich fragen, wie ich aus heutiger Sicht über die Vorgänge denke, möchte ich eines klipp und klar betonen: Auch wenn nicht alles so gelaufen ist, wie wir es uns gewünscht haben, ich würde es jederzeit wieder tun. Es wird zwar nicht jedem gefallen, wenn er mich so reden hört, aber was ich sage, entspricht der Wahrheit. Was im Zusammenhang mit der Entführung falsch gelaufen ist, das müssen die Polizei und das BKA und was weiß ich wer auf ihre Kappe nehmen – und nicht wir. Dass die Angelegenheit außer Kontrolle geriet, daran tragen die Genossen und ich keine Schuld. Ich sage es ja ungern, aber ich finde, es gibt da ein paar Leute, die sollten sich an die eigene Nase fassen. Die Herren werden sich schon keinen Zacken aus der Krone brechen, auch wenn sie so tun, als ob sie die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten. Wäre es nach uns gegangen, dann hätte von Drewitz die Kurve gekriegt, ich finde, das kann man nicht oft genug betonen.