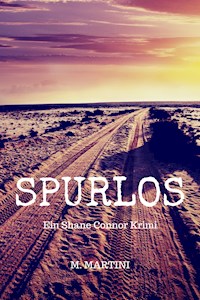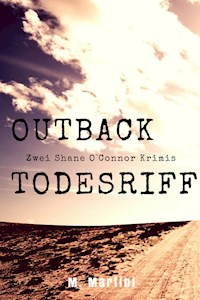7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die Melodie der Sehnsucht.
Tess findet im Nachlass ihres Großvaters einen Fado-Text. Sie ist von der Melancholie und Leidenschaft, die aus den Liedzeilen spricht, so gefesselt, dass sie sich auf die Suche nach der Herkunft des Textes begibt. Die Spur des Fado führt nach Lissabon, wo ihre Mutter vor Jahren tragisch verunglückte. In der pulsierenden Metropole stößt Tess auf das Schicksal eines jungen Mannes, der vor den Nazis nach Lissabon geflohen ist: Er suchte die Freiheit und fand die große Liebe. Wird seine Geschichte sie mit der Vergangenheit versöhnen?
Ein Familienepos, so ergreifend und emotional wie die Klänge des Fado.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Ähnliche
Über Manuela Martini
Manuela Martini, geboren 1963 in Mainz, hat (auch unter den Pseudonymen Lou Peabody und Fran Ray) bereits über 20 Romane, Krimis und Thriller veröffentlicht. Sterne über Lissabon ist ihr erster Familienroman. Die Autorin lebt seit vielen Jahren in Spanien.
Informationen zum Buch
Die Melodie der Sehnsucht.
Tess findet im Nachlass ihres Großvaters einen Fado-Text. Sie ist von der Melancholie und Leidenschaft, die aus den Liedzeilen spricht, so gefesselt, dass sie sich auf die Suche nach der Herkunft des Textes begibt. Die Spur des Fado führt nach Lissabon, wo ihre Mutter vor Jahren tragisch verunglückte. In der pulsierenden Metropole stößt Tess auf das Schicksal eines jungen Mannes, der vor den Nazis nach Lissabon geflohen ist: Er suchte die Freiheit und fand die große Liebe. Wird seine Geschichte sie mit der Vergangenheit versöhnen?
Ein Familienepos, so schwermütig und emotional wie die Klänge des Fado.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Manuela Martini
Sterne über Lissabon
Roman
Inhaltsübersicht
Über Manuela Martini
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Patagonien im Sommer
Chicago im Winter
Lissabon
Chicago
Lissabon
Zweiter Teil
Lissabon
Chicago
Lissabon
Chicago
Lissabon
Chicago
Lissabon
Dritter Teil
Lissabon
Chicago
Lissabon
Chicago
Vierter Teil
Lissabon
Fünfter Teil
Patagonien
Buenos Aires
Patagonien
Chicago
Patagonien
Impressum
Erster Teil
Überall ist Licht, doch ich sehe nichts
Patagonien im Sommer
Der Wind liess die Dachrinne scheppern, ein loses Kabel schlug immer wieder an die Holzwand. Carlos atmete schwer, als er den Oberkörper anhob und sich auf die Ellbogen stützte. In der letzten Zeit schmerzte sein Herz öfter, rief sich in Erinnerung, als sollte er jetzt, am Ende seines Lebens, noch einmal über alles nachdenken. Hatte er nicht schon oft genug über alles nachgedacht, über sechzig Jahre lang? Ein Sonnenstrahl fiel durchs Fenster, ließ den Staub aufblitzen wie Flitter und brannte ein langes Rechteck auf den Holzboden vor dem Ofen.
Mühsam schob er die Beine aus dem Bett. Ganz weiß schauten die Füße unter der dunkelgrauen Schlafanzughose hervor. Er schlüpfte in seine warmen Hausschuhe und stand mühsam auf. Kaffee machen, die elektrische Heizung anstellen, Feuer im Ofen anzünden. Andere in seinem Alter zogen nach Florida und ließen es sich gut gehen. Und er? Bis ans Ende der Welt hatte seine Suche ihn geführt. Patagonien. Einst hatte man Strafgefangene hierher geschickt, heute kamen Touristen.
Er zog den warmen Morgenmantel über, knotete ihn umständlich zu und schlurfte über das warme Lichtrechteck in Richtung Küche. Beim Heizkörper drückte er auf den Knopf, der sogleich rot aufglühte. Den Ofen würde er später anmachen, erst musste er die Asche herausfegen. Ja, er konnte sich noch allein versorgen. Wer in seinem Alter schaffte das schon? Gut, das Essen brachten ihm meist Margarita oder Inez, oder er ging hinüber zu Nicolas. Ein Schmerz in der Brust ließ ihn zusammenzucken. Hatte es letztes Mal nicht auch so angefangen? Und dann war alles ganz schnell gegangen, Atemnot, Herzflimmern, Zuckungen … Er hatte Glück gehabt, dass es im Hotel passiert war und dann auch noch unten an der Rezeption. Nein, das wollte er nicht noch einmal erleben, die Schmerzen, die Todesangst, er wollte sie nicht wieder sehen, all die Bilder seines Lebens. Sie waren an ihm vorbeigezogen und hatten ihn in Panik versetzt, weil er plötzlich sich und sein Leben begriff und er nichts mehr rückgängig machen, die Zeit nicht um dreißig Jahre zurückdrehen konnte.
Diesmal war es nicht das Herz, ganz bestimmt nicht. Er drehte das Wasser auf, füllte den Elektrokocher und blickte nach draußen. Hinter dem Abbruch der Felsen, kaum dreißig Meter von seinem Haus entfernt, breitete sich das Meer bis zum Horizont aus. Der Wind fuhr in kurzen Schüben darüber hinweg. Es glänzte golden, schon bald würde er den Rand des Feuerballs brennen sehen, der sich aus dem Meer erhob, jeden Morgen wieder ein ergreifendes Schauspiel, das entschädigte für schlaflose Nächte.
Seine Augen waren immer noch gut, er konnte nicht nur die Boote der Fischer erkennen, sondern auch weit draußen die Frachter, die Containerschiffe, die nach Südafrika fuhren oder nach Australien.
Dampf stieg auf, und die Fensterscheibe beschlug. Der Holzrahmen war an der rechten Seite schon ziemlich morsch. Noch einen Winter würde er wohl kaum überstehen. Er müsste Inez fragen, ob sie da was machen könnte. Sie hatte ihm auch das Dach repariert und neue elektrische Leitungen gelegt. Ja, auch den Boiler im Bad hat sie ihm eingebaut, erinnerte er sich. Wie hatte es hier ausgesehen, als er das Haus kaufte! War das wirklich schon siebzehn Jahre her?
Mit einem Klicken schaltete sich der Kocher ab. Er schüttete einen Löffel Instantkaffee in den Becher und goss das kochende Wasser auf, bis der Schaum fast den Becherrand erreichte. Es war ein dünner Kaffee, längst schon trank er keinen starken mehr.
Alles herauskratzen, was sich innen festgesetzt hatte, wie den Ölschlick aus den alten Tanks, weil er sehen wollte, woraus er selbst gemacht war, das hatte er nach seinem Herzinfarkt gewollt. Bis ans Ende der Welt war er gegangen, wollte sehen, was dahinter lag, Gewissheit erlangen und keine Sehnsucht mehr haben. Ein dummer Gedanke. Ein Tank ist ein Tank ist ein Tank. Nicht mehr und nicht weniger. Und die Erde ist nun mal eine Kugel. Eine Kugel. Eine Kugel. Ohne Anfang und ohne Ende. Das war ihm klar geworden, und es war ernüchternd. Die Menschen erwarteten zu viel vom Leben. Nun, vielleicht nicht alle. Aber er.
Heiß lief der Kaffee die Kehle hinunter, fühlte sich einen Augenblick lang an wie früher der Whisky. Er schlurfte zurück ins Zimmer und setzte sich auf den Stuhl mit dem grünen Lederpolster. Es störte ihn schon lange nicht mehr, dass es eingerissen war und der Schaumstoff hervorquoll, im Gegenteil, das war ein Zeichen von Leben. Nicht nur Menschen trugen Wunden vom Leben davon. Er stützte die Ellbogen auf die schwere Schreibtischplatte und blickte wieder aufs Meer hinaus.
Überall ist Licht, doch ich sehe nichts.
Der glühende Sonnenball stieg höher, die Schatten der Felsen wurden kürzer. Ein Fischerboot näherte sich den Klippen. Genug gefangen für heute oder kein Glück gehabt und aufgegeben, dachte Carlos.
Ein Klopfen ließ ihn hochschrecken.
»Ich bin’s, Inez!«
»Ist offen!« Er schloss niemals ab, Inez wusste das, aber sie wollte ihn nicht einfach überfallen.
Mit einem Ruck sprang die von der Feuchtigkeit verzogene Holztür auf, und Inez, in Jeans, grobem Rollkragenpulli, dicker Daunenweste und schweren Arbeitsstiefeln, eine blaue Baseballkappe tief in die Stirn gezogen, trat polternd ein.
»Du bist früh dran heute.« Er zeigte auf die Kappe. »Neu?«
»Gefällt sie dir? Hab ich machen lassen.« San José – Mecanicos war in goldenen Buchstaben aufgestickt.
Er nickte.
»Dachte, du willst vielleicht was in deinen Kaffee tunken.« Inez hielt eine Tüte hoch, weiß mit kleinen Fettflecken. Croissants. Die von Margarita mochte er besonders gern.
»Schon überredet.« Merkwürdigerweise hatte er oft Lust auf Croissants, vielleicht hing das mit Paris zusammen.
Sie legte die Tüte auf den Schreibtisch, stemmte die Arme in die Hüften und sah schweigend aufs Meer hinaus. »Ich wette, heute ziehen Wale vorbei.«
Er nickte nur.
Sie nahm die Mütze ab und fuhr sich durch ihr kurzes schwarzes Haar. »Wenn ich alt bin, sehen wir zusammen aufs Meer hinaus, ja?«
»Abgemacht.«
Mit niemandem redete er so wie mit Inez, so normal, so ohne den ganzen Ballast eines langen Lebens, ohne die Zweifel, die ihn immer wieder überfielen. Ob Inez wohl nie Zweifel hatte, überlegte er manchmal, ob sie sich wohl nie in Wünschen und Sehnsüchten verlor?
Sie setzte die Mütze wieder auf und zog den Schirm in die Stirn. »Margarita kommt heute ein bisschen später. Arzttermin.«
»Was hat sie?«
»Nur ’ne lästige Zahngeschichte.«
»Sag ihr, sie braucht mir heute nichts zu bringen.«
»Bist du auf Diät?«
Er nahm die Tüte und hielt sie hoch. »Das reicht für einen alten Mann.«
»Auch ein alter Mann muss essen.«
Manchmal war es ihm peinlich, dass sie sich so um ihn sorgten, und er hatte das schon öfter gesagt, aber sie winkten jedes Mal ab und meinten, sie machten es gern. Er könnte sich nie um einen fremden Menschen kümmern, die Nähe würde ihm Angst machen, die Erwartungen des anderen, die Enttäuschung, die man erleben konnte, den Verlust.
»Also, dann genieß den Tag, hombre!« Inez legte ihm kurz die Hand auf die Schultern, und er spürte ihre Tatkraft, das Leben, das in ihr pulsierte.
An der Tür drehte sie sich noch einmal um. »Am nächsten Wochenende gibt’s bei uns ein Fest, mit Essen und Musik. Margarita hat Geburtstag. Also such deine Tanzschuhe raus!«
Er zeigte auf seine Pantoffeln.
»Hombre, ich wette, du hast die richtigen nur versteckt«, sagte sie lachend.
»Ich überleg’s mir.«
»Und bring deine Schallplatten mit.«
Er hob die Hand. »Adios!«
Wie er so dasaß, immer wieder ein Stück vom Croissant abbrach, es in den Kaffee tauchte und in den Mund steckte und dabei aufs Meer hinaussah, dachte er, dass er sich in seinem Leben nur selten entschieden hatte, er hatte immer so lange gewartet, bis das Leben die Entscheidung getroffen hatte und ihn in die eine oder andere Richtung mitriss. Sein Leben war ein langer Fluss, der sich den Weg zum Meer nicht zielstrebig gegraben hatte, sondern der von anderen Landschaften geträumt und sich unterwegs verirrt hatte und irgendwo, in unbestimmter Ferne, zu versickern drohte. Sogar jetzt, so kurz vor dem Ende, als er endlich das Meer sehen konnte, hielt irgendetwas ihn zurück. Vielleicht sollte er wieder warten, warten auf irgendetwas, das ihn mitriss.
Ein Schwarm Möwen kam über die Klippen heran, ließ sich auf den rauen Felsen, die später, in der Mittagssonne, knochenbleich schimmern würden, nieder, kaum zehn Meter von seinem Haus entfernt, große weiß-graue Vögel, die weit und lange fliegen konnten. Jetzt ruhten sie sich aus, und schon bald, auf ein mysteriöses Kommando hin, würden sie sich wieder erheben und aufs Meer hinausfliegen.
Carlos steckte sich den Rest des Croissants in den Mund. Ein Fest, hatte Inez gesagt. Er begriff nicht, warum er noch immer hier saß und atmete. Schon längst war er zu nichts mehr nütze. Ach, war er überhaupt irgendwann einmal in seinem Leben zu etwas nütze gewesen? Und als er endlich Klarheit schaffen wollte, hatte es in einer Katastrophe geendet. Nie war von Nicolas ein Vorwurf gekommen, nie eine Anschuldigung. Was hast du ihr damals erzählt? Diese Frage hatte er nie gestellt. Dabei litt Nicolas vielleicht noch mehr als er. Durch das Fenster konnte er dessen blau gestrichenes Haus sehen. Um diese Uhrzeit war Nicolas meist schon am Malen, oder er ging fischen. Dann stapfte er in seinem Ölzeug am Haus vorbei und nahm den steilen Abstieg zwischen den Felsen hinunter zum Meer.
Er wandte sich ab, und sein Blick fiel auf den alten, verstaubten Plattenspieler, der auf dem Beistelltisch neben dem Sessel stand, dessen dunkles Polster vom Sonnenlicht schon ganz verschossen war. Er hatte den Plattenspieler über die Zeiten gerettet, hatte ihn mitgeschleppt bis hierher, dabei hörte er schon lange keine Schallplatten mehr.
Carlos hätte nicht sagen können, warum, aber auf einmal bückte er sich, zog eine bestimmte Schallplatte aus dem Fach in seinem Schreibtisch, wo sie aufgereiht standen. Vorsichtig nahm er sie aus der Hülle, legte sie auf den Plattenteller und hob den Tonarm an. Die Platte begann sich zu drehen, die Lautsprecher knackten. Als der erste Gitarrenakkord erklang, flogen die Möwen auf und schwebten davon. Ein Stich fuhr ihm durchs Herz. Er zuckte zusammen, atmete hastig, nein, er wollte keine Angst haben. Der Akkord verhallte. Dann erklang ihre Stimme, und das Stechen in der Brust verwandelte sich in einen anhaltenden Schmerz. Er versuchte, tief und ruhig zu atmen. Die Sonne war inzwischen über den Horizont gestiegen, vom unteren Rand schienen Flammen ins Meer zu tropfen, er stellte sich vor, wie sie im Wasser zischend erstarrten und zu der goldenen Schicht wurden, die auf der Oberfläche trieb. Die Stimme schwoll an, drang in ihn ein, erfüllte ihn, hob ihn hoch – und zog ihn mit sich fort.
Chicago im Winter
»Wir hätten öfter herkommen sollen«, sagte Rose, »ich habe ganz vergessen, wie … wie besonders es hier ist.«
»Wenn wir begreifen, was uns wichtig ist im Leben, dann ist es meist zu spät.« Tess sah zum See hin, zu der weißen Eisfläche, die irgendwo in der Ferne unmerklich in den Himmel überging. Sie zog den Wintermantel enger um sich, die eiskalte Luft hier draußen auf der Veranda brannte ihr in der Kehle.
»Als deine Mutter und ich klein waren, haben wir geglaubt, auf der anderen Seite des Sees wäre der Rest der Welt. Europa und Russland und China …« Rose hob die Schultern unter ihrer lilafarbenen Wollstola mit den Goldfäden und ließ sie müde wieder fallen. »Was haben wir doch für seltsame Vorstellungen von der Welt, wenn wir jung sind …« Ein bitteres Lächeln flog über ihr Gesicht mit der kleinen Nase und den wachen braunen Augen.
Tess nickte nur. Sie konnte sich noch immer nicht daran gewöhnen, dass das große Haus mit dem riesigen Grundstück, das hinunterreichte bis zum Seeufer, jetzt, nachdem ihr Großvater gestorben war, zur Hälfte ihr gehörte. Er hatte es ihr und ihrer Tante Rose zu gleichen Teilen vermacht. Heute waren sie beide hergekommen, um den Nachlass durchzusehen und zu entscheiden, was sie davon behalten wollten und was weggegeben werden konnte.
Ihr Blick verlor sich in der Ferne. Aus dem weißen Nichts tauchte auf einmal eine Gestalt auf dem Eis auf, ein Mädchen mit einer weißen Wollmütze, unter der blonde Zöpfe hervorschauten. Es trug eine dicke weiße Daunenjacke und eine rote Strumpfhose, sodass es von Weitem aussah wie ein Storch, der mit staksigen Bewegungen versuchte, Pirouetten zu drehen. Ein hochgewachsener Mann mit schwarzer Wollkappe über den weißen Haaren, die Schultern leicht nach vorn gebeugt, feuerte das Mädchen vom Steg aus an.
»Kannst du auch rückwärts laufen, Tess?«
»Ich weiß nicht …!«, rief das Mädchen atemlos zurück.
»Es geht ganz leicht! Du musst es dir nur zutrauen!«
Das Mädchen zögerte kurz, dann drehte es sich vorsichtig um und begann, zuerst etwas wacklig, dann immer sicherer, Bögen zu laufen.
»Siehst du, du kannst es!«
Großvater und Enkelin, wie lange war das her?
Tess fühlte sich von einem seltsamen Sog erfasst. Wenn sie jetzt einfach losgehen würde, hinein in diese grenzenlose Weite, ohne Gepäck, ohne Erwartungen und ohne an den Rückweg zu denken … vollkommen frei … Wahrscheinlich würde sie erfrieren oder verhungern, außer … außer sie würde etwas entdecken, eine Hütte, einen Weg, ein Schiff, ein …
»Ich muss gerade daran denken, wie Dad letzte Weihnachten hier zusammen mit uns gestanden hat«, sagte Rose unvermittelt.
Tess erinnerte sich genau. Es war nicht kalt genug gewesen; auf dem See hatte sich nur eine dünne graue Eisschicht gebildet, unter der man die Fische schwimmen sehen konnte.
»Tja«, Rose schnäuzte sich leise in ihr Taschentuch, »wir wissen nie, wann es zu Ende ist, nicht wahr?« Sie zog die Wollstola enger um sich. »Ich geh wieder rein. Nicht dass ich noch eine Erkältung bekomme, die kann ich mir jetzt wirklich nicht leisten.«
»Ich komme gleich nach.«
Das Mädchen da draußen machte wieder eine Pirouette, es drehte sich schneller, immer schneller, bis es schließlich zu einem Windwirbel wurde und verschwand …
Warum war ihre Mutter so früh gestorben, warum hatte sie, Tess, ihren Vater nie kennengelernt? Sie hatte so viele Fragen. Jetzt war nur noch Rose da, die ihr Antworten geben konnte, aber ihre Tante war auffallend wortkarg, wenn es um die Vergangenheit ging. Tess atmete noch einmal die kalte Luft ein, dann ging auch sie hinein.
»Ich frage mich, was wir mit den ganzen Sachen machen sollen«, sagte Rose, und Tess folgte ihrem Blick, der über die alte Anrichte und die Vitrine glitt, auf der die Sammlung von Porzellanfiguren aufgereiht war, eine Leidenschaft ihrer Großmutter. Hier ein Figürchen aus China, da eines aus Nymphenburg, dort eines aus Meißen, hier ein filigraner Hirsch, da eine Frau mit Sonnenschirmchen – eine Miniaturwelt, in der es weder Alter noch Veränderung gab. Als die Demenz schon weit fortgeschritten war, hatte ihre Großmutter diese stummen und starren Figuren stundenlang betrachtet und sich leise mit ihnen unterhalten. Inzwischen lebte sie in einem Pflegeheim, eingesponnen in ihre eigene kleine Welt, zu der niemand einen Zugang fand. Als sie ihr die Nachricht von Großvaters Tod brachten, reagierte sie nicht einmal mehr.
Sanft strich Rose über die Wollpullis, die ihr Vater so gern getragen hatte. Sie hatten sie auf dem Esstisch gestapelt. Maggie, die frühere Haushaltshilfe, würde später vorbeikommen und sie abholen, um sie in die Kleidersammlung zu geben. »Ich weiß, er war älter, als die meisten Menschen werden, aber …« In ihrem Blick lag etwas Hoffnungsloses. »… aber er kam mir vor, als würde er niemals sterben.« Tränen traten ihr in die Augen, und sie wandte sich ab.
Tess verstand, was ihre Tante meinte. Die Gesundheit ihres Großvaters schien so stabil und zuverlässig zu sein wie die Fahrräder, die er über so viele Jahre in seiner Firma produziert hatte. Tess hatte schon als Kind immer das neueste Modell bekommen. Dann war sie mit ihrem Großvater durch die Gegend gefahren, vorbei an endlos sich ausdehnenden Getreidefeldern, an Silos und Farmhäusern. Sie liebte das Gefühl, nirgendwo ankommen, nirgendwo umkehren zu müssen. Ihr Großvater hatte immer Rundwege ausgesucht, und so hatte sie nie gemerkt, wann sie sich auf dem Rückweg befanden. Plötzlich standen sie wieder vor dem Haus am See.
Rose räusperte sich und drehte sich wieder um, ein gezwungenes Lächeln auf dem Gesicht. »Ich bin gespannt, ob Norman sich noch mal meldet.«
»Ganz bestimmt. Der gibt so schnell nicht auf.«
Das Grundstück mit dem Haus direkt am See war Millionen wert. Norman Cunningham, einer der erfolgreichsten Makler der Stadt, hatte Rose schon einen Tag nach der Beerdigung in ihrem Büro angerufen, sein Beileid ausgesprochen und viel zu beiläufig gefragt, was mit dem Haus geschehen werde. Tess und Rose waren sich jedoch schnell einig gewesen, dass sie sich nicht trennen wollten von diesem Haus, in dem sie beide, wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten, so viele Jahre verbracht hatten.
»Das fürchte ich auch.« Wahllos zog Rose eine Schublade des schweren Wohnzimmerschranks auf. »Willst du das Tafelsilber? Ich überlasse es dir gern.«
»Adrian wird sich freuen.« Tess lächelte ironisch. Wenn sie den alten Kasten schon nicht verkaufen wollten, könnte sie wenigstens das Tafelsilber mitbringen, hatte Adrian gestern Abend zu ihr gesagt.
Rose hob die fein gezupften Augenbrauen. »Höre ich da einen Unterton?«
Tess schüttelte den Kopf. »Wie kommst du denn darauf?« Adrian … Nein, sie würde ihrer Tante nichts von den Streitereien erzählen. Inzwischen entzündeten sich die hässlichen Auseinandersetzungen an unbedeutenden Kleinigkeiten, an einzelnen Worten, an einem falschen Ton. Rose würde Adrian verteidigen, ganz sicher, sie himmelte ihn geradezu an, vielleicht weil sie selbst gern einen Sohn oder wenigstens einen Schwiegersohn gehabt hätte.
Tess blickte zu dem düsteren Gemälde über der Anrichte. Es zeigte einen dunklen Waldweg, an dessen Rändern niedrige Büsche und ein paar Blumen wuchsen. Wie oft hatte sie als Kind dieses Bild betrachtet und ihren Großvater immer wieder gefragt, wohin der Weg führte. Das weißt nur du allein, hatte er geantwortet und geheimnisvoll gelächelt.
»Und was ist mit Phil? Vielleicht möchte er ja das Tafelsilber …«
Rose winkte ab. »Hör mir auf mit Phil! Jeden Tag hält er mir vor, dass ich für den Bürgermeisterposten kandidiere. Und immer diese ironischen Spitzen! Gestern hat er gesagt, er ist ganz beunruhigt, weil ihm das Gesicht auf den Plakaten irgendwie bekannt vorkommt, aber er kann sich beim besten Willen nicht mehr erinnern, zu wem es gehört.«
Tess lachte laut auf.
»Ich finde das überhaupt nicht witzig!«
Kopfschüttelnd wandte sie sich ab und betrachtete die gerahmten Fotos auf dem Kaminsims.
»Entschuldige.« Tess stellte sich neben sie und legte ihr den Arm um die Schulter.
Eine Zeit lang standen sie schweigend da und betrachteten die Fotos. Ihre Großmutter und ihr Großvater bei der Eröffnung seiner Firma 1967. Beide hatten so ernste Gesichter, als trauten sie der Zukunft noch nicht so recht.
Auf einem anderen war ihr Großvater allein, auf einem Rennrad. 1972 stand auf der Rückseite. Siegesgewiss lachte er in die Kamera. Selbst im Alter sah er noch attraktiv aus, mit seiner drahtigen Figur, den vollen, gewellten Haaren und dem sonnenverbrannten Gesicht. Die Narbe auf der Wange sah man kaum. Aber Tess konnte sich daran erinnern, wie sie sie als Kind ganz vorsichtig berühren durfte und dass sie wissen wollte, ob sie noch wehtat. Da hatte er lachend den Kopf geschüttelt und auf ihr Knie gezeigt, wo eine feine, leicht gebogene Linie verlief. Im Sommer war sie zu hastig die Treppe hinaufgelaufen und mit dem Knie auf die Kante einer Stufe geschlagen. Die da tut doch auch nicht mehr weh, oder?, hatte er gesagt.
Irgendwann nahm Rose eines der Fotos in die Hand. »Sieh mal. Mum hat deine Mutter und mich immer gleich angezogen, als ob wir Zwillinge wären. Dabei war Paula doch vier Jahre älter.«
Tess nickte. Wie oft hatte sie das Bild betrachtet! Rose und Paula. Ihre Tante und ihre Mutter. Beide Mädchen trugen einen dunkelblauen Faltenrock, eine weiße Bluse und hatten die gleiche Frisur: Eine große Spange hielt die blonden Haare aus der hohen Stirn.
Jedes Mal hatte Tess sich im Gesicht ihrer Mutter gesucht. Sie hatten die gleichen kastanienbraunen Augen, und ihr Haar hatte eine ähnliche Farbe. Das Blond ihrer Mutter war etwas heller, wegen der Sonne vielleicht, Tess’ Haar ging mehr ins Honigblonde. Ansonsten konnte Tess keine Ähnlichkeit entdecken. Ihre Mutter hatte ein ausgeprägtes Kinn, genau wie Tess’ Großmutter, und die Wangenknochen waren kräftiger und breiter. Man sieht deutlich, was für ein Dickkopf deine Mutter war, hatte es immer geheißen.
Tess hatte immer wieder versucht, aus den wenigen Details, in denen sie und ihre Mutter sich unterschieden, das Gesicht ihres Vaters aufzuspüren. Während die Haut ihrer Mutter schnell in der Sonne bräunte, war ihre empfindlich und reagierte sofort mit Sonnenbrand. War ihr Vater auch so hellhäutig? Und hatte sie die feinen Züge, den zurückhaltenden Blick und den manchmal ein wenig zu verschlossen wirkenden Mund auch von ihm? Nie hatte sie glauben können, dass angeblich kein Bild von ihrem Vater existierte.
Roses Mundwinkel zuckten, als wollte sie lächeln. »Weißt du, Tess, ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass deine Mutter und ich …«
Wieder die alten Geschichten: Früher waren wir unzertrennlich … wenn deine Mutter nur nicht so halsstarrig gewesen wäre …
»… früher waren wir unzertrennlich.« Rose schüttelte den Kopf. »Wenn deine Mutter nur nicht so halsstarrig gewesen wäre! Sie war ein furchtbarer Dickschädel.« Sie hielt Tess das Bild hin. »Nimm du’s. Ich hab genug andere.«
Tess wollte schon erwidern, dass auch sie genug Fotos besaß, aber sie schwieg. Manchmal hasste sie all die alten Bilder, die Fotoalben, die sie als Kind vor dem Schlafengehen so oft durchgeblättert hatte. Am nächsten Morgen hatte sie nur noch stärker gespürt, was sie verloren hatte. Wortlos nahm sie das Bild und legte es in den Karton zu den beiden Vasen aus blauem Muranoglas und dem »Sonnenanbeter«, einer kleinen Figur aus schwarzem Marmor, die im Arbeitszimmer ihres Großvaters auf der Fensterbank gestanden hatte.
Rose ging zu der schlichten Kommode neben dem Kamin und öffnete die oberste Schublade.
»Voll bis zum Rand.« Sie stöhnte auf. »Ich weiß gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen.« Sie nahm ein Buch heraus und schlug es auf. Ein Zettel fiel zu Boden.
»Ach, Rose, das bringt doch nichts. Wir müssen systematisch vorgehen, sonst werden wir nie fertig.«
Rose schien gar nicht zuzuhören. Sie hob den Zettel auf und musterte ihn, dann hielt sie ihn Tess hin. »Hier. Das scheint von deinem Großvater zu sein. Lies du, es ist in Deutsch, ich bin zu lange aus der Übung.«
Tess hatte mit ihren Großeltern oft deutsch gesprochen, und ihr Großvater hatte ihr schon früh deutsche Bücher zum Lesen gegeben. »Wenn deine Mutter sich nicht darum kümmert, dass du zweisprachig aufwächst, dann müssen wir es tun«, hatte er gesagt.
Tess nahm den Zettel. Er war schon ganz vergilbt. Von ihrem Großvater? Was sollte das sein? Ein Gedicht? Ihr Großvater hatte früher gedichtet? Sie überflog die handgeschriebenen Zeilen. Dann versuchte sie beim Lesen, den Text für Rose gleich zu übersetzen:
Ich bin der Mond
Fado, gib mir mein Leben wieder!
Ich höre und sehe nur nachts, denn ich bin der Mond
Wenn es dunkel ist und ich bin das einzige Licht
Ich bin der Mond
Fado, gib mir mein Leben wieder!
Nun also, kein Fado mehr
Ist das mein Leben, jetzt?
Was für ein Leben, ich frage dich?
Überall ist Licht, doch ich sehe nichts,
überall sind Menschen, doch ich verstehe sie nicht
Fado, gib mir mein Leben wieder!
Lieber den Schmerz und die Einsamkeit
Du hast mein Herz berührt
Fado, Fado, du erst
hast mir mein Leben gegeben,
meine Bestimmung, für die ich lebe –
und eines Tages sterbe.
LISSABON, 1940, HANS SCHEUGENPFLUG
»Oje, das klingt aber kitschig!«, sagte Rose und stöhnte. »Wir können froh sein, dass er nicht Dichter geworden ist, sondern Unternehmer. Mit diesem Kitsch hätte er es auch ganz bestimmt nicht in den Stadtrat geschafft.«
»Findest du es wirklich so kitschig?« Tess drehte den Zettel um, an dessen ausgefransten Rändern dunkle Flecken waren. »Ich finde es eigentlich ganz romantisch …«
»Romantisch?« Rose schüttelte den Kopf.
»Ja, er war doch sonst immer so … so nüchtern.«
Rose zuckte die Schultern. Ja, für Rose musste alles immer sachlich und ernst sein.
Auf der Rückseite standen, kaum noch lesbar, in einer fremden Sprache ein paar Notizen. Nur das Wort vinho konnte Tess entziffern. Das war doch Portugiesisch, oder?
»Hans Scheugenpflug«, las Tess noch einmal. »So hieß er doch früher …«
»Ja«, Rose nickte. »Das war sein ursprünglicher Name. Erst nach seiner Flucht aus Nazideutschland hat er sich Plough genannt.«
Tess überflog die Zeilen noch einmal. Ihr Großvater hatte sich damals, als er noch Hans Scheugenpflug hieß, wirklich als Dichter versucht! Sie konnte es kaum glauben.
Rose seufzte. »Trotzdem, es ist bestimmt bitter, wenn man sich eingestehen muss, dass man nicht gut genug ist.« Rose legte das Buch zurück und schloss die Schublade wieder.
»Hat er das selbst gesagt?«
Rose schüttelte den Kopf. »Er hat es irgendwann mal angedeutet. Aber ich hatte keine Ahnung, was er damit meinte. Vielleicht war es eine alte Wunde, etwas, woran man nicht rühren durfte …« Rose blickte auf den Zettel, den Tess immer noch in der Hand hielt. »Fado, ist das nicht irgendwas Portugiesisches? So was mit Sehnsucht und unerfüllter Liebe?« Sie verdrehte die Augen.
Tess nickte nur. Ein Bekannter von ihr war vor zwei Jahren in Portugal gewesen und hatte von dieser Musik geschwärmt. Sie treibe einem die Tränen in die Augen. Lissabon. Ausgerechnet.
»Kann ich den Zettel behalten?«, fragte sie.
»Natürlich.«
Tess legte ihn vorsichtig zu den anderen Sachen in ihrer Kiste.
»Ich glaube«, sagte sie, »Großvater war viel romantischer, als wir alle dachten. Wenn meine Mutter das gewusst hätte, hätte sie bestimmt ein anderes Bild von ihm gehabt, und sie hätten nicht so oft miteinander gestritten.« An die lautstarken Streits zwischen den beiden konnte sie sich noch gut erinnern, auch wenn sie erst dreizehn gewesen war.
»Warum hast du eigentlich nie Streit gehabt mit ihm, Rose?«
»Paula war oft unbesonnen, eine richtige Rebellin. Davon konnte es nur eine in der Familie geben. Ich musste mir eine andere Rolle suchen.«
»Die Besonnene, die Mustertochter, meinst du wohl.«
Über Roses Gesicht flog ein schmerzliches Lächeln. In diesem Augenblick klingelte ihr Handy, und Tess ging in die Küche. Es fiel ihr schwer, zu glauben, dass ihr Großvater früher gedichtet hatte. Er war doch immer so nüchtern gewesen, so klar und pragmatisch, später dann wortkarg und zurückgezogen, und Zärtlichkeiten zwischen ihren Großeltern hatte sie nie bemerkt. Aber was wusste sie denn schon von ihnen, was wusste man überhaupt von anderen Menschen? Was wusste sie von ihrer Mutter und ihrem Vater? Nein, nicht schon wieder dieses Thema, sie würde ihre Tante nicht länger um Anekdoten anbetteln, und ihre Großeltern konnte sie nun nicht mehr fragen.
Sie ließ Wasser in den Kocher laufen. In einer Blechdose fand sie mehrere Beutel Pfefferminztee.
»Machst du mir auch einen?« Rose kam herein. Sie nagte an der Unterlippe, und auf ihrer Stirn hatten sich tiefe Falten gebildet.
»Probleme?« Tess hängte die Teebeutel in zwei Becher und goss Wasser auf.
Rose antwortete nicht, sondern starrte auf die Mikrowelle, als wäre die ein Fernseher, in dem gerade Nachrichten liefen.
Gedankenversunken griff sie nach einem der Becher und zupfte am Faden des Beutels. Ihre perlmuttfarben lackierten Nägel waren makellos, der breite Goldring wirkte schlicht und dennoch auffallend, die perfekte Frau, dachte Tess und verglich sie mit ihrer Mutter, wieder einmal, die am liebsten verwaschene Jeans, bequeme Pullis und Ethnoschmuck getragen und sich nur ganz wenig geschminkt hatte. Wie wäre ihr Leben verlaufen, wenn sie Roses Tochter wäre?
»Leon Woolfe, den kennst du doch, oder?«, fragte Rose unvermittelt.
Tess nickte. Sie sah dessen feistes, selbstzufriedenes Gesicht vor sich. Ein unsympathischer Kerl. Woolfe war bei der letzten Bürgermeisterwahl nur knapp gescheitert. Gekränkt hatte er damals erklärt, er würde sich für immer aus der Politik zurückziehen.
»Er kandidiert wieder!« Rose zog den Teebeutel aus dem Becher und warf ihn in die Spüle. »Das ist einfach … einfach unerhört, unglaublich! Heimlich, still und leise hat er seine Kandidatur vorbereitet!« Auf Roses Gesicht flammten rote Flecken auf, ihre Lippen waren jetzt so dünn wie zwei Striche. Sie starrte in ihren Teebecher. Der Sieg, der Rose fast sicher war, geriet auf einmal in Gefahr. »Aber so leicht werde ich es diesem alten Widerling nicht machen …« Sie ging in der kleinen Küche auf und ab, nachdenklich nippte sie immer wieder an ihrem Tee. Auf einmal blieb sie stehen und sah zu Tess. »Sag mal, warum fliegst du nicht nach Lissabon und recherchierst ein bisschen in unserer Familiengeschichte?«
Tess schaute sie erstaunt an. Bevor sie etwas erwidern konnte, hob Rose die Hand. »Ich weiß, das wäre nicht leicht für dich. Lissabon, die Stadt, in der deine Mutter gestorben ist …« Sie sah aus dem Fenster, ihr Blick verlor sich im Nirgendwo.
»Ehrlich, ich weiß nicht …«
Rose wandte sich um. »Du könntest etwas für mich schreiben, eine kleine Familiengeschichte sozusagen, hm?«
Warum? Damit du Kapital schlagen kannst aus deiner Biografie, wenn du die Wahl gewonnen hast? Tochter eines aufrechten Flüchtlings aus Nazideutschland, der hier eine neue Heimat gefunden hat und der sich zu einem angesehenen Bürger hochgearbeitet hat … Tess überlegte, wie sie am besten den Vorschlag ablehnen könnte, ohne Rose zu verletzen. Der Tee schmeckte auf einmal schal, nach muffig riechendem Pflegeheim. Sie hatte vergessen, dass Pfefferminztee sie immer an die Besuche bei ihrer Großmutter erinnerte.
»Menschen brauchen Geschichten, aus denen sie Hoffnung schöpfen können für ihr eigenes Leben«, sagte Rose und sah wieder zum Fenster hinaus.
Sie müsste jetzt nur Ja sagen, und Rose würde wieder lächeln. Sie müsste jetzt nur Ja sagen, dann könnte sie beweisen, dass sie nicht kompliziert war, wie Adrian immer behauptete, dass sie sehr wohl in der Lage war, Verantwortung zu übernehmen und Erwartungen zu erfüllen. Sie sah auf die Uhr, sie hatten noch einiges zu tun, und sie wollte nicht zu spät nach Hause fahren.
»Ich weiß noch nicht, Rose.«
Es war Abend geworden, als sie endlich die persönlichen Sachen durchgesehen hatten. Sie luden die Kartons mit den Erinnerungsstücken, die sie behalten wollten, in ihre Autos und verabschiedeten sich. Rose schlug den Wollschal enger um den Hals, gab Tess einen Kuss auf die Wange und sah sie eindringlich an. Leise brummten die Motoren der beiden Geländewagen. Tess spürte, wie ihr die eisige Kälte durch den Mantel drang. Irgendetwas stand zwischen ihnen, das spürte sie, etwas Unausgesprochenes, etwas, an das sie beide nicht zu rühren wagten, wie ein alter Pfosten, den man nicht berührte, weil er längst morsch war, von dem man aber immer noch glaubte, dass er das Dach stützen würde.
»Eine Familie muss zusammenhalten, Tess«, sagte Rose eindringlich. »Darum habe ich mich immer bemüht, besonders als deine Mutter anfing, sich gegen alles und jeden aufzulehnen …«
»Ich weiß, Rose!« Tess hielt es nicht mehr aus, wie oft hatte sie sich diese Rechtfertigung, die zugleich Anschuldigung war, schon anhören müssen. »Tut mir leid, aber ich muss los, Adrian wartet.«
»Fahr vorsichtig!«, rief Rose, als Tess einstieg.
Bestimmt war ihre Tante jetzt enttäuscht. Im Rückspiegel sah Tess, wie sie im Schnee dastand und winkte, und sie dachte an die endlose weiße Eisfläche, über die sie laufen könnte, weg von allen Erinnerungen, weg von allen Verpflichtungen und Erwartungen der anderen.
Der See ist ein schwarzer Spiegel. Wie tausend Finger strecken Mangroven ihre Wurzeln in die unsichtbare Tiefe. Sie weiß, darin zu baden ist gefährlich, aber sie kann nicht anders. Ihr Körper ist schneeweiß, immer tiefer taucht sie ein. Ihre Füße versinken in klebrigem, weichem Schlamm, wie Schallwellen breiten sich Ringe um sie herum auf dem Wasser aus. Vorsichtig schwimmt sie ein paar Züge. Das Wasser ist genauso warm wie ihr Körper, sodass sie es gar nicht spürt. Als sie wieder hinaussteigt, läuft es nicht an ihr ab, es bleibt als gelblicher Schleim an ihr haften. Sie erschrickt, hastet unter eine Dusche, die plötzlich da ist, dreht das heiße Wasser auf und spült den Schleim ab. Erleichtert atmet sie auf. Aber als sie sich abtrocknet, bricht ihre Haut auf, in dicken Krusten fällt sie von ihr ab, sie will schreien, doch da entdeckt sie unter der abgebrochenen Kruste eine zarte weiße Haut.
Tess fuhr hoch. Sie brauchte ein paar Augenblicke, bis sie begriff, dass sie Tess Plough war, Journalistin im Ressort »Lifestyle und Reiseberichte« bei Women’s, verlobt mit Adrian Torrelli, der neben ihr lag und tief und fest schlief.
Gestern war er noch später nach Hause gekommen als sonst. Ein Meeting. Natürlich. Warum dachte sie so oft, dass er sie belog?
»Es ist nichts, Honey, das bildest du dir ein«, hatte er erwidert, als sie ihn einmal darauf ansprach, aber genau diese Antwort hatte sie noch mehr verunsichert.
Durch die Vorhänge fiel ein grauer Schimmer. Sie stand leise auf, tastete auf dem Boden nach ihren warmen Socken, schlich in ihr Arbeitszimmer und ließ sich in den Sessel fallen. Sie zog die Socken an, legte sich eine warme Decke über und sah durchs Fenster in die Nacht hinaus. Vom zehnten Stock aus wirkten die Häuserblocks gegenüber gar nicht mehr so hoch, und jetzt, mit den wenigen erleuchteten Fenstern und den Schneerändern auf den Vorsprüngen und Dächern sahen sie aus wie ein riesiger Adventskalender Anfang Dezember. Ihre Großmutter hatte ihr früher jedes Jahr einen Adventskalender geschenkt. Spätestens am zehnten Dezember hatte Tess alle Türchen geöffnet, die Schokolade gegessen und sie dann wieder verschlossen. Sie musste lächeln, als sie daran dachte, seltsam, woran wir uns erinnern.
Zwischen zwei Häuserblocks konnte sie ein kurzes Stück der Hochbahn erkennen, die sich wie eine Lichterkette von links nach rechts langsam bewegte. Wenn sie nicht schlafen konnte, saß sie oft da. Lautlos schwebten die Autos unter ihr vorbei, schalteten Ampeln um, gingen Lichter an und aus. Bis hier herauf, hinter ihre Glasscheibe, drangen keine Schreie, keine Flüche, keine Gerüche, und die wenigen Menschen waren von hier oben aus verschwindend klein. Alles schien nach irgendeinem Plan zu funktionieren, auf beruhigende Weise war es geordnet, wie in einem Spiel, in dem sich die Spieler an die Regeln hielten.
Sie schaltete das Licht an. Vor ihr auf dem Schreibtisch standen der Sonnenanbeter und das gerahmte Foto mit ihrer Mutter und ihrer Tante als Kinder. Auf der Unterlage lag der Fado-Text, Zeugnis eines ungelebten Traums, ein Stück Papier mit einer verblassenden Handschrift.
Dass ihr Großvater eine solche Begeisterung für den Fado entwickelt hatte … Später hatte er nie darüber gesprochen. Auch ihre Großmutter hatte das nie erwähnt, sie hatte gern Operetten und Opern gehört, aber Fado? Tess hatte ihr in den letzten Jahren immer wieder mal eine CD geschenkt, in der Hoffnung, die Musik würde ihr helfen, sich wieder an das Leben zu erinnern. Kurze Augenblicke lang hatte sich ein Hauch von kindlicher Überraschung und Freude auf das Gesicht ihrer Großmutter gelegt, als hätte Tess eine Spieldose geöffnet. Doch dann war es wieder in eine ängstliche Starre zurückgeglitten. Ihr Großvater hatte nur selten Musik gehört, sie schien ihn nicht zu interessieren, vielleicht hätte sie zu viele schmerzhafte Erinnerungen in ihm geweckt.
»Was machst du denn da?«
Sie fuhr herum. Adrian stand gähnend in der Tür, das weite, verwaschene T-Shirt mit der verblassten Schrift seiner Highschool, das er so liebte, über den Pyjamashorts. Schlank war er geworden. Als sie ihn kennengelernt hatte, war er kräftig gewesen und er hatte andauernd Hunger gehabt. Am liebsten aß er Hamburger und French Fries. Doch seit er Manager in einem expandierenden Sportunternehmen war, gab er sich bewusst sportlich und dynamisch. Tess war sich in letzter Zeit nicht sicher, ob ihr der alte Adrian nicht lieber gewesen war, der, der sich nicht immer so glatt und weltgewandt gab.
Sie blickte wieder aus dem Fenster. »Ich weiß nicht, ob ich nach Lissabon fliegen soll.«
»Warum denn nicht? Soll eine interessante Stadt sein.«
Sie seufzte. »Meine Mutter ist in Lissabon gestorben«, erinnerte sie ihn.
»Aber das ist doch schon ziemlich lange her. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn du dich endlich mal damit auseinandersetzt.«
… wenn du dich endlich mal damit auseinandersetzt, wiederholte sie im Stillen.
Er gähnte wieder. »Außerdem könntest du dir einen Namen in der Redaktion machen.«
Sie blickte zu ihm. »Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte.«
Er hob die Augenbrauen und schob die Unterlippe vor, sie kannte seine Art, ihr zu demonstrieren, wie einfach die Lösung wäre. Ja, für ihn war immer alles so viel einfacher als für sie.
»Warum besuchst du nicht mal wieder deine Großmutter und fragst sie?«
»Du weißt genau, dass man nicht mehr mit ihr reden kann. Außerdem fühle ich mich von Rose benutzt.«
»Was meinst du mit benutzt?«
»Sie will sich ein gutes Image verpassen, wenn sie die Wahl gewinnt. Und jetzt will sie die Geschichte ihrer Eltern dafür nutzen. Flucht aus Nazideutschland, du weißt schon. Ich soll an ihrer Legende basteln.«
Er lachte. »Tess, also wirklich, mach es doch nicht immer so kompliziert. Fahr einfach hin, und dann siehst du schon, wie es läuft …« Er verschränkte die Arme vor der Brust. »Und jetzt komm wieder ins Bett, es ist viel zu kalt hier. Außerdem müssen wir in drei Stunden aufstehen.«
»Ich kann jetzt nicht schlafen.«
Adrian stöhnte auf. »Was gibt es denn da zu grübeln, Tess? Lissabon … Jeder würde sich darauf freuen. Nur du nicht.«
»Du verstehst mich nicht.«
»Ach, Tess. Das ist wieder mal typisch für dich. Wenn es keine Probleme gibt, dann erfindest du welche.«
»Das ist nicht fair! Ich spüre, dass da ein Widerstand ist in mir, und du …«
»Widerstand! Tess, ich spüre jeden Morgen einen Widerstand, wenn ich aufstehen muss, und jeder in Chicago, der genauso wie ich im Stau steht oder der sich in eine verdammte U-Bahn quetscht, der spürt auch einen verdammten Widerstand, weil er nämlich viel lieber zu Hause in seinem Bett läge oder in Florida am Strand oder was weiß ich tun würde!« Er fuhr sich durchs Haar, er war ungeduldig, wollte ins Bett, und das machte sie wütend.
»Du brauchst nicht so oft verdammt zu sagen.«
»Ich kann so oft verdammt sagen, wie ich will!«
Seine Worte verhallten in der Stille. Was verbindet uns eigentlich miteinander?, fragte sie sich. Es ist aus, könnte sie sagen, jetzt, in diesem Augenblick, und sie wäre befreit, sie könnte ein neues Leben beginnen.
Verärgert winkte er ab. »Mach, was du willst, bleib hier und grübele darüber nach, von wem du dich benutzt fühlst. Und wenn du irgendwann anfängst, auch mich dazuzurechnen, dann …« Er setzte dieses falsche Lächeln auf, das sie nicht mochte. »Ich jedenfalls gehe jetzt ins Bett, ich brauche meinen Schlaf.« Er wandte sich um.
Halt, warte!, wollte sie rufen, wollte alles wiedergutmachen.
»Warum nimmst du mich nicht ernst?«
Langsam, sehr langsam drehte er sich wieder um.
»Tess, ich nehme dich ernst. So ernst, dass mir manchmal sogar das Lachen vergeht.« Er schüttelte den Kopf und ging zurück ins Schlafzimmer.
Sie hätte hinter ihm herlaufen können, sich weiter mit ihm streiten, endlos und um jedes Wort, bis einer von ihnen aufgab, erschöpft, wütend, frustriert.
Seine Worte hatten sie getroffen, und das Echo verhallte nicht.
Die Kälte kroch an ihr hoch, drang in sie ein, und sie stellte sich vor, wie es wäre, wenn sie jetzt einfach sitzen bliebe und wartete, bis sie erfroren war. Früher, als Kind, wenn ihre Mutter wieder einmal wegen irgendwelcher Reportagen unterwegs war oder wenn sie stundenlang in der Dunkelkammer ihre Filme entwickelte und abends ausging, hatte Tess oft in ihrem kalten Zimmer gesessen, auf dem Boden, und hatte versucht, die Luft anzuhalten. Wenn sie es lange genug schaffte, dann würde sie sterben, und dann würde ihre Mutter begreifen, wie allein sie sich oft gefühlt hatte, aber dann wäre es zu spät. Irgendwann hatte sie sich ins Bett gelegt oder vor den Fernseher gesetzt. Und wenn ihre Mutter dann zurückkehrte von einer ihrer Reisen, hatte sie ihr immer eine Überraschung mitgebracht: eine bestickte Tasche, einen Armreif, eine Schatulle … Tess hatte alles aufbewahrt.
Als sie spürte, dass sie zu zittern begann, stand sie auf, klappte die Couch hoch und nahm Laken und Decke aus dem Bettkasten. Sie legte sich hin, zog die Decke bis zum Kinn und starrte in das graue Viereck des Fensters.
Ihr Leben kam ihr so leer vor. Nur sie selbst würde es füllen können. Aber womit? Natürlich, es gab so vieles, was sie tun könnte, bewegende Reportagen schreiben, sich für soziale Projekte engagieren, heiraten, Kinder kriegen – aber immer, wenn sie sich für eine dieser Möglichkeiten entscheiden wollte, fanden sich plötzlich tausend Gründe, die dagegensprachen. Sie war wie gefangen in sich selbst, das spürte sie, aber sie wusste nicht, warum, und sie wusste nicht, wie sie sich befreien konnte. Von den wenigen hellen Fenstern im Haus auf der anderen Straßenseite wurde eines dunkel.
Vielleicht sollte sie wirklich ihre Großmutter besuchen, auch wenn sie sich sicher war, dass die sich an gar nichts mehr erinnern würde. Warum flog sie nicht einfach nach Lissabon? Nur weil ihre Mutter dort ums Leben gekommen war? Weil sie sich nicht einspannen lassen wollte von Rose? War das wirklich so wichtig? Suchte sie nicht schon wieder nach Gründen, keine Entscheidung zu treffen? Die Geschichte ihrer Großeltern war doch auch ohne diesen Hintergrund interessant. Vielleicht würde sie ja nach so vielen Jahren gar nichts mehr in Erfahrung bringen. Aber sie hätte es versucht. Sie hätte endlich eine Entscheidung getroffen. Und sie hätte Abstand zu Adrian und zu ihrem gewohnten Leben, sie könnte eine Lifestyle-Geschichte schreiben über die Lissabonner Szene. Ihre Gedanken woben immer längere Fäden, die sich schließlich hoffnungslos verhedderten.
Eleonore strich über ihr gewelltes weisses Haar. Sie stand im Bademantel am Fenster und blickte hinaus in die Schneelandschaft. Manchmal werden sie klar wie Glas, die Bilder aus ihrem Leben. So wie in diesem Augenblick: Zuerst sind sie schwarz-weiß, dann glimmen sie auf wie Kerzen und nehmen Farben an, Geräusche steigen auf, und dann beginnen die Menschen und die Autos, die Züge und die Tiere auf diesen Bildern sich zu regen, bis Eleonore schließlich sich selbst dort entdeckt.
Es schneit. Dicke Schneeflocken schweben vom Himmel wie weiche weiße Blütenblätter.
Aber wo ist der See vor dem Haus? Und überhaupt, ist das Zimmer nicht größer? Sie dreht sich um, blickt auf das schmale Bett, den Fernseher, die beiden Sessel am Tisch, auf dem eine Vase mit bunten Blumen steht. Irgendetwas stimmt nicht. Das Wohnzimmer war doch viel, viel größer. Natürlich! Es hatte sogar einen Kamin, sie erinnert sich an die gelben Flammen und an das knackende Holz. Und da war ein Schatten, nein, ein Mann, der sich hinkniete und Scheite nachlegte. Sie selbst hatte den Telefonhörer in der Hand. Eine Stimme sagte etwas Schreckliches, was, das hat sie vergessen. Plötzlich stand der Mann auf, wandte sich ihr zu, doch er hatte kein Gesicht, oder er hatte eines, aber sie konnte es nicht erkennen. Sie ließ den Hörer fallen.
Etwas zerreißt in ihrer Erinnerung. Ein Bild, ein Foto, sie will die beiden Teile wieder zusammenfügen, aber es will ihr nicht gelingen, so sehr sie sich auch anstrengt, die Teile stoßen nie exakt aneinander, immer klafft ein Spalt …
»Eleonore! Ist es nicht schön draußen?«
Die Bilder gefrieren, verstummen, verblassen, dann sind sie weg, hineingerutscht in den Spalt.
»Woran haben Sie gerade gedacht, Eleonore?« Der Engel ist ins Zimmer geflogen.
»An meine Tochter.« Im Echo ist es nur noch ein Laut. Dotter? Otter?
»An Rose oder an Paula?«
Sie will nett zu ihrem Engel sein, aber, um Himmels willen, wer ist Paula?
Eigenartig verworren ist alles in ihrem Kopf. Wie heißt sie? Paula? Anna? Teresa? Rosemary? Barbara? Eleonore sieht auf. Wer ist diese Frau? Ihr blondes Haar glänzt schön, gold, bronzegold, honiggold.
»Tess, Grandma, ich bin Tess, deine Enkelin«, sagt die Frau.
Ja, ja, Tess also, wem sie auch immer gehört, sie ist doch kein Hund? Ein Lichtblitz. Die schmutzigen Straßen und das singende Hündchen. Hat die Frau, diese Tess, nicht Lissabon gesagt?
»Du erinnerst dich doch noch an Lissabon, nicht wahr, Grandma?«
»Du musst das singende Hündchen sehen! Es sitzt auf einem kleinen Kästchen, wie auf einer Bühne, und der Mann hockt dahinter auf dem Boden und spielt Quetschkommode! Hahaha! Und das Hündchen so klein, hat ein rotes Halsband und ein Kleidchen fein und hebt das Schnäuzchen in die Luft, das Schwänzchen in die Höh’ und singt! Uuuh…!« Die Melodie hallt im Kopf, sie könnte sie singen …, aber diese Frau da mit dem bronzeblonden Haar sieht sie böse an.
»Grandma?«
»Ja, ja, ja, Paula …«
»Ich bin Tess. Paula ist tot.«
»Tot?« Tot, mausetot, mundtot?
»Ja, schon seit siebzehn Jahren. Ich bin ihre Tochter.«
»So so? Aha.« Wer ist sie? Die Tochter von wem? Was macht sie hier? Was macht diese Person hier? Sie will mich bestehlen!
»Gehen Sie! Sonst rufe ich den Abschleppwagen!«
»Beruhige dich doch, Grandma!«
»Fassen Sie mich nicht an, die Feuerwehr, es brennt, es brennt im Gebälk!«
Die Person zuckt zurück. Endlich, die Tür geht auf, und ihr Engel kommt! Ganz weiß leuchtet ihr Engel, seine Flügel hat er hinter dem Rücken versteckt, einmal hat sie sie gesehen, als Wölbung unter dem weißen Kleid.
»Eleonore, das ist doch Ihre Enkelin!« Die Stimme des Engels. Der Engel hat immer recht, der Engel ist immer ehrlich, er meint es gut mit ihr. Und manchmal bringt er Schokoladenpudding mit, direkt aus dem Himmel.
»Meine Enkelin?«
»Aber ja! Tess wollte Ihnen sagen, dass sie nach Lissabon fliegt, Sie erinnern sich doch noch, Eleonore, dass Sie mit Ihrem Mann damals eine Zeit lang dort waren?«
Die raue Wolldecke, der blinde Spiegel, oh ja, das weiß sie alles noch. Pfui, die Tauben. Aber was macht diese Person mit dem Goldhaar dort?
»Warum?«, bringt sie hervor.
Die Person kommt näher, beugt sich zu ihr, sie zuckt zurück. »Rose hat die Idee gehabt, ich könnte nach Lissabon reisen.«
»Rose, ach die!« Sind denn hier alle verrückt? Worum geht es eigentlich? Rose, den Namen haben sie hier schon mal gesagt, da ist sie sicher, todsicher. Sie hat Hunger. Lust auf Rotkraut, Rotbarsch, Rote Beete.
»Grandpa hat einen poetischen Text für ein Lied geschrieben, erinnerst du dich noch?«
»Poetisch … Er kann doch gar nicht pfeifen.« Sie muss nun doch kichern, obwohl der Engel und die Person sie so ernst ansehen. Hat sie was falsch gemacht? Dauernd macht sie was falsch. Verweise hagelt’s dann und Nachsitzen. Sitzen! Sechs!
»Erinnerst du dich noch an das Hotel in Lissabon, in dem ihr gewohnt habt?«, fragt die Goldhaarige.
»Gibt es da Rotkraut und Rotbarsch?«
»Grandma!« Finger umfassen ihr Handgelenk. »Bitte, das Hotel, die Pension in Lissabon … Weißt du noch den Namen?«
»Wenn Sie vorbeikommen, sagen Sie schöne Grüße!« Sie muss wieder kichern. »Warum schaut ihr so?«
Der Engel hebt die Augenbrauen, oh, sie hat ihn verärgert, das darf nicht sein. »Nicht böse sein, nicht böse sein, ich bin doch lieb, Schneeliebchen, Schneeröckchen …« Wie geht’s weiter? Dass sie so viel vergisst, aber es gibt ja auch so viele Dinge, alles steht voller Dinge hier, sie kann sich gar nicht bewegen, so voll steht alles.
»Wem, Grandma, wem soll ich Grüße ausrichten?«
»Liebe Grüße an alle! An den See und die Löwen und die Giraffen und die Affen und …« Sie lacht. All die bunten Tiere sind so lustig! »Aber nicht füttern, hören Sie, das ist verboten! Sonst droht die Todesstrafe!«
Tess strich ihrer Großmutter über das weiße Haar. Es war frisch gewaschen. In sanften Wellen umspielte es ihren Kopf, ließ ihr inzwischen so mageres Gesicht und das vorstehende spitze Kinn weicher erscheinen. Doch die beste Frisur und das teure violette Kleid mit dem dezenten Schal konnten nicht von ihrem Blick ablenken, der so oft umherirrte, bis er auf einmal in einer unsichtbaren Ferne auf etwas stieß, das er freudig oder ärgerlich erkannte. Binnen weniger Augenblicke konnte sich ihr Gesicht verfinstern, konnte sie die gerade noch fest umklammerte Tasse einfach fallen lassen oder in ein unverständliches Gemurmel verfallen. Seit einem Jahr lebte Eleonore nun hier, und jedes Mal, wenn sie zu Besuch kam, was nur selten vorkam, erschrak Tess aufs Neue über die fortschreitende Krankheit. Tess’ Namen hatte ihre Großmutter schon seit Monaten nicht mehr ausgesprochen, Tess war sich inzwischen sicher, dass sie nicht mehr existierte in Eleonores Welt. Eine bittere Erkenntnis, die es Tess nicht einfacher machte, sich zu einem Besuch aufzuraffen.