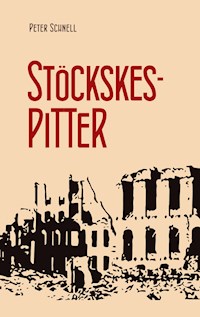
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Stöckskespitter, so nannten die Menschen im Barackenlager am Rande der Stadt den kleinen Jungen Peter, der im Sommer 1947 mit der Familie aus dem Osten kommend in die zerstörte Stadt Wuppertal einzog. Da er so gut wie kein Spielzeug besaß, schnitt er sich im angrenzenden Wäldchen einen Stock vom Baum, schnitzte schöne Muster in die Rinde und war den ganzen Tag mit diesem Stock unterwegs. Er lebte in diesen schlechten Zeiten ganz selbstverständlich mit Entbehrungen und lag, als er nach einem halben Jahr mit der Familie nach Wuppertal-Oberbarmen umzog, den ganzen Tag auf der Straße und spielte vornehmlich in Ruinen und Trümmern, während die Eltern auf der Jagd nach Lebensmitteln waren. Dennoch waren er und seine Spielkameraden mit ihrem Schicksal zufrieden. Sie waren Anpassungskünstler und Abenteurer zugleich. Sie kannten nichts anderes als das ganz einfache aber spannende Leben und machten aus allem das Beste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Weg vom Bahnhof Oberbarmen zum Barackenlager
Der Höfen und Umgebung
Peter Schnell bei BoD: „Gedankenstrich - zwischen Karriere und Ruhestand“, 2007 „Ameisen mögen keinen Fisch“, Roman, 2011
für Ronja, Feli und Junis
Inhalt
Vorwort
Vorwort zur zweiten Auflage
1947
Die Ankunft
Stöckskespitter
Feuer, Feuer!
Fringsen
Im Höfen
Dämmerstunden
Der Suchdienst vom Roten Kreuz
In dulci jubilo
1948
Handwerker im Haus
Hamstern bei Bauern und Verwandten
Der Abenteuerspielplatz Ruine
Collie, Eckstein und Overstolz
Ich wurde ein i-Dötzken
Die Maikäferplage
Christi Himmelfahrt in Beyenburg
Die Puddingschüsseln
Der alte Haarhaus
Gottesdienst und Christenlehre
Die Währungsreform
Mäten es en goden Mann
Der Traum vom brennenden Hund
Weihnachten und der Totschläger
1949
Wir fuhren Kette
Osterferien
Lederhose und Schuheisen
Im Geschwindigkeitsrausch
Mein Schwimmunterricht
Die Heimatkunde
Erotische Abenteuer
Der schlimme Fassadenparkour
Die Prügelstrafe
Seltener Streit
Der geheiligte Sonntag
Die Grippe
Ich wollte Ritter werden
Mecki
Sedan
Die Röntgenreihenuntersuchung
Die Bundesrepublik Deutschland
Wir ließen Drachen steigen
Die Misshandlungen im Hinterhaus
Der Advent
1950
Omma und Oppa
Meine Erstkommunion
Papas Geschäftswagen
Besuch in einem Wupperkotten
Ich wollte Förster werden
Tuffi
Der Pflaumenstein und seine Folgen
Das große Aufräumen in Oberbarmen
Schalksmühle
Der Straßenverkehr wuchs
Nick Knatterton
Der Waschtag
1951
Frohsinn: Wer soll das bezahlen?
Spannungen in der Schule
Die Rheinwanderung
1952
Papa ging zur Bahn
Auf dem Gymnasium
Schinkenhäger
Urlaub am Bodensee und Abschied von Oberbarmen
Dank
Vorwort
Im August 1947 stieg ich als Sechsjähriger zusammen mit meinem Bruder, der drei Jahre älter ist als ich, immer dicht an unsere Mutter gedrängt aus einem völlig überfüllten Zug, der aus Magdeburg kam und uns in Wuppertal-Oberbarmen absetzte. Wir sind da! Nehmt eure Sachen, wir steigen aus, sagte unsere Mutter. Ich war misstrauisch, denn die vergangenen zwei Jahre hatten wenig Gutes für mich bereitgehalten: Der Wegzug aus dem Erzgebirge, das wenig erfreuliche Jahr, das wir bei meinen Großeltern in Lauchhammer in der Niederlausitz verbracht hatten, das Verstecken vor den Russen bei unserer Ausreise in den Westen, die eher einer Flucht glich, und die zerbombten und verkohlten Städte und Bahnhöfe, die wir unterwegs sahen. Und nun landeten wir in dem vom Bombenhagel gezeichneten Wuppertal-Oberbarmen, betraten den stark beschädigten Bahnhof und starrten auf das zerstörte Postgebäude nebenan mit den verkohlten Wänden und den leeren Fensterhöhlen. Warum sollte mir ausgerechnet hier in diesem kaputten Stadtviertel Gutes widerfahren? Hier sollten wir ‚da sein‘? Obwohl ich nichts begriff, denn im Erzgebirge war der Krieg fast an uns vorbeigezogen, spürte ich, dass die Welt, die wir in den vergangenen Tagen durchschritten und durchfahren hatten, nicht gut war, dass die Umgebung, die wir gerade durchschritten, nicht gut war und es war für mich klar, dass das, was wir noch durchschreiten würden, auch nicht gut sein konnte. Damit die scheußlichen Eindrücke nicht zu tief in mein Herz eindringen konnten, flüchtete ich in Gedanken in die vergangene heile Welt, die ich noch kannte, und träumte von Schlettau im Erzgebirge, wo ich meine ersten Lebensjahre verbrachte, von unserem kleinen Häuschen dort, von dem vielen Schnee im Winter, von der ländlichen Idylle, den Weihnachtsbergen, Schwibbögen, Räuchermännchen und den vielen Kerzen zur Weihnachtszeit ...
Ich weiß, dass ich mich heute nicht objektiv in die damalige Situation hineindenken kann, weil ich heute, nachdem das alles vorbei ist, nicht mehr der bin, der ich damals war, als ich das alles erlebte, und ich heute in einer völlig anderen Welt lebe als in jenen Jahren und weiß, dass das Umfeld auch das eigene Denken beeinflusst. Und so kann ich nicht berichten, wie es objektiv war, sondern wie ich meine, es empfunden zu haben. Dennoch will ich versuchen, die Dinge, an die ich mich erinnern kann, zu schildern, weil sie zusammenhängend ein doch recht anschauliches Bild meiner Kindheit nach dem Kriege in einer zerbombten Großstadt ergeben.
Der Bahnhof Wuppertal-Oberbarmen Ende der 40er Jahre
Vorwort zur zweiten Auflage
Nachdem die erste Auflage 2015 erschienen war, fielen mir weitere Geschichten ein, die zum Bild der ausgehenden 40er Jahre einfach dazugehören. Ich wunderte mich im Nachhinein, warum mir diese Geschichten nicht schon früher eingefallen waren. Aber das Gehirn ist kompliziert. Es schüttete nach Veröffentlichung der ersten Auflage über einen längeren Zeitraum verstreut eine Begebenheit nach der anderen aus, ganz unverhofft bei Tag oder bei Nacht. Als schließlich die Quelle der Erinnerungen versiegte, beschloss ich, diese gesammelten nicht minder wichtigen Ereignisse in einer zweiten Auflage zu verarbeiten.
Bei dieser Gelegenheit beschloss ich auch, einige Fotografien einzubauen, die meine Geschwister und ich nach dem Tod meiner Mutter in den Alben meiner Eltern entdeckten. Dabei stellten wir fest, dass einige Begebenheiten zeitlich nicht ganz korrekt waren. So kündigte zum Beispiel mein Vater beim Bauunternehmer in Barmen erst 1952 und unsere Rheinwanderung fand nicht 1949 sondern 1951 statt. Neu geordnet wurden auch andere Geschichten.
Auch wenn diese Korrekturen den Gesamteindruck jener Jahre nicht verändern, so ist die zweite Auflage doch näher an die Realität herangerückt.
1947
... In wieviel Not
hat nicht der gnädige Gott
über dir Flügel gebreitet.
Die Ankunft
Auf dem Bahnhofsvorplatz von Wuppertal-Oberbarmen empfing uns eine brüllende Hitze. Wir hatten unsere Wintermäntel an, weil sie außer am eigenen Leib nirgends Platz gehabt hätten, und wir schwitzten erbärmlich. Papa wollte uns doch abholen, nörgelte ich. Es war aber kein Papa zu sehen. Ich muss erst mit Papa telefonieren, sagte meine Mutter. Also suchten wir die Post, die ganz sicher nicht mehr in der ausgebrannten Ruine zu finden war. Mama fragte sich durch und fand sie in der Nähe in einer Baracke. Mein Bruder und ich passten auf das Gepäck auf, während Mama telefonierte.
Papa war schon vor einem Jahr nach Wuppertal gekommen, weil unsere Familie sich dort, wo die gesamte Verwandtschaft meiner Mutter wohnte, eine neue Existenz aufbauen wollte. Mein Urgroßvater mütterlicherseits hatte neun Kinder, vier Söhne und fünf Töchter, die alle - einschließlich der meisten Nachkommen - in Barmen, Oberbarmen, Heckinghausen, Blombacherbach, Laaken und Beyenburg verstreut wohnten. Diese große Verwandtschaft war in den Nachkriegsjahren unser Rückhalt. Sie hielt zusammen und jeder half jedem. Der Zwillingsbruder meines Großvaters und seine Schwester waren früh gestorben, sodass von seiner Verwandtschaft nur noch sein Schwager und jeweils die Nachkommen in Barmen lebten. Mein Vater hatte als Bauingenieur auch gleich bei einem Bauunternehmer Arbeit gefunden. Er hatte für die Nachkriegszeit den idealen Beruf, denn Bauleute waren für den Wiederaufbau gefragte Menschen. Meine Mutter ist in Barmen auf dem Rott geboren und hatte ihre Kindheit auch dort verbracht, bevor unser Opa als Former und Gießer nach Lauchhammer in der Niederlausitz wechselte.
Papa wird bald dort drüben über die Werlebrücke kommen, erklärte sie uns, als sie vom Telefonieren zurückkam und deutete mit dem Finger auf eine stählerne Fachwerkbrücke hoch über den Gleisen. Wir warteten geduldig in der Hitze in unseren Wintermänteln, immer wieder die Fachwerkbrücke beobachtend. Ich quengelte. Ich weiß nicht mehr, wer ihn zuerst sah, mein Bruder oder ich. Wir schrien beide: Da kommt Papa! Mein Bruder und ich ließen das Gepäck stehen und stürmten einfach los, ohne Rücksicht auf unsere Mutter und auf unser Hab und Gut. Mir fiel ein Stein vom Herzen, ich war seit ewigen Zeiten wieder glücklich. Vielleicht wird ja nun doch alles gut, sagte ich mir. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wenn gar nichts mehr geht. Aber hier ging wieder etwas. Wir waren alle wieder beieinander, nach so langer Zeit. Wir rannten unseren Vater fast um, umarmten ihn und er uns und gingen mit ihm zurück zu unserer Mutter, die mit Tränen in den Augen unseren Vater, ihren Mann, in die Arme schloss. Von all dem, was sich meine Eltern zu erzählen hatten, weiß ich nichts mehr. Mich hatte das sicher auch nicht interessiert, ich war damit zufrieden, dass unser Papa wieder bei uns war. Und so marschierte ich mit meinen Eltern und meinem Bruder Richtung Lüttringhausen, zunächst der Wupper entlang, durch Rauental, entlang an roten Ziegelwänden vieler Industriebetriebe, über die Wupperbrücke hinüber auf die Lenneper Straße, die nicht aufhören wollte, nach Blombacher Bach, wo uns schon an der Kreuzung Blombacher Bach - Eschensiepen Onkel Hermann, ein Bruder unserer Oma, freudestrahlend entgegen kam. Mit ihm bogen wir gleich in die Straße Zu den Erbhöfen ein, wo er wohnte und wo Tante Mariechen, seine Frau, schon auf uns wartete. Onkel Hermann, ein geselliger Mensch, und Tante Mariechen, eine herzensgute Frau, hatte der Krieg einsam gemacht. Ihr jüngster Sohn war gefallen und der ältere befand sich in Kriegsgefangenschaft. Wenigstens war ihre Wohnung beim Bombenangriff auf Wuppertal nicht zerstört worden. Ich weiß nicht mehr, was wir bei diesem unserem ersten Besuch bei Onkel und Tante gegessen hatten, wahrscheinlich Waffeln mit Milchreis, eine bergische Spezialität, wie bei allen späteren Besuchen auch. Dass wir reichlich versorgt wurden, war bei den beiden Ehrensache.
Nach dem Besuch bei Onkel Hermann und Tante Mariechen wanderten wir weiter Richtung neue Heimat. Es ging auf der Landstraße Blombacher Bach ständig bergauf, an einer Stahlwarenfabrik, an den Orten Hammesberg und Kupferhammer vorbei bis Werbsiepen, bevor sich die Straße in einer scharfen Linkskurve und anschließend in einer Haarnadel-Rechtskurve weiter Richtung Lüttringhausen schlängelte. In Werbsiepen bogen wir links ab, in einen stillgelegten Steinbruch hinein. Dort standen aneinander gereiht rechts und links bis zu einer Felswand am Ende des Platzes viele Baracken und in einem von diesen provisorischen Häuschen wohnten Onkel Michel und Tante Anna, eine Schwester unserer Oma, die uns schon erwarteten. Sie besaßen, wie alle Familien im Barackenlager, eine Wohnung mit zwei Zimmern und nahmen uns, eine vierköpfige Familie, noch bei sich auf! Onkel Michel, weit in die siebzig Jahre alt, war ein freundlicher, aber meist ernster Mann und Tante Anna eine liebenswürdige Frau. Sie hatten ihre beiden Söhne im Krieg verloren und beim großen Bombenhagel auf Wuppertal wurden Onkel Michel und Tante Anna auch noch ausgebombt. Sie besaßen absolut nichts mehr, nur noch sich beide und wollten wenigstens vor dem Herrgott nicht mit leeren Händen dastehen. Sie lebten die christliche Nächstenliebe für uns Verwandte und für die Menschen im Barackenlager. Sie teilten alles mit uns, ihr Bett war ihre einzige Privatsphäre. Sie trugen ihren Schmerz nicht nach außen, ich habe ihn nie wahrgenommen, solange ich im Barackenlager bei ihnen gewohnt habe. Obwohl ich damals ihr trauriges Schicksal nur durch eine unscharfe kindliche Brille betrachtete, weil ich es emotional noch nicht nachvollziehen konnte, wäre mir nie in den Sinn gekommen, zu Tante Anna und Onkel Michel ein böses Wort zu sagen.
Zunächst hatten mein Bruder und ich nach der langen Zugfahrt und der ewig langen Wanderung verständlicherweise ganz andere Empfindungen: Wir waren froh, dass es einen Tisch, vier Hocker und ein Bett zum Schlafen gab und im Augenblick war uns das Bett zum Schlafen das Allerwichtigste.
Stöckskespitter
Unser Barackenlager war wie ein kleines Dorf ohne Kirche und Geschäfte, ein reines Wohndorf. Die Baracken standen zu beiden Seiten des Steinbruchgrundes, die einen am Rande der mit Bäumchen bewachsenen Böschung zur Straße hin, die anderen gegenüber an einer Felswand, die zum Ende hin immer höher wurde. In der Mitte des Platzes hatten die Dorfbewohner einen Garten angelegt, wo die Frauen Gemüse und Salat und die Männer Tabak anpflanzten. Auf mich wirkte diese Siedlung sehr heimelig. Jeder schien jeden bestens zu kennen. In den ersten Tagen im neuen Heim erkundeten wir Kinder erst einmal das Dorf und die Kinder des Dorfes. Es gab nicht viele Kinder. Ich erinnere mich hauptsächlich an Kika, die sehr lebhaft war und die mich von nun an mütterlich umsorgte, obwohl sie nicht älter war als ich. Es gab auch noch ältere Kinder im Dorf, die aber mit uns nicht spielten, weil wir denen zu klein und zu blöd waren. In der Nähe des Lagereingangs befand sich ein Brunnen. Wenn die Dorfbewohner Wasser brauchten, legten sie sich ein Schulterholz um Hals und Schulter, an dessen beiden Enden Ketten mit Eimern hingen. Am Brunnen wurden die Eimer nacheinander in den Brunnen hinabgelassen und mit Wasser gefüllt wieder heraufgezogen, an das Schulterholz gehängt und ins Dorf getragen.
Nach wenigen Tagen hatten wir uns im Barackendorf eingelebt. Wir wurden gut aufgenommen und jeder Erwachsene fühlte sich auch für uns Kinder verantwortlich. Es war erstaunlich, wie friedfertig das Leben im Dorf war. Die Menschen, die dort wohnten, hatten alle Schlimmes erlebt. Sie waren entweder ausgebombt, auf der Flucht gewesen und viele hatten wie Tante Anna und Onkel Michel Angehörige verloren. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass jemand für sich einen Vorteil auf Kosten anderer suchte. Vielleicht war nach alledem, was die Menschen erlebt und durchlebt hatten, die Sehnsucht nach Ruhe und Frieden so groß, dass sie diesen Frieden leben wollten.
Wir Kinder gingen oft zusammen in den Wald spielen, bauten aus Ästen und Laub Hütten, wohnten darin und beobachteten alles, was krabbelte, kroch oder flog. Auch suchte ich mir immer einen Stock, bearbeitete ihn gerne mit einem Messer, das mir die Spielkameraden ausliehen, schnitzte mir schöne Muster in die Rinde und ging mit meiner Errungenschaft im Dorf spazieren. Eigentlich hatte ich fast immer einen Stock bei mir, so dass mich ein älterer Mann von der Barackenreihe gegenüber „Stöckskespitter“ nannte. Kaum hatte sich der Spitzname herumgesprochen, riefen alle Kinder „Stöckskespitter, Stöckskespitter“ hinter mir her. Aber da ich ein ziemlicher ‚Dickkopp‘ war, beeindruckte mich das überhaupt nicht. Ich stand zu meinem Stock, mochten die anderen doch rufen, was sie wollten. Dieser Stock regte meine Fantasie an, ich fühlte mich stark und gut bewaffnet, obwohl mich niemand bedrohte.
Bei Kika war ich gut aufgehoben. Sie brachte mir alles Mögliche und Unmögliche bei, von dem sie meinte, dass ich es unbedingt wissen sollte. So gab sie sich alle Mühe, mir in den ersten Wochen meines Barackenlagerlebens die Kunst des Schuhezubindens beizubringen. Mir war ihre Hilfsbereitschaft manchmal lästig, denn es war doch viel bequemer, sich die Schuhe von Mama zubinden zu lassen. Aber Kika war energisch. Was sie sich in den Kopf gesetzt hatte, musste auch durchgezogen werden, so dass ich, ob ich wollte oder nicht, lernen musste, wie man einen Knoten und eine Schleife bindet und das auch noch unmittelbar hintereinander. Erstaunlich war, dass ich mir das alles gefallen ließ. Es lag sicher daran, dass sie trotz ihrer eisernen Zielstrebigkeit sehr liebevoll war. Ihre Charmeoffensive war mir offensichtlich den Schweiß harter Arbeit wert. Also übte ich und übte und meine Lehrerin Kika war erst zufrieden, als ich in der Abschlussprüfung vor ihren Augen meine Schuhe ganz allein zubinden konnte.
Wenn es Abend wurde und draußen etwas kühler als in den von der sengenden Sonne aufgeheizten Baracken, saßen und standen die Erwachsenen häufig vor ihren Türen zusammen und erzählten sich Geschichten und wir Kinder hörten ihnen aufmerksam zu. Die Männer rauchten dabei ihre selbst hergestellten Zigaretten. Auch mein Vater rauchte Zigaretten und ich hatte ihm oft zugeschaut, wie er die getrockneten Tabakblätter zusammenfaltete und zusammenrollte und mit einem selbstgebastelten Rasierklingenschneidegerät in feinste Streifen schnitt, diese in Zigarettenpapier einwickelte und stopfte. Jeder Mann im Lager hatte für die Zigarettenherstellung seine eigene Technik entwickelt. Das was die Menschen im Barackendorf im Krieg und danach erlebt hatten, gab Stoff genug, um Abend für Abend zu erzählen. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen das alles erzählen mussten. Vielleicht wollten sie sich auch ihren Kummer einfach vom Leib reden. Was sie erzählten, habe ich nicht alles verstanden, aber es war für mich sehr kurzweilig und allemal besser, als sich ‚zu Hause‘ in der Baracke zu langweilen. Und sie erzählten, bis es dunkel wurde. Dann rief uns Mama ins Haus, weil wir zu Abend essen und dann ins Bett mussten. Die Bewohner nutzten auch die Zusammenkünfte, um sich gegenseitig zu informieren, wo es was zu kaufen gäbe oder wo man sich was ‚beschaffen‘ könne. Solche Neuigkeiten gingen auch tagsüber wie ein Lauffeuer im Barackendorf um.
Unterhalb des Steinbruchs, wenige hundert Meter die Straße hinunter, konnten sich die Bewohner des Barackenlagers in einer Bäckerei und einem Lädchen mit dem Lebensnotwendigsten eindecken, wenn es überhaupt etwas gab. Meistens bekamen wir nur gelbes Maisbrot auf Lebensmittelkarten. Ich erinnere mich noch genau, dass es dort häufig muffig roch. Muffiges Brot war für mich das Abscheulichste, was wir essen mussten und ich habe den Geruch noch heute in der Nase. Das wenige Brot, das wir bekamen, wurde von unserer Mutter für uns vier Personen und zwei Mahlzeiten pro Tag eingeteilt. Den Belag darauf zelebrierte sie vor unser aller Augen. Sie nahm eine Scheibe Brot, bestrich sie dünn mit Margarine, hielt die Scheibe schräg und ließ von einem Löffel Zucker über die Brotscheibe rieseln. Das was hängenblieb war dann unser Brotbelag. Vom Garten in der Mitte des Lagers gab es immer mal wieder Gemüse und vom Hamstern ganz kleine Kartöffelchen, die Mama in der Pfanne zu ‚Pellemännekes‘ briet. Mit dem Zweitberuf ‚Hamsterer‘ besorgten sich meine Eltern und die anderen Dorfbewohner das Allerwichtigste, was man zum Überleben brauchte, weil es in den Geschäften häufig nichts gab, nicht einmal muffiges Brot. Da nützten auch die Lebensmittelkarten nichts. Meine Eltern packten gehäkelte Deckchen, Litzen, Bänder, die in Barmen hergestellt wurden, in den Rucksack und fuhren in völlig überfüllten Zügen aufs Land. Die Menschen saßen dicht gedrängt oder standen außen auf den Trittbrettern, lagen sogar auf den Dächern oder balancierten in ihrer Verzweiflung auf den Puffern der Waggons. Meistens ging Mama während der Woche mit Onkel Willi zusammen hamstern, weil Papa arbeiten musste. Sie zogen von Bauernhof zu Bauernhof und erwarben und erbettelten dafür hauptsächlich Eier, Kartoffeln und Gemüse. Die Bauern hatten bei den Hamsterern einen schlechten Ruf. Meine Eltern schimpften über sie, weil sie einen längeren Arm als die Städter hatten, viel nahmen und wenig gaben. Ich war klug genug, meinen Eltern zu erklären, dass ich trotz des schlechten Rufes dieser Berufsgruppe einmal Bauer werden möchte, denn der saß offensichtlich an der Quelle und hatte alles, was man zum Leben brauchte.
Feuer, Feuer!
Der Sommer 1947 war extrem heiß und das Land ausgedörrt, weil es wochenlang nicht geregnet hatte. In den Baracken staute sich tagsüber die heiße Luft und wer konnte, floh ins Freie und dort in den Schatten. Graugrün waren die Baumkronen der Nadelbäume und braungrün die der Laubbäume. Die Beeren vertrockneten an den Sträuchern und die Böden waren staubig und die Luft flimmerte in der Mittagshitze. Und dann passierte das, was alle Menschen erstarren lässt: Ein Dorfbewohner kam ins Dorf gestürzt und schrie Feuer, Feuer, der Wald Richtung Lüttringhausen brennt! Wir Kinder sahen schon am Himmel den Rauch aufsteigen und liefen, was unsere Beine hergaben, um zu sehen was man nicht alle Tage sieht. Wir ahnten das Außergewöhnliche, die Abwechslung im Barackenlagerleben. Als wir am brennenden Wald ankamen, standen die vorderen Bäume bereits in Flammen. Das Feuer züngelte an den Stämmen empor und fraß sich durch das dürre Gras und das trockene Reisig auf dem ausgedörrten Boden immer weiter in den Wald hinein. Überall knackte und knisterte es im brennenden Wald und ein beißender und stinkender Qualm stieg uns in die Nasen und in den Hals, so dass wir uns beinahe die Lungen aus dem Leib husteten. In dem sich immer weiter ausbreitenden Flammenmeer explodierten Bäume, Baumkronen wurden vom Stamm abgerissen und schossen mit einer Stichflamme in die Luft, einen breiten Funkenregen versprühend, der in dem trockenen Gehölz neue Feuer entfachte. Wir Kinder starrten in das Inferno. Um uns herum wurde es immer heißer, Funken wurden von den vom Waldbrand erzeugten heißen Winden mitgerissen, fielen am Rande der Brandherde wieder zu Boden und drohten uns Löcher in die ärmliche Kleidung zu brennen. Wir wichen zurück und als die Feuerwehr anrückte, mussten wir auch unseren neuen Aussichtspunkt räumen, damit die Feuerwehrleute ungehindert den Brand löschen konnten. Wir beobachteten den Kampf des Wassers mit dem Feuer. Es zischte und qualmte, weißer Rauch vermischte sich mit schwarzem Rauch, mal ging das Feuer aus, dann loderte es wieder auf und schoss vermischt mit schwarzem Rauch in die Höhe, weit über die Baumkronen hinaus. Wir fragten uns, wer wohl von beiden siegen würde, das Feuer oder das Wasser und da wir das Ergebnis unbedingt erleben wollten, schauten wir den Naturgewalten zu, bis das Feuer nach einigen Stunden weitgehend eingekreist und schließlich gelöscht war. Der Anblick des abgebrannten, qualmenden Stück Waldes, der einsam übrig gebliebenen schwarzen Baumstümpfe und der Gestank nach Verbranntem waren für uns furchteinflößend. Nachdenklich und schweigend gingen wir ins Barackendorf zurück, wo das alltägliche Thema ‚Wo bekommt man was zu essen‘ vom aktuellen Thema ‚Waldbrand‘ vorübergehend beiseite geschoben wurde. Die Erwachsenen fragten sich, wie das Feuer überhaupt entstehen konnte. Zigarettenkippe, sagte der eine. Quatsch, kinn Mensch wirft ne Kippe wech. Dä Tabak weard gesammelt, sagte ein anderer. Vielleicht hat sich ja das Feuer selbst entzündet, meinte wieder ein anderer. Dat kann sin, do muss nur ne Glasscherbe römliegn und schon isset passiert, antwortete ein Experte für Brandursachen. Aber einig waren sich alle, dass die Feuerwehrleute eine gute Arbeit gemacht hatten. Die ham em Kriech gelernt, wie man dat Feuer löschen tut, meinte ein Dorfbewohner und alle nickten.
Fringsen
Als es Herbst und kälter wurde, sammelten wir Holz für den Winter. Holz gab es im Wäldchen oberhalb des Steinbruchs genug und es war wegen der großen Hitze sogar trocken. Aber es war mühselig, das Kleinholz zusammenzusammeln. Also beschlossen meine Eltern, einen Baum zu fällen und zu zerkleinern. Sie wussten, dass das verboten war, und deshalb mussten sie ihr Vorhaben in die Nacht verlegen. Als es dunkel wurde, stiegen sie den Hang hinauf und steuerten den bereits ausgewählten Baum an. Dann begannen Papa und Mama mit einer Blattsäge, Keilen und einer Axt den Baum umzulegen und als er sich langsam zu neigen begann, bemerkten sie, dass er sich auf die Elektrokabel, die das Barackenlager mit Strom versorgten, zubewegte. Mama und Papa bekamen einen Riesenschreck, sie wussten, dass ihnen eine harte Strafe wegen Diebstahls und Beschädigung einer öffentlichen Einrichtung drohte, falls ihre Baumfällaktion bekannt würde. Damals fackelte man mit Dieben und sonstigen Straftätern nicht lange, denn die Besatzer hatten alle Hände voll zu tun, um die Ordnung im Land aufrecht zu halten. Aber wenn das Lebensnotwendige fehlte, wurden Gesetze und Verordnungen häufig missachtet. Das Gewissen meiner Mutter war dennoch so rein, wie es reiner damals nicht hätte sein können, denn ihr zuständiger Bischof, Kardinal Frings aus Köln, hatte den Dieben von überlebenswichtigen Dingen schon im Voraus die Absolution erteilt. Daher hieß diese Art von Stehlen „Fringsen“ und führte zu keinen Punkten im himmlischen Flensburg. Und da meine Mutter eine tiefgläubige Katholikin war, lobte sie Gott und den Kardinal und freute sich auf das Holz für den Winter. Aber sie hatten das Holz ja noch nicht in der Hütte. Papa stützte den Baum, dass er nicht weiter fallen möge und Mama rannte ins Lager, um eine Wäscheleine zu holen. An den Tatort zurückgekehrt band sie einen Stein an ein Ende der Leine und warf ihn mit samt der Leine über einen Ast und dann nahmen meine Eltern, die Freizeit-Holzfäller vom Barackenlager, alle ihre Kräfte zusammen und zogen mit der Wäscheleine aus Leibeskräften den sich neigenden Baum vom Stromkabel weg. So schrappten der Baum ganz knapp am Kabel und meine Eltern an einer Katastrophe vorbei und mit dem fallenden Baum fiel ihnen auch noch ein riesiger Stein vom Herzen. Noch am Tatort zerlegten sie mit Axt und Blattsäge ihre Beute und stießen die Baumstücke den Abhang hinunter ins Barackendorf. Als es dämmerte war die grobe Arbeit getan, meine Eltern waren erleichtert und für den Winter war vorgesorgt. War es nicht wunderbar, dass es im Barackenlager nicht einen einzigen Denunzianten oder Erpresser gab, der meine Eltern ganz leicht in Schwierigkeiten hätte bringen können?
Im Hof des Barackenlagers wurden die Baumstücke klein gesägt. Dazu verwendete mein Vater wieder die große Blattsäge. Mein Bruder und ich mussten meinem Vater dabei helfen, was auch ganz einfach war, wenn man die Blattsäge nur zog und nicht versuchte zu drücken. Das fiel mir allerdings nicht leicht und so schimpfte mein Vater immer wieder, wenn ich drückte, sich die Säge dann festhakte und mein Vater vergebens an der Säge zog.





























