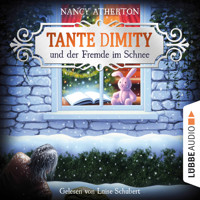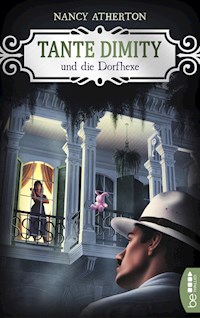5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
Nachdem Lori bei ihrem letzten Abenteuer nur knapp einem Mordanschlag entkommen ist, beschließt sie einen längeren Urlaub zu unternehmen und reist zusammen mit den Zwillingen nach Amerika. Eine idyllische Hütte in der Wildnis von Colorado scheint genau das Richtige zu sein, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Doch in dem alten Goldgräberdorf Bluebird gibt es ein 100 Jahre altes Geheimnis und einen Fluch, dem Lori mit Tante Dimitys Hilfe auf die Spur kommt ...
Ein charmanter Wohlfühlkrimi mit Tante Dimity. Jetzt als eBook bei beTHRILLED.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Carrie Vynes Calico Cookies.
"Auch der zwölfte Band glänzt durch Humor, liebenswürdig-schrullige Charaktere und Spannung, die bis zur letzten Seite aufrecht gehalten wird." Romantic Times Magazine
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Carrie Vynes Calico Cookies
Über dieses Buch
Nachdem Lori bei ihrem letzten Abenteuer nur knapp einem Mordanschlag entkommen ist, beschließt sie einen längeren Urlaub zu unternehmen und reist zusammen mit den Zwillingen nach Amerika. Eine idyllische Hütte in der Wildnis von Colorado scheint genau das Richtige zu sein, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Doch in dem alten Goldgräberdorf Bluebird gibt es ein 100 Jahre altes Geheimnis und einen Fluch, dem Lori mit Tante Dimitys Hilfe auf die Spur kommt …
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten „Tante Dimity“ Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Amerikanischen von Thomas Hag
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Alvaro Cabrera Jimenez | Montreeboy
Illustration: © Jerry LoFaro
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3503-3
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity Goes West« bei Penguin Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2007 by Nancy T. Atherton
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2008
by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für meine Freunde im Colorado Mountain Club,die mich zu ganz neuen Höhen geführt haben.
Kapitel 1
DONNER GROLLTE, UND Blitze zuckten durch den Himmel. Wütend warfen sich die Wellen gegen die Klippen, und der Regen peitschte auf mein Gesicht. Ich lag auf dem steinigen Boden, verletzt und hilflos. Über mir türmte sich eine Gestalt auf, ein dunkelhaariger Mann mit Augen, so schwarz und unergründlich wie der Höllenschlund. Er hob seine bleiche Hand und deutete auf mich. Ein Licht blitzte auf, dann eine gewaltige Explosion – und ich erwachte mit laut pochendem Herzen. Meine Bettdecke hatte sich in ein einziges wirres Knäuel verwandelt, das Kopfkissen war schweißnass. Ich schnappte nach Luft und starrte in die Dunkelheit.
Die Nacht war ruhig und friedlich. Eine leichte Sommerbrise wehte durch die geöffneten Schlafzimmerfenster, und im Garten zwitscherte ein früher Vogel, als wolle er allen und jedem mitteilen, dass er tatsächlich den Wurm gefangen hatte. Ich hörte keinen Donner, keine tosenden Wellen, und das einzig Helle am Himmel war ein trüber Grauschleier, der die Morgendämmerung ankündigte. Ich lag nicht am Rande einer sturmumtosten Klippe, einem kaltblütigen Mörder ausgeliefert. Ich war in Sicherheit, zu Hause.
Mein Ehemann räusperte sich, drehte sich zu mir und stützte sich auf den Ellbogen.
»Schon wieder?«, fragte er und strich mir zärtlich über den Rücken.
»Ja«, murmelte ich verzagt.
»Ich mache dir eine Tasse Tee.« Bill ließ sich auf sein Kissen fallen, rieb sich die müden Augen und schwang sich aus dem Bett. Schlaftrunken griff er nach seinem Morgenmantel.
»Du musst nicht«, sagte ich hastig. »Es geht mir gut, wirklich.«
»Eine feine Tasse Tee«, murmelte Bill. Er schlüpfte in seine ledernen Hausschuhe und ging leise auf den Flur hinaus.
Unser schwarzer Kater Stanley nutzte die geöffnete Tür sofort aus, wand sich an Bill vorbei ins Schlafzimmer und sprang mit einem eleganten Satz auf meinen Schoß, um sich eine morgendliche Streicheleinheit abzuholen. Er schnurrte sanft, als ich die empfindliche Stelle zwischen seinen Ohren kraulte. Das beruhigende Grummeln tat seine Wirkung, ich schloss die Augen und seufzte leise.
Sechs Wochen waren vergangen, seit ein verwirrter Fanatiker namens Abaddon auf mich geschossen hatte. Die Kugel hatte mich aus kürzester Entfernung knapp unterhalb des linken Schlüsselbeins getroffen, dabei eine Arterie erwischt und etliche Muskelfasern zerfetzt. Eine Armee von hervorragenden Ärzten hatte sich bemüht, die grässliche Wunde zu schließen, die Abaddon mir zugefügt hatte, aber bislang war es ihnen nicht gelungen, den Schaden zu beheben, den mein Seelenfrieden genommen hatte.
Seit anderthalb Monaten schwankte meine Stimmung wie ein außer Kontrolle geratenes Pendel hin und her, von apathisch zu ruhelos, von aufgekratzt zu larmoyant, ohne Sinn und Zweck, und das etwa fünfzig Mal am Tag. Der Schlaf brachte keine Erleichterung, denn mit ihm kamen die Albträume, oder in meinem Fall der Albtraum, in dem ich Nacht für Nacht den Schrecken durchlebte, der mich ins Mark getroffen hatte.
Verwunderlich war es weiß Gott nicht. Seit sieben Jahren hatten mein Mann und ich ein äußerst beschauliches Leben geführt, in einem gemütlichen, honigfarbenen Cottage inmitten der pittoresken, wie ein Flickenteppich geschnittenen Felder des ländlichen England. Obwohl wir Amerikaner sind, wurden wir schnell zu einem Teil des nahe gelegenen Dörfchens Finch. Unsere fünfjährigen Zwillinge hatten auf jedem Knie in Finch geschaukelt, Bill war Ehrenmitglied des Dartteams im Pub, ich fertigte die Blumenarrangements für die Kirche an, brachte den älteren Nachbarn einen Topf mit Schmorbraten vorbei und tratschte mittlerweile so fließend wie die Eingeborenen. Wir waren eine ganz normale Familie, die ihren alltäglichen Aktivitäten nachging, und niemand von uns war auch nur im Geringsten auf die schrecklichen Ereignisse vorbereitet, die meinen Albtraum ausgelöst hatten.
Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ein Wahnsinniger uns verfolgen und damit drohen würde, mich und meine Familie zu töten. Genauso wenig hätte ich mir träumen lassen, dass Bill mich und die Jungen zu unserem eigenen Schutz auf eine abgelegene schottische Insel schicken würde. Und ganz gewiss hätte ich mir niemals träumen lassen, dass Abaddon auf dieser Insel auftauchen würde. Er entführte meine Söhne und versuchte, mich inmitten eines Sturms der Stärke neun zu ermorden. An so etwas denkt man ja auch nicht, bis es einem dann passiert. Aber seit es geschehen war, träumte ich von nichts Anderem mehr.
Ich war es leid. Abaddon war dahingegangen, ein schicksalhafter Blitzschlag hatte ihn getroffen und ins wogende Meer geschleudert. Doch in mir lebte er weiter, ein lästiger Untermieter, der sich auch den hartnäckigsten Forderungen, er möge endlich ausziehen, widersetzte. Ich war verzweifelt, ich musste ihn loswerden, denn er verwandelte alles in ein riesiges Chaos, das langsam auf alle abfärbte, die ich liebte.
Meine lebhaften, robusten Söhne hatten das Zusammentreffen mit Abaddon unbeschadet überstanden, aber sie schlichen nur noch auf Zehenspitzen durch das Haus und sprachen mit unnatürlich gesenkter Stimme davon, dass »der böse Mann Mummy wehgetan hat«.
Annelise Sciaparelli, die unersetzliche Nanny der beiden, ging in meiner Gegenwart wie auf Eierschalen, da sie nie genau wusste, was ich im nächsten Augenblick tun würde, ob ich in Tränen ausbrechen, sie anfahren oder in stumpfem Schweigen dasitzen würde.
Mein Ehemann, ein hochbezahlter Anwalt mit einer gutbetuchten internationalen Klientel, hatte sich so viele Stunden freigenommen, dass einige seiner Mandanten sich wahrscheinlich fragten, ob er in den Ruhestand getreten oder gar gestorben sei. Ich selbst schlief so schlecht, dass ich keine Energie mehr besaß, für die Blumenarrangements zu sorgen, bei den greisen Nachbarn vorbeizuschauen und meinen Beitrag zu der großen Kette des Tratsches zu leisten, die alle in Finch verband. Nie mehr würde sich meine Welt ruhig um die eigene Achse drehen, bis ich mich ein für alle Mal von Abaddon befreit hatte. Aber ich wusste nicht, wie ich ihn loswerden konnte.
Stanleys sanftes Schnurren verwandelte sich in ein lautes Brummen, als Bill ins Schlafzimmer zurückkehrte, ein Silbertablett mit einer Tasse Tee in der Hand. Im Grunde war Stanley Bills Kater. Es gefiel ihm, dass Bill zu Hause blieb, um sich um mich zu kümmern. Meine andauernden Beschwerden waren in mancherlei Hinsicht das Beste, was Stanley passieren konnte.
Bill stellte das Tablett auf meinem Nachttisch ab und rieb sich die Augen. Ich starrte auf die dampfende Tasse, und Schuldgefühle senkten sich auf mich herab wie ein bleierner Umhang. Mein Mann war Mitte dreißig, er war aufgeschlossen und attraktiv und extrem gut in seinem Job. Die halbe Nacht hatte er vor seinem Computer gesessen, und nun brachte er mir Tee, während der Morgen dämmerte. Es war nicht gerecht. Er sollte die europäische Zweigstelle der angesehenen Anwaltskanzlei seiner Familie führen und nicht den Krankenpfleger für seine indisponierte Frau spielen.
»Hast du was dagegen, wenn ich noch eine Mütze Schlaf nehme?«, fragte er gähnend.
»Koste es aus«, antwortete ich. »Nimm zwei.«
Bill kroch ins Bett zurück, und Stanley verließ meinen Schoß, um sich an Bills Kniekehlen zu schmiegen. In der Stille trank ich meinen Tee und raffte mich dann auf, ins Bad zu gehen, um mich für einen neuen Tag zu rüsten. Er würde hektisch werden, denn heute fand die Parade statt.
Die Parade, Bill hatte sie so getauft, war das, was eine enge Gemeinschaft aufführt, wenn einem der ihren ein Missgeschick widerfahren ist. Da mein Missgeschick ein besonders spektakuläres gewesen war, war unsere Parade zu einem wichtigen gesellschaftlichen Ereignis geworden. Niemand wollte von einem Geschehen ausgeschlossen sein, das für Schlagzeilen in der Times würdig befunden worden war. Einmal in der Woche – sonntags – riss der Strom der Nachbarn vor unserer Türschwelle nicht ab, die Geschenke brachten und sich im Widerschein meines unfreiwilligen Ruhmes sonnten.
»Und heute ist Sonntag«, murmelte ich und schloss die Badezimmertür. »Dusche, Frühstück, Kirche und los geht die Show.«
Als ich fertig war, waren auch Will und Rob bereits wach, und als Annelise und ich sie angezogen hatten, war auch Bill wieder aufgestanden, und wir machten uns geschlossen auf in die Küche, um ein herzhaftes Frühstück einzunehmen. Wir räumten den Tisch gerade ab, als es an der Haustür klingelte. Annelise brachte die Jungen rasch in den Garten – sie überdrehten am Tag der Parade regelmäßig – und Bill machte die Tür auf.
»Wer war das?«, fragte ich, als er in die Küche zurückkam.
»Terry Edmonds«, antwortete Bill.
Ich wollte gerade einen Teller in den Geschirrspüler tun. Nun sah ich ihn verblüfft an. Terry Edmonds war kein Nachbar. Er war ein Kurier, der des Öfteren juristische Dokumente für Bills Firma abholte oder brachte.
»Seit wann arbeitet Terry sonntags?«, fragte ich.
»Eine Eilsendung«, sagte Bill. »Ich gehe ins Arbeitszimmer.«
»Er hat sie hierher gebracht?« Wieder dieses Schuldgefühl. Bill arbeitete in einem hochmodernen Büro am Dorfplatz, aber er hatte es nicht mehr betreten, seit ich angeschossen worden war. »Bill, wenn du dich nicht bald wieder an die Arbeit machst, wirst du die Adresse auf deinem Briefkopf ändern müssen.«
»Alles zu seiner Zeit, meine Liebe«, sagte er.
Ich drehte mich zu ihm herum.
»Sieh nur«, sagte ich und dehnte vorsichtig meinen Arm. »Ich bin so gut wie neu. Du musst nicht den Engel der Schwächlichen spielen.«
»Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich den Eindruck, dass du mich loswerden willst«, meinte Bill nachsichtig.
»Aber ich versuche dich loszuwerden«, gab ich zurück. »Du kannst nicht die Nacht durcharbeiten und dich den ganzen Tag um mich kümmern. Irgendwann wirst du krank, und was dann? Es ist bereits Mitte Juni, Bill, du musst langsam wieder dein normales Arbeitspensum erreichen. Annelise und ich kümmern uns um die Jungen, und ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich brauche keinen Babysitter mehr. Ich bin durchaus in der Lage ...«
»... pünktlich zur Kirche zu kommen«, unterbrach mich Bill. »Was wir nicht schaffen werden, wenn wir noch weiter trödeln.«
Ich lächelte grimmig, klappte die Tür des Geschirrspülers zu und rief Annelise und die Jungen aus dem Garten herein.
Die Parade begann eine Stunde nach unserer Rückkehr von der Kirche. Für den Rest des Tages läutete die Haustürklingel fast ununterbrochen.
Sally Pyne, die füllige und auf angenehme Weise redselige Besitzerin der Teestube, brachte einen Korb vorbei, der mit ihren köstlichen Crazy Quilt Cookies gefüllt war, in denen alle möglichen Zutaten steckten außer Kokosnuss, weil Sally wusste, dass ich Kokosnuss nicht mochte. Die gebieterische Peggy Taxman, die Finch mit eiserner Hand und einer Stimme regierte, die durch Granit dringen konnte, hatte aus ihrem Kolonialwarenladen eine Tüte mit Bonbons für Rob und Will mit dabei, nicht ohne eine strenge Lektion in Sachen Mundpflege. Miranda Morrow, die rothaarige Berufshexe, überreichte uns ein unbeschriftetes Paket mit Heilkräutern, und Dick Peacock, der rundliche, joviale Kneipenwirt, schenkte uns drei Flaschen seines hausgemachten Weins. Da Dicks Wein bekanntermaßen ungenießbar war und Mirandas Kräuter höchstwahrscheinlich illegal, spülte Bill beides die Toilette hinunter, nachdem alle gegangen waren.
Ruth und Louise Pym, die beiden uralten Zwillingsschwestern, die in unserer Straße wohnten, lieferten Blumen und Gemüse aus ihrem Garten. Mr Malvern, der benachbarte Milchbauer, versorgte uns mit Milch, Sahne, Butter und Käse. Mr Barlow, der Mann für alles, brachte nur sein Werkzeug mit, dafür reparierte er die Hintertür, die immer klemmte. Lilian Bunting, die Frau des Vikars, füllte meinen Eisschrank mit Eintöpfen, Braten und Suppen, derweil der Vikar einen ganzen Armvoll Bücher heranschleppte, aus denen man in schwierigen Zeiten Trost ziehen konnte.
Mein Lieblingsteil der Parade kam erst, wenn der Ansturm vorüber war und meine beste Freundin Emma Harris auf eine Tasse Tee und einen kleinen Plausch vorbeischaute. Selbst sie fühlte sich bemüßigt, nicht ohne ein paar Gläser ihrer selbstgemachten Marmelade zu erscheinen. Niemand kam, ohne etwas mitzubringen. Seit wir aus Schottland zurückgekehrt waren, hatte ich weder kochen noch backen noch einkaufen müssen.
»Wenn ich nicht bald bessere Laune kriege, ruiniere ich noch das ganze Dorf«, sagte ich düster.
Die Parade war vorbei, ebenso wie das Dinner. Annelise hatte die Jungen nach oben gebracht, um sie zu baden. Ich hatte meine Hilfe angeboten, aber Bill hatte darauf bestanden, dass ich mich nach dem anstrengenden Tag erst einmal ausruhte. Deshalb hatte ich mich mit meinem Mann und Stanley auf das Sofa im Wohnzimmer zurückgezogen, wo wir an den Crazy Quilt Cookies knabberten, die Füße – und Pfoten – hochlegten und versonnen ins Kaminfeuer schauten.
»Es handelt sich nicht einfach um schlechte Laune«, meinte Bill, »sondern um ein posttraumatisches Stresssyndrom. Das ist nicht etwas, was man hat oder nicht. Man muss sich davon erholen.«
»Aber ich erhole mich nicht«, klagte ich. »In den vergangenen Wochen habe ich alles Mögliche versucht, Beratungsgespräche, Psychotherapie, den Vikar, Tabletten, Meditation, Hypnotherapie ...«
»... sowie Aromatherapie, Massage, Hydrotherapie und Akupunktur«, ergänzte Bill.
»Und nichts hat geholfen«, schloss ich.
»Wenn ich so dumm wäre, deinen Zorn auf mich zu lenken«, sagte Bill nach einer kleinen Pause, »würde ich darauf hinweisen, dass du nichts davon lange genug ausprobiert hast, um zu wissen, ob es funktionieren könnte oder nicht. Aber so dumm bin ich nicht.«
Ich nickte beschämt und nahm den Treffer hin. »Geduld war noch nie meine Stärke. Momentan scheine ich allerdings überhaupt keine Stärken mehr zu haben. Ich weiß einfach nicht mehr weiter.«
»Das macht nichts«, meinte Bill. »Aber ich.« Er lächelte geheimnisvoll und schob Stanley von seinem Schoß, erhob sich und verließ das Wohnzimmer. Als er zurückkehrte, hielt er etwas hinter seinem Rücken verborgen. Er ging so um das Sofa herum, dass ich nicht sehen konnte, was er in der Hand hielt. Er hockte sich vor den Sofatisch und sah mich an. Dabei erinnerte er mich an die Zwillinge, die mich immer dann genau so ansahen, wenn sie etwas ganz Besonderes ausgeheckt hatten.
»Was führst du im Schilde?«, fragte ich skeptisch.
»Du weißt doch, dass Terry Edmonds heute Morgen etwas abgeliefert hat«, begann er. »Es war für dich, ich hatte es gestern bestellt.«
»Ein Gehirn«, sagte ich. »Du rätst mir zu einer Hirntransplantation.«
»Falsch«, sagte er mit funkelnden Augen.
»Und«, fragte ich, »was ist es dann?«
Bis über beide Ohren grinsend, holte Bill die Überraschung hinter dem Rücken hervor. Es war ein großer, weißer Cowboyhut. Er setzte ihn mir auf den Kopf.
»Aufgesattelt, Ma’am«, sagte er gedehnt. »Der Wilde Westen ruft!«
Kapitel 2
»YIPPIE-YEAH!«, JUCHZTE BILL und schlug sich auf die Schenkel.
Stanley schoss erschrocken aus dem Zimmer. Ich war zu perplex, um auch nur eine Miene zu verziehen. Mein Ehemann hatte in Harvard studiert und gehörte zu einer der angesehensten Familien Bostons. Er sprach nicht wie ein Cowboy und klatschte sich auch nicht auf die Schenkel. Er war dem Wilden Western nie näher gekommen als bis Denver, wo er einmal an einem Juristenkongress teilgenommen hatte. Ich starrte ihn verblüfft an und fragte mich, was bloß in ihn gefahren sein mochte. Hatten ihm die Dämpfe von Dick Peacocks Wein das Hirn vernebelt? Hatte ihn der ganze Stress und die Sorge um mich in den Wahn getrieben? Oder war ich per Zufall in ein Paralleluniversum gerutscht?
Ich berührte die Spitze des Cowboyhuts, um mich zu überzeugen, dass ich nicht halluzinierte, und fragte ganz sachte: »Bill, wovon sprichst du?«
»Ich spreche von der einzigen Sache, die wir noch nicht ausprobiert haben«, antwortete er strahlend. »Ein Ortswechsel, und ich meine einen echten Ortswechsel.« Er deutete zum Erkerfenster des Cottage. »Auf nach Westen, junge Frau! Such dein Glück in der glorreichen, ungezähmten Wildnis der Berge von Colorado!«
»Schlägst du vor, dass wir nach Colorado reisen sollen?«, fragte ich entgeistert. »So wie in ... Colorado?«
»Das einzig Wahre!«, rief Bill fröhlich aus. »Finch bekommt dir nicht mehr. Hier ist alles zu vertraut. Du musst deine Batterien neu aufladen, am besten an einem Ort, an dem dich nichts an Finch erinnert. Und was könnte unserem allzu zahmen englischen Dörfchen weniger ähneln als eine Blockhütte in der glorreichen, ungezähmten ...«
»Blockhütte?«, japste ich entsetzt.
»Du erinnerst dich doch an Danny Auerbach, den Baulöwen?« Bill sah meinen leeren Blick und fuhr rasch fort. »Ich habe in der Vergangenheit hin und wieder für ihn gearbeitet. Er hat sich vor ein paar Jahren eine Berghütte bauen lassen und sie mir schon ein Dutzend Mal angeboten. Jetzt habe ich ihn beim Wort genommen.«
»Du hast eine Holzhütte gekauft?« Mir wurde schwindelig. »In Colorado?«
»Nicht gekauft, nur ausgeliehen«, erklärte Bill. »Danny lässt nur Freunde dort wohnen. Die Hütte liegt in der Nähe einer kleinen Bergstadt ...«
»Aspen?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Nein.« Bills Antwort ließ meine Träume zerstieben. »Danny macht sich nichts aus Aspen – zu teuer und zugebaut, sagt er –, deshalb hat er die Hütte in der Nähe von Bluebird gebaut, auf einem Stück Land, das sich schon seit Ewigkeiten in Familienbesitz befindet. Durch die Nähe zu der kleinen Stadt fühlt man sich nicht allzu isoliert, aber man ist weit genug von den Lichtern der Großstadt entfernt, um ein Gefühl für ... die Weite zu bekommen.«
»Die Weite«, echote ich.
»Genau das brauchst du, Lori«, sagte Bill. »Und genau das findest du in unserer gemütlichen kleinen Welt nicht.«
Mir fiel nichts anderes ein, als ihn anzustarren. Offenbar hatte er vergessen, wie sehr ich diese gemütliche kleine Welt liebte. Finch war im Grunde ein verschlafenes Nest, das auf vielen Landkarten nicht einmal verzeichnet war, aber hier fand das wahre Leben mit seinen kleinen Dramen statt, und ich war Teil dieser Aufführungen. Würde der Vikar die Traditionen über Bord werfen und eine Rockband für das Kirchenfest engagieren? Würde Sally Pyne ihren glänzenden purpurfarbenen Jogginganzug bei der Blumenausstellung tragen? Würde die übermächtige Peggy Taxman ihr Imperium ausdehnen und den Gemüseladen übernehmen, nun, da sich der alte Mr Farnham zur Ruhe gesetzt hatte? Aufregung gab es hier genügend, und der Gedanke, auch nur einen Tag voller süffigem Klatsch zu verpassen, hatte mir noch nie behagt.
Aber selbst davon abgesehen bezweifelte ich, dass es richtig war, Finch zu verlassen und ans andere Ende der Welt in eine Blockhütte zu fliehen. Das Cottage war unser Heim. Wenn ich es verließ, wenn auch nur für eine Weile, bedeutete das die Kapitulation vor dem Teufel mit den schwarzen Augen, der sich in meine Träume geschlichen hatte.
»Ich weiß nicht, Bill«, sagte ich. »Es kommt mir irgendwie feige vor, so als ließen wir uns von Abaddon aus unserem Dorf vertreiben.«
Bill schüttelte den Kopf. »Unsinn. Wenn du nach Colorado gehst, zeigst du, dass du dich von Abaddon unabhängig machst. Du zeigst damit, dass du dich nicht für den Rest deines Lebens in ein Schneckenhaus verkriechst, weil ein Verrückter dich in seinen Bann gezogen hat. Ergreife die Initiative!« Er legte die Hand auf mein Knie und fügte mit ernster Miene hinzu: »Ich habe gesehen, wie du dich Peggy Taxman widersetzt hast – mit lauter Stimme und vor Zeugen. Du bist kein Feigling, Lori.«
»Was ist mit den Jungen?«, sagte ich unsicher. »Wir reißen sie aus ihrer gewohnten Umgebung.«
»Natürlich«, stimmte Bill zu. »Aber glaubst du, das macht ihnen auch nur das Mindeste aus? Wir haben Mitte Juni, Lori, die schönste Zeit, um die Rocky Mountains zu besuchen. Die Jungs können wandern und Forellen angeln, sie können Fossilien suchen und in den Bächen nach Gold schürfen. Wenn sie Glück haben, sehen sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Elch, einen Büffel oder ein Langhornschaf. Es gibt sogar eine Ranch in der Nähe, wo sie reiten können, unter der Obhut von echten Cowboys.« Bill wurde ganz enthusiastisch. »Wenn sie im Herbst wieder zur Schule gehen, werden sie ihren Freunden einiges zu erzählen haben.«
»Ich weiß nicht, ob Annelise ...«, begann ich, aber Bill schnitt mir einfach das Wort ab.
»Auch für Annelise wird es ein großartiges Erlebnis werden«, behauptete er. »Sie war zwar schon mit uns in Amerika, aber weiter als bis Boston ist sie nie gekommen. Sie wird ganz wild auf die Rockies sein.«
Ich lehnte mich zurück, verschränkte die Arme und sah Bill nachdenklich an. Er gab sich verdächtig viel Mühe, den Eindruck zu erwecken, als sei sein Plan ohne jeden Makel. Aber mein weiblicher Instinkt sagte mir, dass er eine wichtige Information bislang zurückgehalten hatte.
»Also gut«, sagte ich. »Wo ist der Haken?«
»Der Haken?«, wiederholte Bill mit unschuldigen Augen. »Warum glaubst du, dass es einen Haken gibt?«
»Weil du um mich herumspringst wie ein durchgedrehter Cheerleader, deshalb.« Ich hob die Hand. »Also, raus mit der Sprache, Bill. Was musst du mir noch verraten?«
»Nun ja, jetzt, da du es ansprichst, es gibt tatsächlich einen kleinen Haken.« Bill räusperte sich und richtete die Schultern auf. »Ich kann nicht mitkommen.«
»Was ...?« Ich bekam den Mund gar nicht mehr zu. »Bist du wahnsinnig? Erwartest du ernsthaft, dass ich mich der glorreichen, ungezähmten Wildnis ohne dich stelle?«
»Es tut mir leid, Lori, aber es geht nicht anders.« Seine Schultern sackten wieder herab, und er ließ den Kopf hängen, als habe er gerade ein Footballspiel verloren. »Du hast ja schon beim Frühstück darauf hingewiesen, ich muss mich unbedingt wieder mehr meiner Arbeit widmen. Es hat sich einiges aufgetürmt, Dinge, die ich nicht an unser Londoner Büro weiterreichen kann. Es gibt mindestens sieben Klienten, um die ich mich persönlich kümmern muss, sonst verlieren wir sie. Du weißt, dass ich mitkommen würde, wenn ich könnte ...«
Der Satz endete in einem langen Seufzer, der mich auf den Boden der Tatsachen zurückbrachte. Bill hatte sich seit Wochen nur noch um mich gekümmert. Niemals hatte er die Geduld oder seinen Humor verloren, und kein einziges Wort der Klage war über seine Lippen gekommen. Nun hatte er eine wunderbare Reise für mich geplant, wobei es ihm nur um mein Wohlergehen ging, und alles, was mir einfiel, war zu jammern, weil er nicht mitkam. Ein drückendes Schuldgefühl lastete auf meinem Gewissen.
»Bist du deshalb gestern Nacht so lange aufgeblieben?« Ich fuhr mit dem Finger die Krempe des Cowboyhuts entlang. »Hast du vor dem Computer gesessen und diese Reise geplant?«
»Ja«, antwortete Bill, ohne mich anzusehen.
»Nun denn«, sagte ich leise. »Ich werde dich höllisch vermissen, aber abgesehen davon ist es eine glänzende Idee.«
Bill hob den Kopf. »Glaubst du wirklich?«
»Wie du gesagt hast, es ist das Einzige, was wir noch nicht ausprobiert haben.« Ich zuckte mit den Schultern. »Und wer weiß? Vielleicht funktioniert es ja.«
»Das wird es«, bekräftigte Bill. »Da bin ich ganz sicher.«
Ich wischte ein paar Katzenhaare vom Sofa. »Ich muss es sofort Stanley erzählen. Er wird entzückt sein, dich ganz allein für sich zu haben. Und du musst mich auf dem Laufenden halten, während ich fort bin.«
»Du bist die Erste, die es erfährt, wenn Sally Pyne bei der Blumenausstellung ihren entsetzlichen Jogginganzug trägt«, versprach Bill mit der Hand auf dem Herzen.
Er nahm den Hut von meinem Kopf und legte ihn auf dem Couchtisch ab, bevor er sich neben mich setzte und mich in seine Arme nahm. Ich schmiegte mich so fest an ihn, wie es meine Schulter zuließ.
»Es ist lange her, seit ich Ferien in den Staaten gemacht habe«, meinte ich.
»Du musst keinen Finger krümmen«, sagte Bill. »Ich habe alles arrangiert, Flugzeugtickets, einen Mietwagen, einen Fahrer ...«
»Wozu brauchen wir einen Fahrer?«, fragte ich und rückte etwas von ihm ab. Ich wusste, was mein Gatte von meinen Fahrkünsten hielt, teilte seine Meinung jedoch keineswegs.
»Dein Arm fühlt sich vielleicht besser an, aber du kannst ihn noch immer nicht vollständig bewegen«, erklärte Bill sanft. »Gebirgsstraßen sind noch nichts für dich.«
»Vielleicht nicht«, musste ich eingestehen. »Aber was ist mit Annelise? Sie kann doch fahren.«
»Annelise ist Engländerin«, erinnerte er mich. »Möchtest du wirklich, dass sie euch auf der falschen Straßenseite durch Haarnadelkurven manövriert?« Er schüttelte den Kopf. »Sicherlich nicht. Ich habe den Hausmeister der Blockhütte verpflichtet, sich um euch zu kümmern. Er heißt James Blackwell und wohnt auf dem Grundstück, also kennt er sich aus. Er wird euch am Flughafen abholen, fährt euch zur Hütte und fungiert während eures Aufenthalts als euer Chauffeur. Er ist sicher auch ein großartiger Fremdenführer, Lori, und er wird dafür sorgen, dass in der Blockhütte stets genügend Nahrung, Getränke und Feuerholz vorhanden sind.«
»Wie lange sollen wir denn bleiben?«, fragte ich.
»So lange du willst«, antwortete Bill. »Ich habe die Flugtickets offen gebucht und bei Danny nachgefragt – er hat nicht vor, in diesem Sommer in der Hütte zu wohnen, und es gibt auch keine anderen Anfragen.«
Ich fragte mich, warum die Blockhütte unter Dannys Freunden so unbeliebt war, beschloss aber, Bill nicht damit zu behelligen. Wenn sich die Behausung als einfache Holzbaracke mit Außenklo erweisen sollte, würde ich eben das Beste daraus machen. Ich wollte auf keinen Fall, dass das Lächeln vom Gesicht meines Mannes wich.
»Wow«, rief ich bewundernd. »Du hast wirklich an alles gedacht. Was hättest du getan, wenn ich nein gesagt hätte?«
»Ich hätte alles storniert und mir etwas anderes einfallen lassen.« Bill küsste mich auf die Stirn. »Eine Hirntransplantation vielleicht.«
»Ich wollte schon immer mal in einer Blockhütte wohnen«, versicherte ich hastig. »Wann geht es los?«
»Übermorgen«, sagte Bill.
Ich unterdrückte ein entrüstetes Schnauben. »Je eher, desto besser. Bluebird, Colorado, wir kommen!« Der Enthusiasmus fiel mir etwas schwer.
Kaum hatte ich den Satz beendet, als ein paar ohrenbetäubende Schreie aus dem Flur drangen.
»Wir fahren!«, jubilierte Rob.
»Wir fahren!«, jauchzte Will.
Unsere Söhne kamen im Schlafanzug ins Wohnzimmer gerannt und tänzelten vor dem Kamin auf und ab. Annelise folgte etwas gemesseneren Schrittes, aber auch sie strahlte. Ich schürzte die Lippen und betrachtete meinen Ehemann, dessen Blick sich an die Decke geheftet hatte.
»Du hättest sicherlich nicht Annelise, Rob und Will etwas von der Reise erzählt, bevor du mir den Vorschlag unterbreitet hast?«, fragte ich.
»Vielleicht sind mir ein paar Details herausgerutscht«, räumte Bill ein. »Unabsichtlich natürlich.«
Mein Blick wanderte zu Annelise. »Und du und die Jungs habt unser Gespräch auch sicherlich nicht belauscht?«
»Vielleicht haben wir das ein oder andere aufgeschnappt«, räumte sie ein. »Rein zufällig.«
»Wir fahren nach Colorado!«, rief Rob. »Wir suchen nach Gold!«
»Wir reiten mit Cowboys«, jauchzte Will. »Wir sehen Büffel.«
Es klang so, als seien Bill eine ganze Reihe von Details entschlüpft, aber das war mir egal. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann die Zwillinge das letzte Mal einen solchen Lärm gemacht hatten. Sie gingen nicht mehr auf Zehenspitzen, sondern hüpften herum wie wild, und auch ihre Stimmen waren alles andere als gedämpft. Annelises Augen leuchteten erwartungsvoll, und Bill strahlte wie der Weihnachtsmann persönlich. Ihre Freude war so ansteckend, dass ich das Gefühl hatte, als würde nun alles gut werden.
Ich hätte es besser wissen müssen.
Kapitel 3
WIR BEENDETEN DIE abendliche Feier mit einer Marathonlesung von Cowboy Bill, die komplette Serie, und brachten Rob und Will endlich ins Bett. Annelise zog sich umgehend in ihr Zimmer zurück, und Bill schleppte sich ins Schlafzimmer, auf dem Fuße gefolgt von Stanley, um zumindest einen Teil des Schlafes nachzuholen, den er in der letzten Nacht verpasst hatte.
Ich blieb bei ihm, bis er eingenickt war, dann schlich ich mich auf leisen Sohlen aus dem Schlafzimmer die Treppe hinunter ins Arbeitszimmer. Es hätte keinen Sinn gehabt, wenn ich mich auch ins Bett gelegt hätte. Ohne mein kleines nächtliches Privatgespräch mit Tante Dimity hätte ich doch nicht schlafen können.
Etwas anderes als ein Privatgespräch hätte ich mit Tante Dimity auch gar nicht führen können. Um Missverständnissen vorzubeugen, ich hätte mich nicht geschämt, mit ihr gesehen zu werden. Sie war die intelligenteste, gutherzigste und mutigste Frau, die ich kannte, aber eine Tatsache konnte man einfach nicht leugnen: Sie lebte nicht mehr, im engeren Sinne.
Sie war nicht einmal meine Tante. Dimity Westwood war Engländerin, und sie war einmal die beste Freundin meiner Mutter gewesen. Die beiden Frauen hatten sich während des Zweiten Weltkriegs in London kennengelernt, wo sie ihren Ländern dienten. Nach dem Ende des Krieges kehrte meine Mutter in die Staaten zurück, aber sie hielten ihre Freundschaft aufrecht und schickten einander Hunderte von Briefen über den Atlantik.
Diese Briefe bedeuteten meiner Mutter unendlich viel. Nach dem Tod meines Vaters hatte sie mich allein großgezogen, während sie weiterhin als Lehrerin arbeitete. Ihr Leben war oft nicht einfach gewesen, aber die Korrespondenz mit Tante Dimity hatte ihr über die dunkelsten Stunden hinweggeholfen. Die Briefe, die sie schrieb und die sie erhielt, hellten ihr Leben auf, wenn sie das Gefühl hatte, die doppelte Last als Witwe und alleinerziehende Mutter nicht mehr ertragen zu können.
Diesen Zufluchtsort hielt meine Mutter streng geheim, selbst vor mir, ihrer einzigen Tochter. Kein Wort kam über ihre Lippen, was ihre alte Freundin und die Briefe betraf, die ihr so viel bedeuteten. Als Kind kannte ich Dimity Westwood nur als Tante Dimity, die beeindruckende Heldin einer Reihe von Gutenachtgeschichten, die meine Mutter mir erzählte.
Erst nachdem meine Mutter und Tante Dimity gestorben waren, erfuhr ich die ganze Wahrheit. Damals hinterließ Dimity mir ihr beträchtliches Vermögen, das honigfarbene Cottage, in dem sie aufgewachsen war, die kostbaren Briefe, die meine Mutter ihr geschickt hatte, und ein merkwürdiges, in blaues Leder gebundenes Tagebuch mit leeren Seiten. Erst durch dieses Buch lernte ich Dimity kennen, nicht als Heldin aus Gutenachtgeschichten, sondern als sehr reale, einige würden sagen, surreale Freundin.
Wann immer ich das Tagebuch aufschlug, erschien Dimitys Handschrift, altmodisch und gestochen scharf, so wie man es wohl in der Dorfschule gelehrt hatte, vor langer Zeit, als Mädchen noch Schürzenröcke trugen. Das erste Mal, als Dimity mich aus dem Jenseits begrüßte, wäre ich fast zur Salzsäule erstarrt, aber als sie den Namen meiner Mutter schrieb, merkte ich, dass Dimity es nur gut mit mir meinte. Inzwischen betrachte ich sie längst als meine Vertraute, und ich hoffe, dass der Tag niemals kommt, an dem die Seiten des Tagebuchs leer bleiben.
Im Arbeitszimmer war es etwas unordentlicher als sonst. Überall lagen Unterlagen herum, die eigentlich in Bills Büro gehörten. Ich legte sie zu akkuraten Stapeln zusammen, die ich neben seinem Laptop auf dem alten Eichenschreibtisch platzierte, der neben dem efeuverhangenen Fenster stand. Nachdem ich das Zimmer einigermaßen aufgeräumt hatte, begrüßte ich einen kleinen, rosafarbenen Plüschhasen namens Reginald, der die meiste Zeit damit verbrachte, es sich in einer besonderen Ecke in einem der Bücherregale des Arbeitszimmers bequem zu machen.
Die Vorstellung von einer erwachsenen Frau, die sich mit einem rosafarbenen Plüschhasen unterhält, mag den meisten Menschen absonderlich erscheinen, aber Reginald begleitete mich schon seit ewigen Zeiten. Fast vierzig Jahre lang hatte ich mit ihm Augenblicke der Freude und der Trauer geteilt, und ich hatte nicht die Absicht, damit aufzuhören.
»Hi, Reg«, sagte ich und strich über den verblassenden Saftfleck auf seiner Nase. »Hast du dir jemals vorgestellt, einen Cowboyhut zu tragen?«
Reginalds schwarze Knopfaugen funkelten auf eine Weise, die zu sagen schien, wenn auch nur mir, nein, etwas derartig Albernes habe er sich noch nie vorgestellt, aber wenn ich darauf bestehen würde, er wäre dabei.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte ich. »Ich glaube, es gibt für dich keinen in der passenden Größe.«
Reginalds Augen leuchteten vor Erleichterung auf. Ich zwickte ihn zärtlich in die langen Ohren, nahm das blaue Buch aus dem Regal und machte es mir in einem der wuchtigen Ledersessel vor dem Kamin bequem.
»Dimity?«, fragte ich und öffnete das Tagebuch. »Hast du ein bisschen Zeit?«
Lächelnd sah ich, wie sich die vertraute, altmodische Handschrift elegant über die Seite kräuselte.
Ich habe so viel Zeit, wie Du brauchst, meine Liebe. Wie fühlst Du Dich heute?
»Gut«, sagte ich, aber dann fiel mir ein, mit wem ich sprach, und ich verlängerte meine Antwort. »Also gut, ich bin heute Morgen wieder von dem Albtraum wach geworden, und ich hatte heute wegen der Parade nicht eine Minute Ruhe, und meine Schulter schmerzt etwas, aber abgesehen davon geht es mir wirklich ziemlich gut.« Mein Blick fiel auf den Laptop, und ich dachte daran, dass Bill die halbe Nacht verbracht hatte, um meine Reise bis ins letzte Detail zu planen. »Im Grund fühle ich mich so gut wie schon lange nicht mehr.«
Wunderbar! Was hat Dir denn so geholfen? Akupunktur? Meditation? Hydrotherapie? Oder hast Du wieder mal etwas ganz Neues ausprobiert?
»Etwas Neues«, bestätigte ich. »Was hältst du von Blockhütten?«
Über Blockhütten kann ich mir wirklich kein Urteil bilden. Warum fragst Du? Willst Du eine bauen, aus therapeutischen Gründen? Und wäre es nicht besser, mit etwas Kleinerem zu beginnen, mit einem Vogelhaus vielleicht oder einem Bücherregal? Man kann nie genug Bücherregale haben.
»Ich will keine Blockhütte bauen, ich will in einer wohnen«, sagte ich. »In Colorado.«
Du willst England verlassen und nach Amerika gehen? Ach du meine Güte! Hast Du es Bill erzählt?
»Es war Bills Idee«, entgegnete ich. »Er hält es für die einzige Kur, die mir noch helfen kann. Er ist überzeugt davon, dass ein radikaler Ortswechsel Abaddon austreiben wird, und deshalb schickt er mich, Annelise und die Zwillinge in eine Blockhütte in Colorado, während er hier die liegen gebliebene Arbeit erledigt. Bist du mal in Colorado gewesen?«
Nein. Es soll bergig sein.
»Das habe ich auch gehört. Ich kenne es auch nicht.« Dann fügte ich etwas hinzu, was mir weitaus größere Sorgen machte. »Ich bin in Chicago aufgewachsen, Dimity. Ich sehe mich nicht wirklich als Frau der Berge.«
Ich bezweifle stark, dass Du dort Holz hacken oder Wasser aus dem Bach holen musst. Du wirst auch keine wilden Tiere erlegen müssen, damit Ihr etwas auf dem Tisch habt, wenn es das ist, weswegen Du Dich sorgst. Bill würde Euch niemals an einen Ort schicken, an dem es nicht sämtliche Annehmlichkeiten des modernen Lebens gibt.
»Bill hat die Hütte noch nie gesehen«, sagte ich. »Sie gehört einem seiner Klienten, einem gewissen Danny Auerbach, der dort aber kaum zu wohnen scheint. Er verleiht die Hütte lieber an Freunde, aber in diesem Sommer hat sich niemand dort angemeldet – nicht ein einziger Gast!« Ich legte die Stirn in Falten. »Ich habe das komische Gefühl, dass irgendetwas mit dieser Hütte nicht stimmt, etwas, was die Leute abschreckt.«
Jetzt bleib mal auf dem Teppich, Lori. Bills Klienten sind durch die Bank reiche Leute, und die Reichen wohnen nicht in schäbigen Holzverschlägen. Ich bin sicher, dass es in der Blockhütte ganz entzückend ist.
»Dann gibt es bestimmt einen verrückten Nachbarn.« So leicht war ich nicht abzubringen. »Ein alter Gnom mit einer Schrotflinte und einem Hass auf Stadtmenschen.«
Hast Du mit Bill über Deine Befürchtungen gesprochen?
»Nein, und das werde ich auch nicht«, sagte ich rasch. »Das hier bleibt unter uns, Dimity. Und selbst wenn der Boden der Blockhütte aus gestampftem Lehm besteht und ein alter Zausel mit dem Finger am Abzug ein Haus weiter wohnt, ich werde Bill kein Sterbenswörtchen verraten. Er braucht unbedingt Ferien von seiner durchgeknallten Ehefrau, und ich werde dafür sorgen, dass er sie bekommt.«
Ich bin sicher, dass Bill es anders sieht, Lori.
»Aber ich sehe es so. Seit unserer Rückkehr aus Schottland ist Bill mir nicht mehr von der Seite gewichen. Jetzt werde ich ein Opfer bringen, und wenn das darin besteht, ein paar Wochen am Rande von Nirgendwo zu campieren, dann sei es so.«
Verzeih mir, Lori, aber ich hatte den Eindruck, als ginge es Dir besser. Habe ich Dich etwa missverstanden?
»Es geht mir auch besser«, bekräftigte ich. »Will und Rob sind vor Aufregung ganz aus dem Häuschen, Annelise kann es kaum erwarten, und Bill geht wie auf Wolken, seit ich seinem Plan zugestimmt habe.« Ich rümpfte die Nase. »Ich mache mir halt nur ein paar Sorgen, das ist alles.«
Es sähe Dir auch durchaus nicht ähnlich, wenn Du Dir keine Sorgen machen würdest, liebe Lori. Dennoch freue ich mich darüber, dass Bill sich so etwas Wunderbares ausgedacht hat. Die frische Bergluft wird Dir ungeheuer guttun. Aber wie ich schon sagte, ich war noch nie in den Rocky Mountains ...
»Das wird sich ändern, denn du kommst mit«, sagte ich. »Reginald übrigens auch. Es gibt Opfer, die ich einfach nicht bringen kann. Mich ohne dich und Reg der riesigen, rauen Wildnis zu stellen, das ist eines davon.«
Was für eine schöne Überraschung. Wir werden uns gemeinsam der Wildnis stellen, meine Liebe, aber meinst Du nicht auch, dass es heute schon recht spät geworden ist? Du brauchst Schlaf, denn morgen hast Du sicher eine Menge zu erledigen.
Als ich daran dachte, wie anstrengend es sein würde, alles einzupacken, was die Zwillinge und ich für einen Abenteuerurlaub mit offenem Ende brauchen würden, konnte ich kaum widersprechen.
»Du hast recht«, sagte ich. »Es ist Schlummerzeit. Danke fürs Zuhören, Dimity.«
Ich danke Dir, Lori, weil Du mir erlaubt hast zuzuhören. Schlaf gut.
»Ich werd’s versuchen«, sagte ich ohne allzu große Hoffnung.
Als die geschwungenen Linien der königsblauen Tinte auf dem Papier verblassten, klappte ich das Buch zu und sah zu Reginald hinauf.
»Tja, alter Cowboy«, sagte ich so gedehnt lässig, wie ich eben konnte, »ich hoffe nur, dass Buffalo Bill nicht zu viel von uns erwartet. Denn wenn ich für unser Essen auf die Jagd gehen müsste, würden wir wohl mächtig hungrig bleiben.«
Am nächsten Morgen schreckte ich bereits vor dem Sonnenaufgang aus dem Schlaf hoch, aber ich verschwendete nicht allzu viel Zeit damit, zitternd im Bett zu hocken, ich stand auf, zog mich an und ging nach unten, wo ich unsere Koffer hervorholte. Ich hatte gerade mal einen Reisebeutel aus der Abstellkammer geholt, als Bill auftauchte, mir den Beutel aus den Händen nahm und mich zum Frühstück in die Küche bugsierte.
Bald stellte sich heraus, dass Dimity und ich nicht die geringste Ahnung gehabt hatten, wie wenig Mühe mich diese Reise kosten sollte. Bill hatte versprochen, dass ich keinen Finger krumm machen musste, und dafür sorgte er auch. Ich durfte ihm und Annelise beim Packen zusehen, und sobald ich auch nur versuchte, heimlich ein Paar Socken in einen Koffer zu legen, verwiesen sie mich des Zimmers.
Da die Zwillinge und ich offensichtlich nicht gebraucht wurden, lud ich sie für eine Abschiedsfahrt durch Finch in den Landrover. Unsere abrupte, unangemeldete Flucht nach Schottland hatte die Gerüchteküche meiner Nachbarn ordentlich zum Dampfen gebracht, und ich wollte verhindern, dass unsere Reise nach Colorado eine weitere Welle wüster Spekulationen auslöste. Jeder sollte erfahren, dass meine Söhne und ich eine ganz normale Ferienreise machten und nicht vor einem gemeingefährlichen Irren flohen.
Die Dörfler, mit denen ich mich unterhielt, fanden Bills großen Plan durchaus ansprechend, bis auf ein Detail – das Ziel.
»Colorado?« Sally Pyne runzelte die Stirn, während sie uns einen Teller mit frischen Scones hinhielt. »Ist das nicht ein wenig zu rau und ländlich? Pflanzen mit spitzen Dornen, Vipern und so. Warum bitten Sie Bill nicht, Ihnen eine hübsche Frühstückspension in Cornwall zu buchen? Die Seeluft würde Ihnen guttun.«
»Die Rocky Mountains?«, sagte Mr Barlow und wischte sich das Getriebeöl von den Händen. »Ein Cousin von mir hat die Rockies mal besucht. Ist gleich am ersten Tag zusammengebrochen. Höhenkrankheit. Musste mit dem Hubschrauber ins Tal ausgeflogen werden. An Ihrer Stelle würde ich ein Hotel in Skegness buchen. Die Seeluft ist ein Wundermittel.«
»Amerika!«, donnerte Peggy Taxman und ließ ihre Registrierkasse zuschnappen. »Würde ich nicht besuchen, wenn mein Leben davon abhinge. Reklame, Fastfood, Gewalt und Pornografie, wohin man auch schaut. Blackpool würde Ihnen besser bekommen. Die Zwillinge könnten auf Eseln reiten, und nach ein oder zwei Wochen frischer Seeluft blühen Sie auf wie eine Rose.«
Nur der schüchterne George Wetherhead mit dem schütteren Haar und der leisen Stimme unterstützte meine Pläne voll und ganz, allerdings nur deshalb, weil er ein Eisenbahn-Fan war.
»Die Pikes Peak Cog Railway ist die höchste der Welt!«, rief er aus. »Die Aussicht vom Royal-George-Zug ist atemberaubend! Die Cripple-Creek- und die Victor-Schmalspurbahn verfügen über eine 0 – 4-0 Lokomotive! Oh, wie ich Sie beneide!«
Ich brachte es nicht übers Herz, ihm zu verraten, dass Fahrten mit historischen Eisenbahnen nicht auf unserem Programm standen. Auch den anderen wagte ich nicht zu widersprechen. Schließlich verliehen sie nur meinen eigenen Ängsten und Zweifeln Ausdruck.