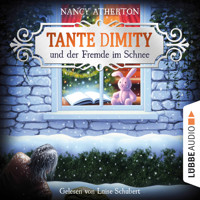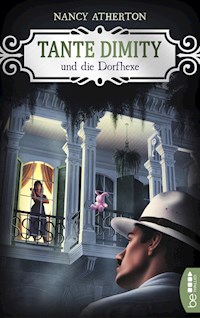5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
Als Lori und ihre Familie anonyme Morddrohungen erhalten, sucht sie mit den Zwillingen Zuflucht auf einer abgelegenen Insel vor der schottischen Küste. Dort findet sie Unterschlupf in der uralten Burg von Sir Percy Pelham, eines exzentrischen Adligen. Während ihr Ehemann Bill zuhause bleibt, um Scotland Yard bei den Ermittlungen zu unterstützen, muss auch Lori ein gefährliches Abenteuer bestehen. Auf der Insel Erinskil geht irgendetwas nicht mit rechten Dingen zu, und als Lori am Strand einen menschlichen Schädel findet, beginnt sie - zusammen mit dem Geist von Tante Dimity - zu ermitteln ...
Ein spannender Wohlfühlkrimi mit Tante Dimity. Jetzt als eBook bei beTHRILLED.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Sir Percys berühmter klebriger Zitronenkuchen.
"Nancy Atherton ist die erfrischendste und optimistischste neue Krimiautorin, die seit Jahren die Bücherregale schmückt." Murder Ink
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Epilog
Sir Percys berühmter klebriger Zitronenkuchen
Über dieses Buch
Als Lori und ihre Familie anonyme Morddrohungen erhalten, sucht sie mit den Zwillingen Zuflucht auf einer abgelegenen Insel vor der schottischen Küste. Dort findet sie Unterschlupf in der uralten Burg von Sir Percy Pelham, eines exzentrischen Adligen. Während ihr Ehemann Bill zuhause bleibt, um Scotland Yard bei den Ermittlungen zu unterstützen, muss auch Lori ein gefährliches Abenteuer bestehen. Auf der Insel Erinskil geht irgendetwas nicht mit rechten Dingen zu, und als Lori am Strand einen menschlichen Schädel findet, beginnt sie – zusammen mit dem Geist von Tante Dimity – zu ermitteln …
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten »Tante Dimity« Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Amerikanischen von Peter Pfaffinger
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Alvaro Cabrera Jimenez | Montreeboy
Illustration: © Jerry LoFaro
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3502-6
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity and the Deep Blue Sea« bei Penguin Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2006 by Nancy T. Atherton
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2008
by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für
Jim Hudson und Diane Martin,
zwei geliebte Kumpel
Kapitel 1
DER TAG WAR viel zu schön, um an Mord und Totschlag zu denken. Es war Ende April, und die milde Luft war durchdrungen von den Düften des Frühlings. Schlüsselblumen nickten anmutig in der Wiese, der Eichenwald war übersät von Glockenblumen, und das weiche Sonnenlicht übergoss unser honigfarbenes Cottage mit einem goldenen Glühen. Während ich im wadentiefen, wogenden Gras mit meinen fünfjährigen Söhnen Kricket spielte, lag mir daher nichts ferner als die Vorstellung, wir alle könnten von irgendeinem rachsüchtigen Verrückten in unseren Betten erdrosselt werden.
Ich benutze den Begriff »Kricket spielen« in einem sehr weiten Sinn. Auch wenn mein Mann und ich nun schon seit sieben Jahren in der Nähe von Finch lebten, einem kleinen Dorf in den Cotswolds im Herzen der englischen West Midlands, waren wir beide in Amerika geboren und aufgewachsen und hatten nie wirklich die Regeln dieses Sports erfasst, der für uns ein höchst sonderbares und fremdartiges Spiel darstellte. Unsere Zwillinge dagegen wuchsen in England auf – sie teilten die Vorlieben der Einheimischen. Und Kricket war nun mal der nationale Zeitvertreib. Während sie abwechselnd den Ball schleuderten und mit dem Schläger wegdroschen, taugte ich zu nichts anderem, als ihnen die Bälle zu bringen.
Soeben hatte ich ein triefendes Exemplar aus dem plätschernden Bach am Ende unserer Wiese geborgen, als ich meinen Mann aus dem Wintergarten treten sah, der an die Rückseite unseres Hauses grenzte. Will und Rob waren ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten – dunkelhaarig, braunäugig und dem Tempo nach zu urteilen, mit dem sie aus ihren Kleidern herauswuchsen, dazu bestimmt, seine stolze Höhe zu erreichen, wenn nicht sogar zu übertreffen. Ob sie Bill eines Tages ins Familienunternehmen nachfolgen oder es vorziehen würden, als Profigolfer Geld zu scheffeln, stand noch in den Sternen.
Bill war ein exklusiver und äußerst diskreter Anwalt, der den Großteil seiner Zeit damit verbrachte, für die richtig Wohlhabenden Testamente aufzusetzen. Er leitete die europäische Zweigstelle der ehrwürdigen Kanzlei seiner Familie von Finch aus, wo er ein Büro mit Blick auf den Dorfplatz hatte, doch seine Arbeit führte ihn oft weit weg von zu Hause. In den letzten drei Tagen war er in seinem Londoner Büro gewesen, und eigentlich hatte ich ihn erst übermorgen zurückerwartet. Da fragte ich mich natürlich, warum er schon so bald heimgekehrt war.
Stanley, unser frisch adoptierter schwarzer Kater, folgte ihm in den Garten, doch Bill bemerkte ihn offenbar nicht. Weder traf er Anstalten, sich zu bücken und Stanley über das glänzende Fell zu streichen, noch mich und die Jungs mit lautem Rufen zu begrüßen oder über die niedrige Mauer zu steigen und zu uns herüberzulaufen. Nein, er blieb einfach im Schatten des alten Apfelbaums stehen und schaute uns zu. Schweigend starrte er die Jungs einen langen Moment an, dann schaute er auf zu den bewaldeten Hügeln, die sich hinter der Wiese steil erhoben und fixierte den Bach. Als sein Blick endlich meinem begegnete, überlief mich ein derart heftiger Schauer der Angst, dass mir der nasse Ball aus den Fingern glitt. Mein Mann schien um mindestens zehn Jahre gealtert zu sein, seit wir uns vor ein paar Tagen voneinander verabschiedet hatten. Seine Schultern waren hochgezogen, das Gesicht war eingefallen und sein Mund zu einem schmalen Strich verkniffen. Als unsere Blicke sich ineinander verschränkten, sah ich in seinen Augen im Schatten von brennender Sorge jäh Zorn auflodern. Die Intensität seiner Emotionen traf mich wie ein Schlag ins Gesicht.
Ich muss nach Luft geschnappt haben, denn jetzt blickten auch Will und Rob zum Cottage hinüber und schrien wie aus einem Mund: »Daddy!« Mit einem Schlag war das Kricketspiel vergessen. Sie ließen Schläger und Ball fallen, jagten über die Wiese und sprangen über die Mauer in den Garten, wo sie zögerten und schließlich stocksteif stehen blieben, um unsicher zu ihrem Vater hochzuschielen. Als ich über die Mauer stolperte, wagten sie sich endlich näher und legten ihre Hände in die von Bill.
»Was hast du, Daddy?«, fragte Rob.
»Ist es ganz schlimm?«, erkundigte sich Will.
Bill ließ sich auf die Knie sinken und zog die Jungs zu sich heran. Dabei senkte er den Kopf und drückte die Augen fest zu, als hätte er Schmerzen. Als sich die Zwillinge befreien wollten, sog er mit bebenden Nasenflügeln die Luft ein und lockerte schließlich seinen Griff. Will und Rob wichen zurück und musterten ihn ängstlich.
»Ja, es ist schlimm«, antwortete er und sah von einem ernsten Gesicht zum anderen. »Aber es ist nichts, wovor ihr Angst zu haben braucht. Mummy und Daddy werden sich um alles kümmern.«
»Wir können helfen!«, riefen sie im Chor.
»Natürlich könnt ihr das.« Bill fuhr ihnen mit den Fingern durchs dunkle Haar. »Ihr könnt Mummy und mir helfen, indem ihr jetzt ins Cottage geht und genau das tut, was Annelise euch sagt.«
Annelise Sciaparelli war unser wunderbares Kindermädchen, das uns täglich unschätzbare Dienste leistete. Nach dem Mittagessen hatten sie und ich durch einen Münzwurf entschieden, wer beim Kricket Dienst tun musste. Sie hatte gewonnen.
»Ihr braucht eure Spielsachen nicht zu holen«, sagte Bill scharf, als sie zur Wiese zurücklaufen wollten. »Geht einfach ins Cottage und bleibt bei Annelise. Verstanden? Ich will, dass ihr bei Annelise drinnen bleibt. Keiner setzt einen Fuß vor das Cottage. Nicht einen Fuß.«
»Nicht einen Fuß«, wiederholten die Jungs ernüchtert.
»Mummy und ich werden eine Weile im Arbeitszimmer sein«, fuhr Bill fort. »Ich muss was mit ihr besprechen.«
Will und Rob wechselten einen vielsagenden Blick. Wenn Daddy was mit Mummy besprechen musste, schien er zu besagen, war irgendwas im Busch. Aber sie trotteten ohne Widerspruch ins Haus.
Stanley, der den Kopf an Bills Hüfte gerieben hatte, um seine Aufmerksamkeit zu erheischen, stellte sich jetzt auf die Hinterbeine und drückte ihm die Pfoten an die Brust. Bill verstand den Hinweis, hob den Kater hoch und richtete sich auf. Während Stanley sich glückselig schnurrend über seine Schulter legte, blickte Bill auf mich hinab. Mit seinen gut eins achtzig war mein Mann mehr als einen Kopf größer als ich. Und er war ausgesprochen fit. Seine imposante Gestalt flößte mir normalerweise ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit ein, doch in diesem Moment verspürte ich nur den Drang, ihn fest in meine Arme zu schließen, um ihm Schutz zu gewähren.
»Bill?«, fragte ich.
»Nicht hier.« Er wandte kurz den Kopf zu den Hügeln. »Lass uns reingehen.«
Wir überquerten die Sonnenterrasse zur Küche, wo auf dem Herd eine Gemüsesuppe köchelte und im Ofen ein Kalbsrollbraten schmorte. Bill setzte Stanley in der Nähe seiner Futternäpfe auf dem Boden ab, worauf der Kater sich vergewisserte, dass man ihm gegeben hatte, was ihm zustand, und sogleich zu knabbern begann. Auf dem Weg durch den Flur zum Arbeitszimmer hörten Bill und ich im Bad oben Wasser in die Wanne laufen und Annelise fragen, ob die Jungs Schaum haben wollten. Alles schien völlig normal im Cottage, nur Bill war es nicht.
Wortlos schloss er im Arbeitszimmer die Tür hinter sich, knipste die Lampen auf dem Kaminsims an, winkte mich zu einem der Ledersessel vor der Feuerstelle und ließ sich mir gegenüber nieder. Seine Aktentasche lag auf dem kleinen Tisch neben seinem Sessel. Er warf einen kurzen Blick darauf, dann beugte er sich vor, die Ellbogen auf die Knie gestemmt, die Hände ineinander verhakt.
»Es ist was passiert«, begann er. »Am Anfang hab ich’s nicht ernst genommen, aber jetzt bin ich dazu gezwungen, denn es betrifft dich und die Jungs.«
»Okay«, sagte ich. Mehr brachte ich nicht hervor, denn mit einem Schlag war mein Mund völlig ausgetrocknet. Bill hatte mich mit seiner Angst angesteckt.
»In den letzten drei Wochen habe ich mehrere ...«, er zögerte und gab sich dann einen Ruck, »... Drohungen erhalten. Jemand hat sie mir über ein kompliziertes System aus verschiedenen Deckadressen per E-Mail zugesandt, sodass wir die ursprüngliche Quelle nicht ermitteln konnten.«
»Was für Drohungen sind das?«, fragte ich beklommen.
Bills Blick wanderte zu seiner Aktentasche. Schließlich straffte er die Schultern und schaute mir geradewegs in die Augen. »Jemand will mich umbringen.«
»Todesdrohungen? Dir wurden Todesdrohungen geschickt?« Einen Moment lang wirbelten meine Gedanken wild durcheinander, ehe die Bedeutung seiner unglaublichen Feststellung zu mir durchdrang. »Aber wieso? Du bist doch kein Anwalt für Strafrecht. Mit Gewaltverbrechern hast du nie was zu tun. Du verfasst Schriftsätze und Klauseln und sorgst dafür, dass alles wasserdicht ist. Warum sollte jemand ausgerechnet dich umbringen wollen?«
Bill zuckte mit den Schultern. »Offenbar aus Rache. Die Botschaften legen den Schluss nahe, dass ein ehemaliger Mandant sich von mir irgendwie ungerecht behandelt fühlt. Und außerdem geht unmissverständlich daraus hervor, dass er die Absicht hat, es mir heimzuzahlen.« Er legte den Kopf schräg und musterte mich ernst. »Ich hätte es dir eher gesagt, Lori, aber ich hielt das Ganze für einen schlechten Scherz. Ich dachte, es würde irgendwann aufhören. Stattdessen ist es schlimmer geworden. Viel schlimmer.« Er öffnete die Aktentasche, zog ein Dokument heraus und reichte es mir. »Das hier hat heute früh bei meiner Ankunft im Londoner Büro auf mich gewartet.«
Ich beugte mich über das Blatt. Es sah aus wie der Audsruck einer ganz normalen E-Mail, doch aus den Worten sprach der pure Wahnsinn.
WIE EIN DIEB BIST DU IN DER NACHT GEKOMMEN, UM MICH IN DEN ABGRUND ZU WERFEN. IN DER DUNKELHEIT HAST DU MICH ANGEKETTET, DOCH KEINE IRDISCHEN KETTEN KÖNNEN MICH JETZT NOCH HALTEN. ICH BIN AUFERSTANDEN.
SIEHE: ICH BIN GEKOMMEN, UM DIR ZU VERGELTEN, WAS DU GETAN HAST. ALLE, DIE DU LIEBST, WERDEN ZUGRUNDE GEHEN. ICH WERDE DEINE KINDER TOTSCHLAGEN, UND DEIN WEIB SOLL IHR TEIL AN QUALEN UND TRAUER ERDULDEN. ICH HABE DIE SCHLÜSSEL FÜR DEN TOD UND DEN HADES, UND ICH WERDE DEINEN NAMEN FÜR ALLE ZEITEN AUS DEM BUCH DES LEBENS TILGEN.
DEIN ALBTRAUM HAT BEGONNEN. EIN ERWACHEN WIRD ES NICHT GEBEN.
ABADDON.
Ich sah Bill fragend an. »Abaddon?«
Bill machte eine wegwerfende Handbewegung. »Eine Gemengelage von echten und falschen Zitaten aus der Offenbarung. Abaddon ist natürlich ein Pseudonym. In der Offenbarung ist Abaddon der König des bodenlosen Abgrunds. Seine Lakaien kommen auf die Erde, um die Sünder zu quälen.«
»Gut zu wissen, dass unser Freund wenigstens die Bibel liest«, murmelte ich.
»Das ist nicht lustig, Lori!«, blaffte Bill.
»Ich weiß«, sagte ich hastig. »Aber das ist ... einfach unfassbar.«
Ich las die unselige Nachricht noch einmal und gab sie dann Bill zurück, der sie wieder in der Aktentasche verstaute. »›Alle, die du liebst, werden zugrunde gehen.‹ Ich kann einfach nicht glauben, dass ein Mensch uns so sehr hasst, dass er uns ... umbringen will. Das ist so unwirklich.«
»Es ist wirklich«, sagte Bill ernst. »Aus diesem Grund musst du das Cottage zusammen mit den Zwillingen verlassen.«
»Was?«, rief ich verdattert.
»Ich habe heute den halben Tag bei Chief Superintendent Wesley Yarborough von Scotland Yard verbracht. Er ist ebenfalls der Ansicht, dass wir die Drohungen ernst nehmen sollten. Er war sogar ziemlich verärgert, weil ich die Sache nicht schon früher Scotland Yard gemeldet habe.« Bill seufzte. »Yarborough beabsichtigt, meine Akten nach Anhaltspunkten auf Abaddons Identität durchzuarbeiten. Und ich muss in London bleiben, um ihm dabei zu helfen. Solange ich dort bin, wollen der Chief Superintendent und ich, dass du mit den Jungs möglichst weit weg von hier bist. Ihr werdet das Cottage morgen früh verlassen und an einem sicheren Ort bleiben, bis diese Angelegenheit geklärt ist.«
»Aber hier sind wir doch sicher«, hielt ich ihm vor. »Sobald die Dorfbewohner erfahren, was los ist, werden sie sich schützend vor uns stellen. Und wenn sich ein Fremder in Finch blicken lässt, werden sie Alarm schlagen. Wir brauchen nur die Nachricht zu verbreiten, und Abaddon ist so gut wie geschnappt.«
»Und was, wenn Abaddon gar nicht durchs Dorf kommt?«, konterte Bill. »Was, wenn er sich über die Hügel oder durch den Wald heranschleicht?«
»Wie soll er denn wissen, wo er uns findet?«
»Lori«, sagte Bill leise, »er hat uns schon gefunden.«
Auf einmal schien die Zeit stillzustehen. Mein Verstand setzte aus. Auch wenn Bill mit leiser Stimme gesprochen hatte, war mir, als hallten seine Worte im Raum wider. Noch einmal griff er in seine Aktentasche und reichte mir einen Stapel Papiere. Als ich sie durchblätterte, begannen meine Hände zu zittern.
Das waren Fotoausdrucke vom Apfelbaum in unserem hinteren Garten, den Rosen, die sich um unsere Vordertür rankten, der Buchenhecke, die die Kiesauffahrt säumte. Dass die Aufnahmen offenbar mit einem starken Zoom gemacht worden waren, stellte keinerlei Trost dar. Die Bilder waren einfach zu persönlich. Es gab eines von mir, wie ich auf dem Bambussofa unter dem Apfelbaum lag, und eines von Annelise in der Tür. Aber das letzte Foto war das entsetzlichste von allen.
»Die Zwillinge!«, flüsterte ich. »Will und Rob auf ihren Ponys ...«
Bill setzte sich auf die Ottomane und nahm mir die Bilder aus der jäh erschlafften Hand. Dann ließ er sie auf den Boden flattern und ergriff meine Hand. »Diese Fotos sind heute früh eingetroffen, zusammen mit der Botschaft, die du soeben gelesen hast. Kaum hatte ich einen Blick darauf geworfen, habe ich sofort von London aus ein Sicherheitsteam hierhergeschickt, damit es dich und die Jungs die ganze Zeit im Auge behält. Ich war ja noch beim Chief Superintendent.«
»Mir ist niemand aufgefallen«, meinte ich.
»Ich habe sie gebeten, sich bedeckt zu halten«, erklärte Bill. »Solange ich keine Gelegenheit hatte, mit dir darüber zu sprechen, wollte ich nicht, dass sie offen in Erscheinung treten. Sie gehen in den Wäldern, auf den Hügeln und auf der Zufahrt Patrouille. Wenn wir weg sind, werden sie im Cottage wohnen, um sicherzustellen, dass hier nichts passiert.«
»›Alle, die du liebst, werden zugrunde gehen‹«, zitierte ich benommen aus dem Drohbrief. »Ich nehme an, dass damit in einem weiteren Sinn auch das Cottage gemeint ist.«
Bill nickte. »Wir können es uns nicht leisten, das anders zu interpretieren.«
»Und wo soll ich mit den Zwillingen hin?«, fragte ich.
»Boston«, antwortete er wie aus der Pistole geschossen. »Ihr könnt bei meinem Vater unterschlüpfen.«
Ich prallte zurück. »Boston? Bist du verrückt? Du weißt, wie sehr ich deinen Vater mag, Bill, aber nach Boston gehe ich nicht. Da wäre ja ein ganzer Ozean zwischen uns, und die Concord fliegt auch nicht mehr. Wenn dir was passieren würde, wäre ich eine Ewigkeit unterwegs, bis ich bei dir bin.«
Bill brachte ein verschmitztes Lächeln zuwege. »Einen Versuch war es immerhin wert. Aber weil mir schon klar war, dass du keine Lust hast, nach Boston zu gehen, habe ich mir einen anderen Plan einfallen lassen, der es dir erlaubt, auf dieser Seite des Atlantiks zu bleiben.«
»Und zwar?«
»Das verrate ich dir nicht«, sagte er, und als ich zum Widerspruch ansetzte, schnitt er mir kurzerhand das Wort ab. »Tut mir leid, Lori, aber du bist einfach eine Quasselstrippe. Du brauchst dich nur einmal zu verplappern, und binnen fünf Minuten weiß ganz Finch Bescheid. Unsere Nachbarn mögen es ja gut meinen, aber sie sind leider auch allesamt Klatschmäuler. Ein beiläufiges Wort in der Teestube oder im Pub würde Abaddon direkt zu dir führen. Je weniger Leute wissen, wo du mit den Jungs bist, desto sicherer seid ihr. Darum behalte ich euer Ziel vorerst für mich. Du wirst mir in dieser Sache einfach vertrauen müssen, Schatz.«
Bill hatte meine Hände fester gepackt, als wappnete er sich schon für einen hysterischen Anfall, aber ich dachte gar nicht daran, ihm eine Szene zu machen. Ich fühlte mich kühl, ruhig und extrem konzentriert. Mein Mann hatte eine unvorstellbar schwere Last auf sich genommen. Nichts lag mir ferner, als ihm noch mehr aufzubürden.
»Gut«, sagte ich und stand auf.
»Wohin gehst du?«
»Packen.«
Kapitel 2
DER REST DES Nachmittags verflog in hektischer Betriebsamkeit. Da es beim besten Willen nicht möglich war, die geeignete Kleidung auszuwählen, wenn man das Ziel nicht kannte, stopften Annelise und ich von Schneeanzügen bis zu Badesachen so ziemlich alles in die Koffer. Und da wir auch nicht wussten, wie lange wir wegbleiben würden, wurden es nicht wenige Gepäckstücke.
Das Einzige, wovon ich sicher ausgehen konnte, war, dass unser geheimes Versteck kinderfreundlich sein würde, aber das wusste ich auch nur deshalb, weil Bill den Zwillingen versichert hatte, dass sie nicht jedes Spielzeug aus ihrer Sammlung mitzunehmen brauchten; dort, wo es hinging, würde es jede Menge Spielsachen für sie geben.
Irgendwann rief mich Bill nach unten, um mich Ivan Anton, dem Chef des Sicherheitsteams aus London, vorzustellen. Meine Einladung, mit uns zu Abend zu essen, lehnte der breitschultrige junge Mann höflich ab. Er und seine Leute, erklärte er, würden die Nacht im Freien verbringen, um die Felder und Hügel und die schmale Zufahrt abzusichern.
»Wir haben eine Sicherheitszone um das Cottage gezogen«, informierte er mich. »Niemand kommt an uns vorbei, Mrs Willis.«
»Shepherd«, korrigierte ich ihn mechanisch. Ivan Anton war einem häufigen Irrtum unterlegen. Bei der Hochzeit mit Bill Willis hatte ich bewusst darauf verzichtet, seinen Nachnamen anzunehmen. »Ich bin Lori Shepherd. Aber nennen Sie mich Lori. Jeder nennt mich so.«
Ivan nickte. »Sie können sich auf mich und mein Team verlassen, Lori. Wir werden auf Ihr Haus aufpassen, als wäre es unser eigenes.« Er tippte sich mit den Fingerspitzen leicht an die Stirn und verschwand, um seinen Patrouillengang entlang der Sicherheitszone fortzusetzen.
Und ich ging wieder nach oben, um weiterzupacken.
Stanley, der klügste aller Kater, hielt es für ratsam, uns aus dem Weg zu gehen und sich auf Bills Lieblingssessel im Wohnzimmer einzuigeln. Dort blieb er bis zum Dinner, bei dem er uns im Esszimmer Gesellschaft leistete und sein Möglichstes tat, um uns davon zu überzeugen, dass der Kalbsrollbraten ausschließlich für ihn geschmort worden war.
Nach dem Dinner versammelten wir uns um den Küchentisch und spielten mit den Kindern Quartett. Das regte die Jungs derart an, dass sie auch dann noch eifrig Karten tauschten, als es längst Schlafenszeit war. Als das Spiel endlich vorbei war, ging Annelise in ihr Zimmer, um ihre eigenen Sachen zu packen, während Bill die Zwillinge ins Bett brachte. Stanley begleitete sie – er hatte sich von Anfang an als Bills Katze gefühlt. Ich wollte nicht stören. Schließlich wusste ich, dass ich die Zwillinge bald auf Schritt und Tritt bei mir haben würde, wohingegen Bill keine Ahnung hatte, wann er sie wiedersehen würde. Allein schon deshalb wollte ich den dreien so viel gemeinsame Zeit wie nur möglich gönnen.
Ich räumte in der Küche die Spielkarten weg, räumte die Geschirrspülmaschine aus und klebte Zettel an die Schränke, um Ivan Anton und seinen Männern die Suche zu erleichtern, falls sie sich selbst etwas kochen wollten. Es ging bereits auf zehn Uhr zu, als ich ins Arbeitszimmer zurückkehrte, wo die Lampen am Kaminsims noch brannten.
Zunächst zündete ich das säuberlich im Kamin aufgeschichtete Brennholz an. Als die Flammen aufloderten, nahm ich ein in blaues Leder gebundenes Buch aus dem Bücherregal und ließ mich damit in dem Sessel nieder, den ich auch schon während des beunruhigenden Gesprächs mit Bill besetzt hatte.
Das blaue Buch war eine Art Tagebuch. Ich hatte es von der engsten Freundin meiner verstorbenen Mutter geerbt, einer Engländerin namens Dimity Westwood. Meine Mutter und Dimity hatten sich in London kennengelernt, als sie im Zweiten Weltkrieg ihren jeweiligen Ländern gedient hatten. Auch wenn sie sich nach der Rückkehr meiner Mutter in die Staaten nie wiedergesehen hatten, hatten sie ihre Freundschaft aufrechterhalten und einander Hunderte von Briefen über den Atlantik geschickt.
Meiner Mutter lag die Korrespondenz mit Dimity sehr am Herzen. Ihre Briefe waren ihre Zuflucht, ihr Ausweg aus der Routine und den Pflichten des Alltags, und sie bewahrte sie als ihr streng gehütetes Geheimnis auf. Auch ich erfuhr erst von den Briefen und ihrer Freundschaft, als sie und Dimity gestorben waren.
Bis dahin hatte ich Dimity Westwood nur als Tante Dimity gekannt, die legendäre Heldin meiner Kindheit, die in allen Gutenachtgeschichten, die meine Mutter für mich erfand, die Hauptrolle spielte. Die Wahrheit über Tante Dimity war ein ziemlicher Schock für mich gewesen. Ebenso die überraschende Nachricht, dass die Heldin meiner Kindheitsgeschichten mir nicht nur ein äußerst echtes Vermögen hinterlassen hatte, sondern auch das honigfarbene Cottage, in dem sie aufgewachsen war, das unschätzbar wertvolle Versteck für die Briefe und ein in blaues Leder gebundenes Tagebuch.
Ein noch viel größerer Schock war die Entdeckung gewesen, dass Dimity zwar verstorben war, aber das Cottage nicht völlig verlassen hatte. Obwohl sie durch eine, wie man vielleicht sagen könnte, erhebliche Behinderung eingeschränkt war, besuchte sie auch weiterhin ihr altes Zuhause. Sie war zu höflich, um auf sich aufmerksam zu machen, indem sie in den Kaminen stöhnte oder im Zwielicht der Dämmerung am Fuß meines Bettes vorbeischwebte. Stattdessen schrieb sie mir, so wie sie auch meiner Mutter Briefe geschrieben hatte, und führte damit die Korrespondenz fort, wenn auch nur noch im blauen Buch.
Wann immer ich das Tagebuch aufschlug, erschien schon bald Dimitys Handschrift in der altmodischen Schreibweise, wie sie in einer Zeit an der Schule gelehrt worden war, als fließendes warmes Wasser noch als Luxus galt. Ich hatte keine Ahnung, wie Dimity es fertigbrachte, die Kluft zwischen Leben und Nach-Leben zu überbrücken – selbst sie war sich hinsichtlich der Technik nicht so sicher –, aber die Frage nach dem Wie war schon längst irrelevant geworden. Meine Freundschaft mit Tante Dimity mochte das überraschendste aller Überraschungsgeschenke sein, aber es war eine mit Geld nicht aufzuwiegende Gabe, die ich immer wieder dankbar annahm.
Das Feuer knisterte und prasselte, als ich mich mit untergeschlagenen Beinen auf den Sessel kuschelte. Kurz blickte ich zum Fenster über dem Schreibtisch mit seinen rautenförmigen Scheiben hinüber, halb in der Erwartung, den König des bodenlosen Abgrunds durch den in der Brise raschelnden Efeu hereinspähen zu sehen, dann schlug ich das blaue Tagebuch auf.
»Dimity?«, begann ich und konnte fast sofort spüren, wie sich der Knoten in meiner Kehle auflöste, als sich die vertrauten Buchstaben mit ihren vielen Schleifen über die Seite kringelten und mir neuen Mut einflößten.
Guten Abend, meine Liebe. Wie war Dein Tag?
»Na ja ...« Ich schürzte nachdenklich die Lippen. »Wenn man mal den Umstand weglässt, dass Bill, die Jungs und ich von einem blutrünstigen Wahnsinnigen bedroht werden, der unseren Namen für immer aus dem Buch des Lebens löschen will ...«, ich holte tief Luft, »... war er gar nicht mal so schlecht.«
Wie bitte?
»Es stimmt, Dimity. Unglaublich, aber wahr. Irgendein Durchgeknallter schickt Bill seit Wochen Todesdrohungen per E-Mail. Weil er die Drohungen heute Morgen auf die Jungs und mich erweitert hat, verfrachtet Bill uns jetzt in ein Versteck, während er in London bleibt, um mit Chief Superintendent Wesley Yarborough von Scotland Yard zusammenzuarbeiten.«
Gute Güte! Wer um alles auf der Welt sollte denn Bill ermorden wollen?
»Ein früherer Mandant«, sagte ich. »Er nennt sich Abaddon.«
Ah. Der Engel des Abgrunds. Die Offenbarung des Johannes bietet leider einen ganzen Schatz an abstoßenden Inspirationen für auf Abwege geratene Gemüter, und ich denke, wir können mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass das auch hier der Fall ist. Unzufriedene Mandanten äußern ihr Missvergnügen in der Regel nicht in Form von Drohungen, ihren Anwalt samt seiner Familie zu ermorden.
»Stimmt, bei Bill ist es das erste Mal«, bestätigte ich. »Wenn seine Mandanten durchdrehen, fallen sie übereinander her, aber nicht über ihn. Sie hegen vielleicht einen Groll gegen Onkel Hans in Deutschland, weil er zehntausend Euro nicht ihnen, sondern einem Asyl für heimatlose Dackel hinterlassen hat, aber doch nicht gegen Bill, weil er das Testament verfasst hat.«
Abaddon verübelt Bill offensichtlich irgendetwas. Es könnte die sprichwörtliche Situation sein, in der der Bote der schlechten Nachricht erschossen wird, wenn Du mir meine unglückliche Formulierung verzeihst. Was beabsichtigt Bill in London zu tun?
»Er wird ein Team aus Ermittlern von Scotland Yard unterstützen. Sie wollen seine ganzen Akten daraufhin durchforsten, ob sich vielleicht ein möglicher Verdächtiger identifizieren lässt. Bill ist nicht gerade erbaut davon – schließlich sind die Akten streng vertraulich –, aber einen besseren Ansatzpunkt kann auch er sich nicht vorstellen. Totzdem fällt es ihm schwer zu glauben, dass jemand, den er kennt – oder kannte –, seinen Tod will.«
Armer Mann. Wie sehr ich mit ihm fühle. Als damals mein Leben bedroht war, fand ich es extrem schwierig ...
»Wann war dein Leben bedroht?«, unterbrach ich sie verblüfft.
Ich glaube, ich habe Dir mal von einer Serie vergifteter Briefe erzählt, die ich erhielt, als ich in London angestellt war?
»Stimmt!«, rief ich. »Du hast mir davon erzählt, als wir im Hailsham House übernachteten. Das war, als Simon Elstyn diese widerwärtigen anonymen Mitteilungen bekam. Du hast gesagt, dass eine Frau dahintersteckte, die für dich gearbeitet hat, eine Assistentin, zu der du vollstes Vertrauen hattest. Aber von Todesdrohungen hast du nie was erwähnt.«
Ich wollte Dich nicht im Nachhinein beunruhigen. Trotzdem kann ich mich noch gut an das Gefühl von unaussprechlicher Fassungslosigkeit erinnern, das mich überwältigte, als ich begriff, dass irgendjemand, ein gesichtsloses Monster, meinem Leben ein Ende setzen wollte. Selbst als man den Schuldigen gefasst hatte, wirkte die Situation noch lange danach ... surreal.
»Ich weiß, was du meinst. Das ist die Art von Dingen, die immer anderen passiert, aber nie einem selbst. Wenn ich nicht einen Stapel Koffer im Flur stehen hätte, hätte ich wohl immer noch Zweifel daran, dass wir davon betroffen sind. Ich bin es nicht gewöhnt, dass Menschen mich hassen. Na gut ...«, gab ich nach kurzem Überlegen zu, »... Sally Pyne war mal auf mich sauer, weil ich ihr Blumenarrangement im Taufbecken von St. George’s etwas überladen fand, aber deswegen hat sie mich doch nicht gehasst.«
Wer Dich kennt, könnte das auch gar nicht. Wäre Dir mit der Vorstellung geholfen, dass Abaddons Hass etwas Abstraktes ist, das sich nicht gegen Dich persönlich richtet?
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Ich habe das Gefühl, eine Zielscheibe auf der Stirn zu haben. Noch persönlicher kann es kaum werden.«
Leider nicht. Wann reist Ihr ab?
»Morgen früh.«
Bist Du für heute Nacht in Sicherheit?
»Wahrscheinlich«, antwortete ich und erzählte ihr von Ivan Anton und seinem Team aus Sicherheitsspezialisten. »Und bevor du mich fragst«, fuhr ich fort, »ich habe keine Ahnung, wohin die Reise morgen geht. Bill sagt es mir nicht, weil er befürchtet, dass ich es irgendjemand brühwarm erzähle und unsere geheime Zuflucht – Finch ist schließlich die Hauptstadt des weltweiten Klatsches – dann die längste Zeit geheim gewesen ist.«
Deine Offenheit ist eine Deiner liebenswertesten Eigenschaften, Lori, aber sie birgt in der Tat ein gewisses Sicherheitsrisiko, wenn es gilt, Geheimnisse zu bewahren. Dennoch muss ich sagen, dass Du die Situation mit außerordentlicher Ruhe bewältigst.
»Ja, erstaunlich, was?«, erwiderte ich. »Eigentlich müsste ich mir jetzt die Haare raufen, aber dazu fehlt mir die Energie. Ich hatte einfach zu viel zu erledigen. Erst das Packen, dann tausend Anrufe, um dies abzusagen und jenes zu verschieben. Ich sag dir eines, Dimity – man hat keine Ahnung, wie kompliziert das eigene Leben ist, solange man nicht gezwungen wird, es neu zu ordnen.«
Wie wahr.
»Für morgen Abend habe ich allerdings schon mal einen hysterischen Anfall eingeplant«, fuhr ich fort. »Den darf ich mir dann wohl auch gönnen, was meinst du?«
Unbedingt. Er wird sicher eine befreiende Wirkung haben. Hast Du Rob und Will von Abaddon erzählt?
»Bill hat ihnen gesagt, dass wir wegfahren, weil ein böser Mensch uns wehtun will.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich selbst wollte sie nicht damit belasten, aber Bill hat mich davon überzeugt, dass es besser für sie ist, wenn sie sich der Gefahr bewusst sind.«
Wie haben sie reagiert?
»Wie Fünfjährige eben.« Ich schnitt eine Grimasse. »Sie haben sich ausgetauscht, ohne dass ich mitgekriegt habe, wie, und das Ergebnis war: ›Mach dir keine Sorgen, Mummy, Daddy wird schon aufpassen. Dürfen wir die Kricketschläger mitnehmen?‹«
Großartig. Sie haben volles Vertrauen in Deine Fähigkeit, sie zu beschützen, und so soll es ja auch sein. Wird Annelise mitkommen?
»Nein. Es war eine schwere Entscheidung, und Annelise ist nicht glücklich darüber. Sie hat jetzt das Gefühl, uns im Stich zu lassen, gerade wenn sie am meisten gebraucht wird. Aber es ist einfach besser so. Wir wollen sie nicht noch tiefer in unsere Probleme mit hineinziehen als ohnehin schon. Bill und ich haben uns darauf verständigt, dass sie auf der Farm ihrer Eltern in Sicherheit ist, bis sie Abaddon hinter Schloss und Riegel gesteckt haben.«
Da gebe ich Dir recht. Der Sciaparelli-Clan weiß sich um die Seinen zu kümmern. In Zeiten wie dieser ist es von größtem Nutzen, wenn eine junge Frau sieben muskelbepackte Brüder in der Nähe hat, die es mit dem Schutz extrem ernst meinen. Aber was macht Ihr mit Stanley? Ich habe noch nie eine Katze gesehen, die aufs Reisen erpicht wäre. Wollt Ihr ihn mitnehmen? Oder wird Mr Anton auf ihn aufpassen?
»Stanley kommt auf Anscombe Manor in Schutzhaft«, erklärte ich. Anscombe Manor war das äußerst quirlige Zuhause von unseren engsten Freunden, Emma und Derek Harris und ihrem Stallmeister, Kit Smith. »Emma hat mir versprochen, Stanley im Auge zu behalten, und Kit wird die Ponys der Jungs hüten wie seinen Augapfel.«
Dann steht wohl zu vermuten, dass Kit mit einer Heugabel bewaffnet im Stall schlafen wird, bis die Gefahr gebannt ist.
»Das würde mich kein bisschen überraschen«, entgegnete ich. »Kit könnte keiner Fliege etwas zuleide tun, es sei denn, jemand will einem Tier an den Kragen.«
Nun, Du scheinst alles im Griff zu haben.
»Ja.«
Du hast Deine Angelegenheiten mit bewundernswerter Gefasstheit geregelt.
»Stimmt.«
Alles ist gepackt, die Telefonate sind erledigt, und Du hast Dich um alles Nötige so gekümmert, wie es sich gehört. Du hast Energie bewiesen, Vernunft und, was das Wichtigste ist, ein enormes Organisationstalent. Ich gratuliere Dir.
»Danke«, sagte ich mit einer kleinen Verneigung.
Gut, mein liebes Kind, dann ist es jetzt an der Zeit, mir zu verraten, was wirklich in Deinem Kopf vorgegangen ist.
Schweigend bedachte ich die Frage, dann hob ich den Blick und ließ ihn langsam durchs Zimmer schweifen. Unzählige Stunden hatte ich hier verbracht, seit das Cottage mein Zuhause geworden war. Mit jeder knarzenden Diele war ich aufs Innigste vertraut, mit jeder dunklen Ecke, mit jedem Flüstern des Windes im Kamin. Und während meine Hände über das weiche Leder der Lehne glitten, fiel mir wieder ein, dass ich im selben Sessel gesessen hatte, als ich Tante Dimitys außergewöhnliches Tagebuch zum ersten Mal aufgeschlagen hatte.
Ich schloss die Augen und trat in der Vorstellung eine Reise durch die anderen Räume an, vorbei an den silbern gerahmten Familienfotos, den Haufen von Stofftieren, der Tafel auf dem Kaminsims im Wohnzimmer mit den vielen darauf gekritzelten Notizen – Erinnerungen an Veranstaltungen und Termine, die mir vor sechs Stunden noch schrecklich wichtig erschienen waren und jetzt jede Bedeutung verloren hatten. Vor meinem geistigen Auge sah ich das mit Tinte befleckte Kissen auf dem Stuhl vor dem Erkerfenster im Wohnzimmer, die Kratzer an den Beinen des Esstischs, die überquellende Wandgarderobe im Flur. Ich sah die Zwillinge unter ihren Steppdecken schlummern, die im Nähclub des Dorfes für sie gefertigt worden waren. Und ich sah Bill, wie er mit kalter Angst in den Augen über ihnen stand.
»Was wirklich in meinem Kopf vor sich geht?«, wiederholte ich leise und blickte in die flackernden Flammen im Kamin. »Ich werde von jemandem terrorisiert, der meinen Mann, meine Kinder und mich umbringen will. Ich werde gezwungen, dieses Haus zu verlassen, das ich über alles auf der Welt liebe, und habe keine Ahnung, wann ich zurückkommen kann. Bill und den Jungs zuliebe bewahre ich Ruhe, Dimity, aber wenn du wissen willst, wie ich mich in Wahrheit fühle – bitte sehr: Am liebsten würde ich mir das Gesicht schwarz anmalen und in der Dunkelheit draußen mit Machete, Maschinengewehr und Flammenwerfer auf Streife gehen. Am liebsten würde ich diesen üblen Scheißkerl stellen und über den Haufen schießen, ihn abstechen, auf ihm herumtrampeln, ihn in lauter kleine Stücke hacken, ihn abfackeln und die Asche ins Weltall jagen, damit sie mir nicht mehr die Atemluft verpesten kann.« Ich hielt inne, damit mein hämmerndes Herz sich beruhigen konnte. »Ich schätze, man könnte mit einiger Berechtigung sagen, dass ich ein kleines Problem mit Aggressionsbewältigung habe.«
Im Gegenteil, meine Liebe! Ich würde sogar sagen, dass Du Deine Wut außerordentlich gut beherrschst. Du hast nicht zufällig einen Flammenwerfer erworben, oder?
Ich überraschte mich selbst mit einem herzhaften Lachen. »Natürlich nicht, Dimity! Ich hatte gar keine Zeit dazu. Außerdem wüsste ich nicht, wie man mit einem solchen Ding umgeht.«
Ich bin sicher, dass eine Gebrauchsanweisung beiliegt. Dennoch ist meiner Meinung nach allen besser gedient, wenn Du solche Angelegenheiten den fähigen Händen von Ivan Anton und Chief Superintendent Yarborough überlässt.
»Genau das habe ich auch vor«, sagte ich. »Außerdem habe ich die Absicht, dich mitzunehmen – wohin auch immer.«
Das möchte ich auch sehr hoffen. Du wirst jemanden brauchen, der Dich vom Amoklaufen abhält. Und Reginald? Du wirst ihn doch nicht zurücklassen, oder?
Reginald war ein kleiner pinkfarbener Stoffhase mit schwarzen Stoffaugen, herrlichen angestickten Schnurrhaaren und dem Geist eines Traubensaftflecks auf der Nase. Seit frühesten Kindheitstagen war er mein Gefährte und über alles geliebter Freund.
Als Dimity Reginalds Namen fallen ließ, schweifte mein Blick zu der für ihn reservierten Nische im Bücherregal, von wo er auf mich herabblickte. Seine schwarzen Knopfaugen schienen im flackernden Licht des Kaminfeuers vor Ungeduld zu tanzen, als würde er geradezu darauf brennen, in einen der Koffer im Flur zu springen. Ich hatte ihm noch nicht mitgeteilt, dass er zusammen mit dem blauen Tagebuch in meiner Tasche mitreisen würde.
»Wie könnte ich Reginald zurücklassen?«, rief ich. »Seit meinem zehnten Lebensjahr habe ich ihn nicht mehr zu mir ins Bett genommen, aber wenn Bill in London ist ... Wer weiß? Vielleicht fange ich auch wieder an, Daumen zu lutschen.«
Ich kann mir schlimmere Formen der Stressbewältigung vorstellen.
»Dimity?«, fragte ich unvermittelt. »Wie bist du damals damit fertig geworden?«
Ich habe mein Vertrauen in die Polizei gesetzt, Unmengen von Schokolade gegessen und versucht, jede Nacht mindestens acht Stunden zu schlafen, bis der Fall gelöst war. Dir würde ich raten, heute Nacht wenn irgend möglich Ruhe zu finden. Am Morgen wirst Du Dich dann umso besser fühlen.
»Du hast bestimmt recht«, antwortete ich. »Gute Nacht, Dimity. Gleich nach unserer Ankunft bringe ich dich auf den neuesten Stand.«
Gute Nacht, meine Liebe.
Ich wartete, bis die anmutig mit königsblauer Tinte gefüllten Zeilen verblasst waren, dann riskierte ich erneut einen verstohlenen Blick zum mit Efeu zugewucherten Fenster. Dimity hatte mir wie immer einen klugen Rat erteilt, doch ich glaubte nicht, dass ich ihn diesmal wortgetreu befolgen konnte. Schokolade konnte ich ohne weiteres bewältigen – je mehr, desto besser –, aber ich bezweifelte doch ernsthaft, dass ich in der Lage sein würde, die Augen zu schließen, geschweige denn friedlich zu schlafen, bis der König des bodenlosen Abgrunds hinter Schloss und Riegel war.
Kapitel 3
EINE MÄCHTIGE ALTE Hecke südlich des Cottage grenzte unser Grundstück von der Farm unseres Nachbarn, Mr Malvern, ab. Die Hecke war eine Welt für sich, voller Kaninchen, Mäuse, interessanter Käfer, zahlloser Vogelnester und gespickt mit höhlenartigen Einbuchtungen, die Rob und Will an heißen Sommertagen für ihr Leben gern erforschten.
An einer Stelle wurde die Hecke von einem Zaunübertritt aus massiven Holzstämmen durchbrochen, der uns Zutritt zu Mr Malverns nördlichem Feld ermöglichte, eine weite, mit struppigem Gras bewachsene Fläche, auf der normalerweise seine kleine Milchviehherde weidete. Am Tag unserer Abreise grasten Daisy, Beulah und wie die Kühe alle hießen allerdings woanders. Dennoch war das Feld nicht leer. Zwei Mitglieder von Antons Sicherheitsteam hatten aus für mich unersichtlichen Gründen unsere Koffer über den Übertritt auf die Weide gehievt und gleich hinter der Hecke im feuchten Gras aufeinandergestapelt. Als ich Bill um eine Erklärung bat, meinte er nur, dass ich die Gründe noch früh genug erfahren würde.
Bill und ich hatten eine schlaflose Nacht hinter uns, in der wir uns immer wieder tapfer versichert hatten, dass alles gut werden würde. Mindestens ein Dutzend Mal hatten wir bei Will und Rob nach dem Rechten gesehen, ehe wir schließlich in der Morgendämmerung aufstanden, um uns von Annelise zu verabschieden, Frühstück zu machen, die Jungs anzuziehen und mit ihnen zu essen.
Um sieben Uhr brachte Ivan Anton unseren geliebten Kater Stanley, Stanleys Schüsseln, Stanleys Spielsachen und einen Monatsvorrat von Stanleys geliebtem Feinschmeckerfutter nach Anscombe Manor. Um Viertel vor neun eskortierten Ivans Assistenten Bill, die Zwillinge und mich in den hinteren Garten. Die zwei Männer waren schon über den Übertritt gesprungen, als die Jungs und ich auf einmal wie angewurzelt stehen blieben. Was uns so in Staunen versetzte, war ein Hubschrauber, der jetzt dröhnend herangeschwebt kam und zur Landung auf Mr Malverns nördlichem Feld ansetzte. Ich warf Bill einen fragenden Blick zu.
»Euer Streitwagen wartet!« Er musste fast schreien, um den Lärm der Rotoren zu übertönen.
Während Bill und ich mit unseren Söhnen auf die andere Seite des Zauns stiegen, musterte ich die Maschine, die uns in Sicherheit fliegen sollte. Auf mein ungeübtes Auge wirkte sie wie der letzte Schrei. Groß, schwarz, windschnittig und glänzend, erinnerte sie mich eher an einen Haifisch als an ein Fluggerät. Wie ich das sah, konnte sich nur ein Multimillionär ein derart edles Spielzeug leisten, und bei diesem Gedanken begann es mir langsam zu dämmern.
»Percy!«, rief ich, gerade als Bill, der das Schlusslicht bildete, den Fuß auf Mr Malverns Wiese aufsetzte. »Du schickst uns zu Percy Pelham!«
Die Worte hatten kaum meinen Mund verlassen, da kletterte Sir Perceval Pelham auch schon aus dem Helikopter und bestätigte meine Vermutung. Percy und Bills Vater waren alte Freunde, und Bill kannte Percy bereits sein Leben lang. Er war ein wahrer Hüne von Mann, groß und breitschultrig, stämmig, ohne fett zu sein, und obwohl er schon Ende fünfzig war, ließ ihn seine überschäumende Lebensfreude um Jahre jünger wirken. Dazu passten auch seine dröhnende Stimme und sein federnder Gang. Seine Begeisterung für die Spielsachen großer Jungs verhalf ihm zu extremer Beliebtheit bei den Zwillingen. In vielerlei Hinsicht war er ihr Altersgenosse.
Er hatte nicht nur einen Adelstitel, sondern war auch unsäglich reich. Von seinem Vater hatte Percy ein Vermögen geerbt, das er durch kluge Investitionen in der Öl- und Pharmaindustrie sowie in verschiedene Bauprojekte auf der ganzen Welt um ein Hundertfaches vermehrt hatte. Wenn jemand in Bills Abwesenheit meinen Söhnen größtmöglichen Schutz bieten konnte, dann Percy.
Die Jungs stießen ein Jubelgeheul aus, als der große Mann über beide Ohren grinsend auf sie zutrat und sich das zottelige weiße Haar aus dem braunroten Gesicht strich. Sein Copilot, ein unscheinbarer, schlanker junger Mann namens Atkinson, half Ivan Antons Leuten beim Verladen der Koffer, ehe er sich zu uns gesellte.
»Hallo, Sir Percy! Hallo, Atkinson!«, riefen die Zwillinge. »Werden Sie uns selber fliegen, Sir Percy? Dürfen wir vorne bei Ihnen sitzen?«
»Ihr sitzt hinten bei mir«, erklärte ich entschieden und bedachte Sir Percy mit einem bedeutungsvollen Blick.
»Natürlich fliege ich den Hubschrauber, Jungs«, dröhnte er. »Für solche Aufgaben soll man nur den Besten nehmen, sag ich immer. Und ihr müsst unbedingt hinten sitzen. Ich brauch euch doch als Lotsen. Ganz wichtiger Job, wisst ihr. Wir wollen doch nicht aus Versehen in der Wüste von Namibia runterkommen, oder?« Er kauerte sich vor sie und legte jedem eine Hand auf die Schulter. »Würde ja gern bei den Ponys vorbeischauen und durch eure Wälder tigern, meine Herren, aber die Zeit drängt. Seid also liebe Kerle und verabschiedet euch ordentlich von eurem Papa.«
Ich musste mir die Hand an den Mund drücken, damit mein Kinn nicht zu zittern anfing, als Bill sich zwischen die Zwillinge kniete. Ich selbst konnte die erzwungene Fröhlichkeit in seiner Stimme hören, als er ihnen sagte, dass sie sich ganz bald wiedersehen würden, und die Jungs merkten es wohl auch.
»Hab keine Angst, Daddy«, sagte Rob und tätschelte ihm die Schulter. »Sir Percy wird gut auf uns aufpassen.«
Will nickte zustimmend. »Wenn der böse Mann in unsere Nähe kommt, wird Sir Percy ihn fressen.«
»Mit Senf und Essig«, bestätigte Percy. »Lauft schon mal los, Jungs. Atkinson sorgt dafür, dass ihr es auf euren Sitzen bequem habt.« Er wartete, bis die Zwillinge weit genug entfernt waren, dann wandte er sich in ungewohnt nüchternem Ton an Bill. »Kindermund tut Wahrheit kund, hm? Aber sie haben recht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Solange sie bei mir ist, ist deine Familie die meine. Wenn es sein muss, werde ich sie mit meinem Leben verteidigen.«
»Das weiß ich, Percy.« Bill ergriff die Pranke des großen Mannes, mit dem wir per Du waren, seit sich unsere Freundschaft mehr und mehr gefestigt hatte. »Danke.«
»Nicht der Rede wert. Ich wollte schon immer mal eine schöne Frau gen Norden entführen. Aber leider werden wir keine Zeit haben, in Gretna Green einen Zwischenstopp einzulegen. Na ja, ist vielleicht ganz gut so, nachdem die fragliche Dame bereits glücklich verheiratet ist.« Percy zwinkerte mir zu, dann packte er meine Reisetasche und ging auf den Hubschrauber zu.
»Gretna Green«, murmelte ich nachdenklich. »Bringt Percy uns etwa nach Schottland?«
»Meine Lippen sind versiegelt«, sagte Bill.
Wir standen einander gegenüber. Plötzlich wirkte Bill unbeholfen und verlegen. »Äh ...«, begann er.
»Hör zu«, unterbrach ich ihn eilig. »Ich weiß, was wir gestern Nacht über Leute gesagt haben, die sich beim Abschied aneinanderklammern wie Idioten, die’s nötig haben, aber ich finde nicht, dass es schlimm wäre, wenn wir uns einen Moment lang festhalten würden wie ein Ehepaar, das sich gern hat – du etwa? Nur für eine Minute?«
»Nur für eine Minute«, sagte Bill, und wir fielen uns in die Arme.
Die Minute dauerte etwas länger als die üblichen sechzig Sekunden, und danach war Bills Hemd an der Brust ein bisschen feuchter, wenn auch nur ein kleines bisschen. Nach einem flüchtigen Kuss und einem zaghaften Lächeln lief ich in der Gewissheit zum Hubschrauber, dass ich zusammenbrechen würde, wenn ich mich nicht beherrschte.
Percy hieß mich an Bord willkommen und brachte mich zu meinem Sitz. Nur durch einen schmalen Gang von mir getrennt, saßen die Zwillinge festgeschnallt auf ihren Plätzen und brannten schon darauf loszufliegen. In weiser Voraussicht hatte Percy jedem einen Kopfhörer mit Mikrofon übergestülpt, damit sie sich während des Flugs mit ihm und Atkinson verständigen konnten. Mir half er, ein Set für Erwachsene aufzusetzen, und erklärte mir kurz die Funktion. Dann reckte er beide Daumen in die Höhe und verschwand nach vorn ins Cockpit.
Die ganze Kabine vibrierte, sobald die Rotoren sich zu drehen begannen, und kaum stiegen wir in die Luft, sackte mein Magen nach unten. Damit das Frühstück blieb, wo es war, umklammerte ich die Armlehnen und holte mehrmals schnell Luft. Gleichzeitig presste ich die Nase ans Fenster, denn ich wollte noch einen letzten Blick auf Bill werfen, bevor wir nach Norden schwenkten und er hinter der hohen Hecke verschwand.