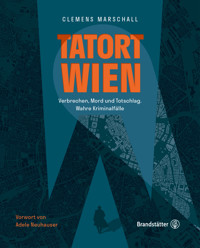
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die finsteren Seiten Wiens Der Killer mit dem Milchgesicht, die Leuchtgasmörderin, dramatische Verfolgungsjagden, blutrünstige Serientäter oder bis heute ungeklärte Bluttaten: Eine Fülle an schockierenden und aufsehenerregenden Kriminalfällen, Mord und Totschlag hielt Wien in den Nachkriegsjahrzehnten in Atem. Mit bislang unveröffentlichten Fotos, neuen Dokumenten und fesselnden Geschichten, die die Hintergründe der Verbrechen beleuchten, entsteht ein einmalig abgründiges Zeitpanorama.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort Adele Neuhauser
DER SCHNÖDE MAMMON
Adrienne Eckhardt: Die Fleischwolf-Mörderin
Max Gufler: Der Blaubart von St. Pölten
Harald Sassak: Wenn der Gasmann klingelt
FRAUENHASS
Alfred Engleder: Der Mörder mit dem Maurerfäustel
Josef Weinwurm: Das Phantom der Oper
MORDLUST
Werner Kniesek: Hafturlauber und Villenmörder
Günter Lorenz: Der Killer mit dem Milchgesicht
UMKEHRUNG DER GESETZE
Johann Rogatsch: Wenn Mädchenmörder beim Scharfrichter landen
Ernst Karl: Die Wiedereinführung der Todesstrafe
AUF DER FLUCHT
Ernst Dostal: Die größte Fahndung der Zweiten Republik
Ausbruch aus der Justizanstalt Stein: „I bin’s, dei Präsident!“
UNGEKLÄRT
Johanna Hybal und Hildegard Fasan: Mit Leuchtgas in den Tod
Ilona Faber: Mädchenmord am Russendenkmal
UNGEWÖHNLICH GEKLÄRT
Johann Bergmann: Der Stephansturmkletterer
Kriminalfotografie zwischen Dokumentation und Lust am Schauder Gerald Piffl
Autor und Beitragende
Quellen
VORWORT ADELE NEUHAUSER
Ich wäre gerne auch weise
In den alten Büchern steht, was weise ist:
Sich aus dem Streit der Welt halten und
die kurze Zeit
Ohne Furcht verbringen
Auch ohne Gewalt auskommen
Böses mit Gutem vergelten
Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern
vergessen
Gilt für weise.
Alles das kann ich nicht:
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!
Aus: Bertolt Brecht, An die Nachgeborenen
In den Siebzigerjahren war Wien eine unfreundliche und graue Stadt. Zumindest für mich. Ich lebte damals im Arbeiterbezirk Favoriten. An sich ein schöner Bezirk, doch die Last des Alltags war den Menschen anzusehen und sorgte für eine bedrückende Stimmung.
An gefühlt jedem dritten Fenster lehnte ein alter Mensch und pöbelte lautstark auf uns Kinder herab: „Wenn das alle machen würden, wie sähe unsere Stadt dann aus?“ Dabei hatten wir doch gar nichts gemacht. Wir turnten nur auf den Teppichklopfstangen oder malten mit Kreide den Parcours für Himmel und Hölle auf den Gehweg, den wir dann hüpfend bezwangen. Das passte diesen grantigen Menschen nicht.
Wien fühlte sich zu dieser Zeit an, als wären alle zutiefst unzufrieden: ein guter Nährboden für Verbrechen jeder Art. Damals war Wien auch noch eine Spionagehochburg. Das letzte Bollwerk zum dunklen Osten.
Als Kind hatte ich das Gefühl, als bewegten sich die Menschen nicht aufrecht gehend, sondern als schlichen sie geduckt durch die dunklen Gassen. Für mich war Wien eine Stadt voll bedrohlicher Geheimnisse.
Und da war noch mehr. Überspitzt könnte man sagen: Leichen pflasterten meinen Schulweg. Jeden Morgen hatte ich eine kleine Prüfung zu bestehen. Mein Weg führte mich an einer Bäckerei vorbei, aus der es immer verführerisch duftete. Manchmal konnte ich nicht widerstehen und kaufte mir von meinem Taschengeld eine Schaumrolle oder Biskotten, gefüllt mit Schokoladenbuttercreme. Köstlich!
Doch nur ein paar Hundert Meter weiter, an einer schäbigen Ecke, lag ein Wirtshaus. Nicht selten war die Kreuzung von einem Aufgebot an Polizisten bevölkert, die wegen einer Schlägerei zum Einsatz gekommen waren. Und einmal lag sogar eine Leiche vor dem Eingang, notdürftig bedeckt mit Packpapier. Eine Messerstecherei war der Grund für das schaurige Ende dieses Gastes. Eine Blutspur auf dem Trottoir zeugte von der tödlichen Attacke.
Ein anderes Mal fuhr ich mit der Straßenbahn zurück nach Hause. An der Haltestelle Südtirolerplatz öffneten sich die Türen der Straßenbahn. Ganz hinten wollte ein junger Mann aussteigen. Doch plötzlich fiel er in sich zusammen und stürzte aus dem Wagen auf die Straße. Ein Mann hatte auf ihn geschossen und rannte sogleich davon. Die Türen schlossen sich, die Straßenbahn fuhr weiter. Alles ging so schnell, dass ich erst später realisierte, was da gerade Schreckliches passiert war.
Warum mussten diese beiden Menschen ihr Leben lassen?
Was ging diesen Verbrechen voraus?
War der Grund ein geplatztes, windiges Geschäft, war es verletzter Stolz, war es Eifersucht, oder einfach „nur“ ein „Unfall“, durch den diese Männer ihr Ende auf dem kalten Boden fanden?
Es ist schon interessant, dass ein Verbrechen sofort unsere Fantasie ankurbelt und wir uns die wüstesten Geschichten ausdenken. Es ist aber auch spannend, darüber nachzudenken, was letztendlich den Ausschlag dafür gibt, dass jemand das fünfte Gebot, „du sollst nicht töten“, bricht. Es ist sicher nicht leicht, jemanden zu töten. Auch, wenn es in Filmen manchmal so aussieht.
Die schaurige Lust an Verbrechen scheint Hochkonjunktur zu haben. Auf fast allen Fernsehkanälen laufen Krimis en masse. Seit einigen Jahren trage ich als „Tatort“-Kommissarin dazu bei, dass Verbrecher ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Mein Kollege Harald Krassnitzer und ich sind dabei ziemlich erfolgreich, zumindest virtuell.
Unlängst hatte ich Freunde zu Besuch, natürlich haben wir auch über den letzthin ausgestrahlten „Tatort“ gesprochen. Da meinte meine Freundin: „Die Aufklärung eines Verbrechens ist wie Ostereier suchen. Ähnlich spannend, aber ein Ei findet sich halt doch leichter als ein Täter.“
Ein kühner Vergleich – aber wenn man sich manche Verbrecher ansieht, erscheinen sie manchmal so unschuldig wie ein Ei, oder zumindest geben sie vor, unschuldig zu sein.
Sieht man Verbrechen in Gesichter geschrieben?
In einer – durchaus umstrittenen – Studie aus dem Jahr 2016 soll es zwei KI-Forschern der Universität Schanghai, Xiaolin Wu und Xi Zhang, gelungen sein, mit einem Computerprogramm anhand von Fotos der Gesichter von Personen die Wahrscheinlichkeit zu erkennen, ob jemand kriminell ist.
Eine gruselige Vorstellung, wenn wir aufgrund eines Algorithmus plötzlich in polizeilichen Gewahrsam genommen werden, weil wir angeblich ein Verbrechen planen oder schon ausgeführt haben – und dabei vielleicht nur einen schlechten Tag hatten, oder Magenkrämpfe, weshalb wir grimmig dreinschauen, woraufhin das Computerprogramm uns zu Kriminellen abstempelt. Im Wien der Siebzigerjahre wäre da womöglich jede zweite Person hinter Schloss und Riegel gekommen.
Wie wird man kriminell? So simpel diese Frage scheint, so komplex sind oft die Hintergründe. Es ist die psychologische Ebene, die mich in der Auseinandersetzung mit einzelnen Fällen und Stoffen besonders interessiert. Kein Mensch ist per se schlecht. Ich glaube, der Schritt zum Bösen geht über einen sehr, sehr schmalen Grat. Manchmal wird eine Person vielleicht auch erst schlecht gemacht, durch Umstände, gesellschaftlichen Druck.
Damals, in der Tristesse der Nachkriegszeit, könnte auch die Erziehung eine Rolle gespielt haben. Erziehung war ja noch stark mit Brutalität, mit Drohungen und mit martialischen Strafen verbunden. Kinder zu schlagen stand auf der Tagesordnung. Regiert wurde mit Angst: der Schrecken vor dem Lehrer, vor dem Pfarrer, und warte nur, bis der Vater nach Hause kommt!
Zur Vorbereitung für meine Rolle als „Tatort“-Kommissarin haben mein Kollege und ich an einem Trainingsprogramm der österreichischen Spezialeinheit Cobra teilgenommen. Diese Einheit wird nur gerufen, wenn es zu einer scheinbar ausweglosen Situation kommt. Die Aufgabe der Cobra besteht darin, erfolgreich zu sein, denn nach ihr gibt es keine Instanz, keine Einheit mehr, die in der Lage wäre, einen extrem gefährlichen Konflikt zu lösen. Diese Verantwortung muss man sich mal vorstellen, und die psychische Belastung, der diese Einheit ausgesetzt sein muss.
Am Ende des Trainingstages konnten wir auch mit scharfer Munition auf Pappfiguren schießen. Meine Hände waren zittrig und schweißnass aufgrund meiner schier unüberwindbaren Scheu, auf einen „Menschen“ schießen zu müssen. Interessant: Die Schablonen stellten nur Männer dar.
Ich bin froh, gefährlichen Situationen nur in der Fiktion ausgeliefert zu sein, in der Realität wäre ich solch schrecklichen Herausforderungen wahrscheinlich nicht gewachsen.
Früher, als es meine Zeit noch erlaubte, saß ich gerne in Kaffeehäusern und beobachtete Menschen. Mit großem Vergnügen versuchte ich mir auszumalen, was der eine oder die andere wohl beruflich macht. Oder wie die Beziehung dieses Paares, das sich kaum unterhielt, geschweige denn ansah, wohl sein mochte. Würde diese Beziehung halten, oder standen sie schon kurz vor dem Ende? Viele Verbrechen geschehen aus Eifersucht oder verletzter Liebe. Oder – leider hat sich daran noch immer nichts geändert – aus purem Frauenhass, wie die erschreckend große Zahl an Femiziden zeigt.
Betrachten wir die Fotos in diesem Buch, werden wir vielleicht Muster erkennen, oder erschüttert sein, wie belanglos manchmal die Beweggründe für eine Straftat sind. Es ist jedenfalls spannend und erzählt uns auch viel über vergangene Zeiten, obwohl menschliches Unvermögen sich über Jahrhunderte nicht zu ändern scheint.
Beim „Tatort“ achten die Drehbuchschreiber, Regisseurinnen und wir Schauspielende stark darauf, dass die Fälle einen realen Bezug haben und sich mit Themen auseinandersetzen, die uns und die Gesellschaft beschäftigen. Dabei stimmt die Binsenweisheit: Das Leben schreibt viel grausamere und absurdere Geschichten, als man sie sich jemals ausdenken könnte – das zeigen gerade auch die Fälle in diesem Buch. Zugleich sind sie auf bestimmte Weise immer auch ein Spiegel einer Gesellschaft, eines Zeitgeistes, und der Probleme, die sich hinter den Fassaden verstecken.
Die 1946 gegründete Fotoagentur Votava, heute Teil des Archivs von brandstaetter images, beinhaltet neben politischen und zeitgeschichtlichen Themen auch eine umfassende Dokumentation der Kriminalgeschichte. Zusätzlich zu den Aufnahmen selbst gibt die Beschriftung der Rückseite der Fotografien oft tiefe Einblicke in das Geschehen.
Lokalaugenschein im Rahmen des Prozesses wegen des sogenannten „Senkgruben-Mordes“ im Erziehungsheim Lindenhof der Stadt Wien im März 1970. Zwei Heimkinder hatten zwei Heimkollegen mit einer Axt erschlagen und in einer Jauchegrube versteckt. Der Lindenhof galt nicht nur als „Endstation“ für besonders „schwer erziehbare“, meist zuvor straffällig gewordene Jugendliche. Misshandlungen vonseiten der Erziehenden sollen in der als „Horrorheim“ bekannten Anstalt in den 1960er- und 1970er-Jahren an der Tagesordnung gestanden sein.
DER SCHNÖDE MAMMON
Für den schnellen Zaster über Leichen gehen – zwar kein edles Motiv, aber für viele doch ein verständliches. Trotzdem schrecken die meisten vor einer solchen Tat zurück, und nur ein Bruchteil zieht diese kompromisslose Form der Geldbeschaffung durch: als einmalige Gelegenheit, um aus einer Notsituation zu gelangen, oder serienmäßig, damit ein gewisser Lebensstandard gehalten werden kann; durchgeplant und kalkuliert, die Spuren stets verwischend und der Polizei einen Schritt voraus; oder plump und brutal, ohne einen längerfristigen Plan – eher darauf angelegt, irgendwann erwischt zu werden, damit der Spuk eine Ende nimmt.
ADRIENNE ECKHARDT: DIE FLEISCHWOLFMÖRDERIN
23. November 1952, spätnachts: Johann Arthold, ehemaliger König des Wiener Schleichhandels, liegt tot auf dem Steinboden in seinem eigenen Delikatessenladen: furchtbar zugerichtet, in einer riesigen Blutlache, neben einer umgeworfenen Holzkiste Bier. Sein Schädel ist zertrümmert, der Hals durchgeschnitten, sein Schlund offen. In jenem zwielichtigen Milieu, in dem Arthold sich herumtrieb, folgt auf den schnellen Aufstieg oft der tiefe Fall – das ist keine Neuigkeit. Doch mit der vagen Rahmenhandlung eines Film noir made in Wien wollen sich die Beamten nicht zufriedengeben: Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen bereits auf Hochtouren.
Johann Arthold kam 1908 als Sohn eines Kleinbauern in Prinzendorf, einer Ortschaft 60 Kilometer nordöstlich von Wien, zur Welt. Im Wien der Nachkriegsjahre entpuppte er sich als geschickter Schleichhändler und gelang innerhalb kurzer Zeit zu einem ansehnlichen Vermögen: Er hatte seinen eigenen Delikatessenladen an der Ecke Alser Straße / Lange Gasse im 8. Bezirk und war der ganzen Stadt für seine billigen Preise bekannt, die er aufgrund nebulöser Zusammenarbeit mit den Besatzungsmächten am Schwarzmarkt und im Schmuggel gewährleisten konnte – insbesondere für die Cadbury-Schokolade, die er im großen Stil verkaufte: Bald wurde Arthold überall „Cadbury-König“ genannt.
Der Vater zweier Kinder, der – eigentlich – mit seiner Frau Katharina Arthold in der Schottenfeldgasse 56 wohnte, hielt nicht viel davon, Geld auf die Seite zu legen, der lebenslustige und trinkfreudige Hallodri vergnügte sich lieber: Arthold baute sich seinen eigenen Rennstall auf, streifte durch einschlägige Etablissements und lebte in Saus und Braus mit mehr Freundinnen als Hausdienern. Die jungen Damen umwarben ihn: nicht unbedingt, weil er 1,65 Meter und eher mäßig attraktiv war, sondern weil er Nylonstrümpfe, schöne Kleider und Lebensmittel im hungernden Trümmer-Wien besorgen konnte. Arthold galt als „Schieber“, als durchaus nennenswerte Nummer in der Wiener Unterwelt. Doch das Glück war nicht von ewiger Dauer – weder sein finanzielles noch sein existenzielles.
Seinen Höhepunkt hatte Arthold bereits um 1950 erreicht, danach musste der „Cadbury-König“ das Zepter abgeben: Er hatte mehr Geld in seinen hedonistischen Lebensstil als in sein Geschäft gesteckt, sich selbst überschätzt und seine Ausgaben zum eigenen Vergnügen übersehen. Zudem hatte sich das Geschäftsleben um den „Schleich“, den Schwarzhandel, verändert: Arthold musste seinen Reitstall verkaufen, Angestellte entlassen und seinen Privatchauffeur kündigen. Jux und Tollerei mit jungen Damen waren dem mittlerweile verarmten Greißler dennoch wichtig – und sei es nur, um den vergangenen Schein zu bewahren. Seinen Delikatessenladen hatte er bereits abgeben müssen, um in ein kleineres Geschäft ein paar Meter weiter zu ziehen: in die Alser Straße 7a, direkt in den Seitentrakt vom Landesgericht für Strafsachen Wien.
Im „Offiziellen Jahrbuch des Unterstützungsinstitutes der Bundes-Sicherheitswache 1960“ wird Artholds Abstieg so zusammengefasst: „Ebenso rasch wie er sein Geld gewonnen hatte, hatte er es wieder verloren, als es im Schleichhandel in seiner Sparte nichts mehr zu verdienen gab. Er führte sein Delikatessengeschäft nur mehr schlecht und recht; […] Arthold konnte sich in die neuen Verhältnisse nicht mehr hineinfinden, seine Frau musste mit Geldmitteln einspringen, um ihm sein Geschäft zu erhalten. Trotzdem war Arthold noch weiterhin Gast bei Heurigen und in Nachtlokalen.“
Am Samstag, dem 22. November 1952, ging ein Ordnungshüter vom Landesgericht gegen ein Uhr nachts seine Runden. Beim Geschäft des ehemaligen Schokoladenkönigs merkte er, dass der Rollbalken unverschlossen und einen Dreiviertelmeter in der Höhe war, fand das aber nicht weiter ungewöhnlich: Den Nachtwächtern war bekannt, dass Arthold nach seinen Lokalbesuchen dort noch gelegentlich eine Jause und ein Bier in Begleitung zu sich nahm. Verdächtig schien ihm lediglich, dass im Geschäft kein Licht brannte. Der Wächter vermutete einen Einbruch und kontrollierte den Laden – um im Nebenraum ein schauderhaftes Szenario vorzufinden: den übel zugerichteten 44-jährigen Johann Arthold, der sich nicht mehr rührte.
Ermittlungen brachten zutage, dass der Wachmann bereits um 23.32 Uhr auf seiner Kontrollrunde an Artholds Geschäft vorbeigekommen war – da waren die Rollbalken allerdings verschlossen gewesen. Die Tat musste also in der kurzen Zwischenzeit passiert sein. Die Untersuchung des Tatorts wies nicht auf einen Einbruch hin, sondern darauf, dass Arthold mit seinem Mörder im Geschäft gesessen und dieser nach der Ermordung noch Hände und Kleidungsstücke gereinigt hatte.
In Artholds Tasche wurden zwei Straßenbahnfahrscheine gefunden, die beide kurz vor der Tat, Freitagnacht zwischen 23 und 24 Uhr, in der 38er-Bim – der Straßenbahnlinie 38 – von Grinzing Richtung Innenstadt entwertet worden waren. Am nächsten Tag wurden sämtliche Straßenbahnfahrer und -schaffner aufgespürt, die ihn möglicherweise noch gesehen haben könnten – und da zu so später Stunde nur mehr wenige Passagiere unterwegs waren, konnte sich eine Schaffnerin tatsächlich an einen Herrn erinnern, dessen Beschreibung auf Arthold zutraf: Sie bestätigte, dass er in der fraglichen Zeit in Grinzing zugestiegen war, und zwar in Begleitung einer jungen Dame.
Der Polizist, der die Leiche von Johann Arthold gefunden hat, vor dem Feinkostgeschäft des Opfers.
Der Heurige Maly, in dem Opfer und Täterin vor dem Mord noch gemütlich ihre Vierteln Wein getrunken haben.
Das Nachtlokal, in dem Johann Arthold seine Mörderin traf.
Eine gute Spur, aber die Polizei gab dennoch eine Zeitungsanzeige auf, um die Bevölkerung um Mithilfe zu bitten, anhand der detaillierten Aussagen der Schaffnerin Artholds Begleiterin zu identifizieren: 1,60 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, schlank, mit blassem Teint, grellrot geschminkten Lippen, schönen Zähnen, glattem, blondem Haar. Eine braune Panofix-Pelzjacke hatte sie getragen, dazu Nylonstrümpfe und braune Sämischschuhe mit niedrigen Absätzen.
Erhebungen in Grinzing führten zur Gewissheit, dass die beiden von 20 bis 23 Uhr beim Heurigen Maly in der Sandgasse 8 einen gemütlichen Abend mit sieben Vierteln Wein verbracht hatten. Nach der Straßenbahnfahrt besuchten sie im 9. Bezirk noch ein Café, und ein Zeuge im 8. Bezirk konnte bestätigen, dass zwei Menschen in der Nacht Artholds Geschäft gemeinsam betreten hatten. Außerdem hatte Arthold vorgehabt, am 22. November einen Schuldbetrag von 6000 Schilling abzuzahlen und am selben Tag von anderer Quelle ein Darlehen von über 10 000 Schilling aufzunehmen.
Die Polizei fahndete aufgrund der Brutalität des Mordes – es handelte sich immerhin um 40 Hiebe mit einem schweren Gegenstand samt Kehlendurchschnitt – nach einem männlichen Täter, wahrscheinlich aus dem Geschäftsumfeld des Opfers. Die blonde Dame wurde zwar gesucht, aber als Zeugin oder höchstens mögliche Komplizin geführt.
Am 23. November klapperten Beamte Artholds Stammlokale ab – und landeten bald im Rotlichtmilieu. Im Nachtlokal Filmhof in der Neubaugasse wurden die Ermittelnden besonders hellhörig: Zwei Bardamen konnten sich gut an Arthold erinnern – und auch daran, dass eine Kollegin namens Adrienne Eckhardt, eine 23-jährige Säuglingsschwester und Kinderpflegerin, die im Café als Animierdame arbeitete, in letzter Zeit viel mit ihm unterwegs gewesen war.
Eine andere Quelle meint, dass Kommissar Zufall Regie geführt habe und zwei Prostituierte, die wegen eines Diebstahls festgenommen worden waren, die nötigen Hinweise gegeben hatten. Sinngemäß sollen diese gesagt haben: „Um jeden Dreck kümmert’s ihr Kieberer euch, aber um den Mord an Arthold nicht!“ Die Beamten fragten nach, bis die beiden Dirnen ein Mädchen erwähnten, das im Café Filmhof verkehrte und mit Arthold gut bekannt sei.
Wie auch immer: Die Beamten besuchten Adrienne Eckhardt in der Neustiftgasse 54, wo sie bei einem ehemaligen Artisten auf Untermiete wohnte. Nicht nur war sie blond, schlank und im richtigen Alter, es konnten auch an ihrer Pelzjacke und an ihren Schuhen Blutflecken sichergestellt werden: Noch am selben Tag wurde sie verhaftet. Zuerst bestritt sie jeglichen Zusammenhang mit der Tat, doch mit den Blutspuren konfrontiert, brach sie in Tränen aus und erzählte, wie alles abgelaufen war – in ihrer ersten Version. Ja, sie wäre bei Arthold im Geschäft gewesen, und ja, sie hätten gemütlich gemeinsam getrunken, bis es plötzlich an der Eingangstür klopfte. Auf Geheiß Artholds habe sie aufgemacht, und ein 1,75 Meter großer, schlanker Mann in einem Dufflecoat mit Kapuze (ein damals äußerst moderner Mantel, den jeder trug, der es sich leisten konnte, und der durch Graham Greenes Filmklassiker „Der dritte Mann“ Kultstatus erlangt hatte) begrüßte den „Cadbury-König“ mit den Worten: „Servus, alter Gauner!“
DIE BLONDE DAME WURDE ZWAR GESUCHT, ABER ALS ZEUGIN ODER HÖCHSTENS MÖGLICHE KOMPLIZIN GEFÜHRT.
Arthold schien den späten Besucher also zu kennen, ihr war er gänzlich unbekannt. Der Neuankömmling setzte sich dazu, sie palaverten dahin und tranken ihr Bier. Dann habe der mysteriöse Mann im Dufflecoat plötzlich eine Schuldenrückzahlung von Arthold gefordert – der habe beteuert, er wäre momentan nicht liquide, was mit den bisherigen Ermittlungsarbeiten übereinstimmte: des entthronten Königs ständiges Jonglieren mit verschiedenen Darlehen und Rückzahlungen.
Im Zuge dieses Disputs soll der Schuldeneintreiber plötzlich einen Gegenstand aus seiner Tasche gezogen und Arthold damit niedergeschlagen haben. Danach habe er Eckhardt befohlen, Artholds Körper umzudrehen – daher die Blutspuren. Anschließend habe er sie gezwungen, ein Messer zu holen, mit dem er auf Arthold eingestochen habe; danach hatte sie es zu reinigen, woraufhin er sie angeschnauzt habe, zu verschwinden. Der Mörder sei allein zurückgeblieben.
Warum sie nicht sofort zur Polizei gegangen sei? Weil sie bereits wegen Betrugs eine Vorstrafe ausgefasst hatte und ihr ohnehin niemand glauben würde, sagte Eckhardt schluchzend. Die Beamten blieben skeptisch, konnten aber weder ihre Aussagen widerlegen noch die Tatwaffe sicherstellen. Dafür wurde eine Fahndung nach dem ominösen Herrn im Dufflecoat eingeleitet. Dieser unbekannte „Mr. Dufflecoat“ löste in der Bevölkerung eine wahre Hysterie aus: Jeder Zweite glaubte, den Bösewicht gesehen zu haben, und alarmierte die Polizei – die aber irgendwann einsah, dass der Täter wohl nicht so unbedarft wäre, im gesuchten Outfit durch Wien zu spazieren. Meldungen kamen auch aus Haftanstalten, wo Insassen meinten, die Identität des gesuchten Herrn mit Sicherheit zu kennen: womöglich eine willkommene Abwechslung im tristen Gefängnisalltag.
Bald stellte sich heraus, dass nicht nur Arthold in finanziellen Nöten war – sondern viel mehr noch Eckhardt: Sie verdiente kaum Geld im Etablissement Filmhof, weil sie nicht mit Freiern aufs Zimmer ging, sondern als reine „Animierdame“ arbeitete. So war sie schon oft im Pfandhaus gelandet, um persönliche Gegenstände zu versetzen: das letzte Mal nur wenige Stunden vor der Ermordung Artholds. Komischerweise aber konnte sie bereits am Folgetag ins „Pfandl“ gehen, um eine ihrer Uhren auszulösen, und Lebensmittel für mehrere Tage kaufen. Als die Polizei Eckhardts Wohnung durchsuchte, wurde zudem eine beträchtliche Menge Waren aus Artholds Delikatessenladen sichergestellt.
Sie sah sich nun zu Teilgeständnissen gezwungen, doch zugegeben wurde nur, was keinesfalls mehr abgestritten werden konnte. Eckhardt gab an, der Mann im Dufflecoat habe sie unter Androhung ihrer Ermordung dazu gezwungen, Geld aus der Kassa und Lebensmittel mitzunehmen, um die missglückte Schuldeneintreibung wie einen Raubmord aussehen zu lassen. Gemordet hätte aber der Eindringling – nicht sie. Die Beamten kamen mit Eckhardt nicht weiter und bissen sich an ihren verschiedenen Versionen die Zähne aus. Man ließ das Verhör vorerst Verhör sein.
Am 2. Dezember 1952 wurde Johann Arthold unter den Augen von tausend Schaulustigen, zahlreichen Journalisten und einigen wenigen wirklich Trauernden am Zentralfriedhof beigesetzt. Zwei Tage danach soll Hofrat Dr. Heger, ein alter Fuchs, Eckhardt in einem Verhör die scheinbar harmlose Frage gestellt haben, ob sie das Licht im Delikatessenladen abgedreht habe, bevor sie gegangen war: Sie antwortete mit einem klaren „Ja“ – und war damit in die Falle getappt: Denn wie sollte sich der zurückgelassene Mr. X im Dufflecoat allein im Dunkeln zurechtgefunden haben?
Reporter beim Prozess gegen Adrienne Eckhardt im Wiener Landesgericht.
Die Schlinge um Eckhardts Hals wurde enger, und am 4. Dezember 1952 – nach intensiven Verhören über fast zwei Wochen – legte sie ein Geständnis ab: Ihr Opfer hatte sie bereits als junges Mäderl kennengelernt, weil sie in der Nähe seines alten Geschäfts gewohnt hatte und mit ihrer Mutter oft bei ihm einkaufen war. „Mein Engerl“ habe er sie genannt und sie getätschelt, während er ihr eine Tafel Cadbury zusteckte. Als sie später – nunmehr ein junges Fräulein ohne mütterliche Begleitung – in den Laden ging, bekam sie keine Schokolade mehr, sondern Nylonstrümpfe und wurde zu Feiern und Pferderennen eingeladen. Sexuell lief nie etwas zwischen den beiden, beteuerte sie, eher diente die junge Begleiterin dem gesetzten Herrn zum Eindruckschinden, wenn er bei Rennbahnbesuchen dubiose Geschäfte einfädelte.





























