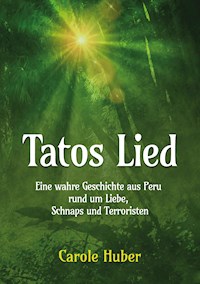
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Werner ist deutscher Abstammung, wächst aber im tiefen peruanischen Dschungel auf. Schon in seiner Kindheit macht er erste Erfahrungen mit Alkohol und Koka. Seine Eltern meinen, nur eine Frau könne ihn ändern. Ilse, die Tochter der Dorfschullehrerin, ist wissbegierig und voller Pläne. Als sie sich in den fröhlichen, hilfsbereiten Werner verliebt, hat sie keine Ahnung von dessen Problemen. Mitten im Kampf um ihre Beziehung kommt eine neue Herausforderung hinzu: Die Guerilleros des Leuchtenden Pfades sind ins Tal eingedrungen ... Eine wahre Geschichte rund um Hass, Sucht und Terror - aber auch um Gottes befreiende Kraft. www.TatosLied.com
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
Werner: Juni 1967
1. Werner: September 1953 - Januar 1974
2. Ilse: Oktober 1957 - März 1977
3. Werner: Februar 1974 - Januar 1979
4. Ilse: April 1977 - Januar 1983
5. Werner: Januar 1983
6. Ilse: Januar 1983 - Dezember 1985
7. Werner: Januar 1983 - Dezember 1985
8. Ilse: Januar 1986 - Oktober 1989
9. Werner: Januar 1986 - April 1987
Teil 2
Ilse: 22. November 1989
10. Werner: 23. November 1989
11. Ilse: 23. November 1989
12. Werner: 23. November - 30. November 1989
13. Ilse: 23. November - 2. Dezember 1989
14. Werner: 1.-6. Dezember 1989
Teil 3
Werner: Januar 1990
15. Ilse: Dezember 1989 - Mai 1992
16. Werner: Januar 1990 - August 1992
17. Ilse: August 1992 - Dezember 1993
18. Werner: Dezember 1993 - Dezember 2001
19. Ilse: Januar 1994 - Dezember 2003
20. Werner: Mai 2002 - Januar 2007
21. Ilse: Dezember 2003 - September 2009
22. Werner: Januar 2007 - Juni 2015
23. Ilse: Oktober 2009 - Juni 2015
Hinweis zu den Koka-Blättern
Namensverzeichnis (nicht vollständig)
Namensverzeichnis (nicht vollständig)
Teil 1
Werner
Juni 1967
In San Ramón gab es einen Flughafen, wo verschiedene kleine Gesellschaften ihre Lufttaxi-Dienste anboten. Sie flogen verschiedene Routen und transportierten Fracht und Passagiere in die verschiedensten Gegenden des peruanischen Urwalds. Die Ladung wurde gewogen, wobei das erlaubte Gewicht etwa dem von fünf Erwachsenen entsprechen durfte. Neben Personen wurden Zucker, Salz, Stoff, Haushaltsartikel, Post befördert - einfach alles, was die wenigen Siedler und Einheimischen, die dort lebten, benötigten. Genaue Abflugzeiten gab es nicht. Man startete, sobald alles bereit war und das Wetter es zuliess. Die Piloten brachten die Motoren zum Laufen, indem sie die Propeller von Hand kräftig nach unten schwangen. War dies erst einmal gelungen, erfüllte ein ohrenbetäubender Lärm den kleinen Platz.
Fasziniert schaute ich dem bunten Treiben zu, bis mich mein Vater am Ärmel zog. „Komm, wir können einsteigen!“, meinte er. Er nahm den letzten Schluck aus seiner Bierflasche, wir kletterten in die kleine Kabine, und das Abenteuer meiner ersten Reise nach Iscozacín begann ...
Der Flug dauerte etwa eine halbe Stunde und war etwas vom Schönsten, was ich je erlebt hatte: Von oben sah der Dschungel aus wie eine einzige smaragdgrüne, moosartige Fläche, durchzogen von türkisblauen Flüssen und Bächen. Darüber erhob sich der blaue Himmel, wobei nur weit entfernt ein paar Wolken zu sehen waren. Ab und zu erblickte ich unter mir eine Lichtung mit den Dächern einer Siedlung oder ein paar Indianerhütten.
Ich hätte stundenlang so weiterfliegen können, doch bereits kam die Landebahn in Sicht. Nun wurden alle ein bisschen nervös, denn das Landen auf einer mit vielen Löchern und Steinen übersäten Piste birgt immer ein gewisses Risiko in sich. Noch konnten wir nicht niedergehen, da sich einige Kühe auf dem Landestreifen befanden. So drehten wir eine weitere Runde in der Luft, damit man das Vieh wegtreiben konnte. Endlich wurde am Boden ein weisses Leintuch geschwenkt. Als der Pilot tatsächlich zur Landung ansetzte, bekreuzigte ich mich und war froh, als wir gut gelandet waren.
Seit vielen Jahren besass mein Vater ein Stück Land am Fluss Palcazú. Ab und zu reiste er für ein paar Wochen hin, um nach dem Rechten zu sehen und zu arbeiten. Ich war nun vierzehn Jahre alt und zum ersten Mal durfte ich ihn begleiten. Er hatte mir erklärt, dass wir nach dem Vieh sehen, die Nabel von neugeborenen Kälbern desinfizieren, Stiere kastrieren und mit der Machete das Gras und die Büsche zurückstutzen würden. Ich freute mich darauf, dies alles zu lernen.
Das kleine Dorf Iscozacín bestand nur aus wenigen Häusern. Doch die Landepiste und seine Lage an einer wichtigen Flussgabelung machten es zu einem wichtigen Ausgangspunkt für alle, die in dieser Gegend unterwegs waren. In Iscozacín befanden sich die einzige Grundschule des ganzen Tals, ein Laden, eine Schlachterei und ein Lagerhaus, wo man für ein kleines Entgelt Waren, Lebensmittel oder Einrichtungsgegenstände aufbewahren konnte, bevor sie ausgeflogen oder mit kleinen Booten weitertransportiert wurden.
Kaum angekommen, wurden wir von Máximo, einem Freund meines Vaters, begrüsst. Er würde uns mit seinem Boot flussaufwärts zu unserem Grundstück mitnehmen. Schnell luden wir unsere Habseligkeiten ins Boot. Es war bereits Nachmittag und wir wollten die zwei Stunden Flussfahrt möglichst noch bei Tageslicht schaffen. Wir hatten nur Salz, Zucker, Batterien und Patronen für die Jagd dabei. Als Kleider reichten ein Paar zusätzliche Shorts und zwei Hemden. Máximo bediente den Aussenbordmotor im Heck und hielt meinen Vater über die Ereignisse der Gegend auf dem Laufenden. Währenddessen setzte ich mich vorne in den Bug und bestaunte die einmalige Natur.
War der Urwald vom Flugzeug aus beeindruckend gewesen, vom Fluss aus faszinierte er noch viel mehr! Der Dschungel bot einen überwältigenden Anblick. Am Ufer standen eine Vielfalt an Bäumen: einige hingen wie Schirme weit über das Wasser, andere hatten wunderschöne gelbe Blüten, wieder andere beeindruckten durch ihre immense Grösse. Die meisten von ihnen waren bewachsen mit verschiedensten Lianen, Moosen und Bromelien.
Ich bewunderte den Schwarm weisser Reiher, die aufgescheucht vor uns über den Fluss flogen, lächelte über die Wasserschildkröten, die sich der Reihe nach von einer Baumwurzel ins Wasser plumpsen liessen, und hielt den Atem an, als ich ein paar riesige, gut getarnte Kaimane entdeckte, die sich am Ufer auf einer Sandbank sonnten. „Die sind harmlos“, rief mein Vater, als er meinen Blick sah. „Wenn du ihnen nichts tust, tun sie dir auch nichts.“
Auf einmal stellte Máximo den Motor ab und hob ihn aus dem Wasser. Jetzt, in der Trockenzeit, führte der Fluss stellenweise sehr wenig Wasser und der Propeller konnte sich in den Wasserpflanzen verheddern oder von den Steinen beschädigt werden. So stiegen wir aus und schoben und zogen das Boot über die seichte Stelle. Dann fuhren wir weiter. Da wir dies immer wieder tun mussten, verloren wir viel Zeit, kamen aber gerade noch vor dem Eindunkeln an.
In der Stille des Dschungels ist das Dröhnen eines Motors weitherum zu hören. Deshalb stand Oscar, Vaters Aufseher, bereits am Ufer und hiess uns willkommen. Während er uns half, das Gepäck zur Hütte zu tragen, tauschten er und mein Vater schon mal die wichtigsten Neuigkeiten aus.
Ich sah Máximo zu, wie er das Boot wendete und davonfuhr. Dann nahm ich meine Tasche und stieg ebenfalls zur Hütte empor, die sich in etwa vierzig Meter Entfernung vom Flussufer befand. Sie war aus Palmenholz und stand auf Stelzen nach der Art, wie die Einheimischen zu bauen pflegten. Wände gab es keine und das Dach bestand aus geflochtenen Palmwedeln. In der Mitte stand ein einfacher Tisch und am Rand lagen ein paar Kisten. Betten und andere Einrichtungsgegenstände entdeckte ich nicht. Wir schliefen auf dem Bretterboden, gegen die wenigen Moskitos würde der Rauch des Lagerfeuers reichen. Gleich angrenzend an die „Schlafhütte“ befand sich die „Kochhütte“, an deren Rand einige Blechdosen mit den wichtigsten Lebensmittelvorräten lagen. Diese Hütte befand sich direkt auf dem Erdboden und verfügte über eine Feuerstelle, wo Oscar gerade frisch zubereitete Chipanados aus dem Feuer holte. Für Chipanados werden Fische zusammen mit Kräutern in grosse Pflanzenblätter eingewickelt, mit Lianen zusammengebunden und im Feuer gegart. Die Zubereitung dieses Leckerbissens haben die Siedler den einheimischen Indianern abgeschaut.
Danach gab es gebratenes Wildschwein mit gekochter Yuca, einer Wurzelknolle, die in den Tropen wächst. Es war einfach herrlich, mit gekreuzten Beinen am Lagerfeuer zu sitzen und beim Nachtkonzert des Urwalds genüsslich die Knochen abzunagen. Bald würden wir uns schlafen legen. Doch zuvor fragte Oscar: „Möchtet ihr noch eine Runde Masato trinken?“ Mein Vater nickte, und obwohl ich das Getränk nicht kannte, hielt ich Oscar meinen Becher ebenfalls hin.
Neugierig probierte ich ein bisschen von dem dickflüssigen Gebräu. Zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass es ein alkoholisches Getränk war. Fragend blickte ich meinen Vater an, aber er schaute weg und füllte seinen Becher nach. Also tat ich es ihm gleich. Und so nahm am schönsten Fleck der Erde der Teufelskreis, der mein Leben bestimmen sollte, seinen Lauf.
1
Werner
September 1953 - Januar 1974
Ich bin am 9. September 1953 auf dem Gut Palomar im peruanischen Kaffeeanbaugebiet von Villa Rica zur Welt gekommen. Meine Eltern heissen Helmut Noche Pitsch und Josefa Schuler Egg, Nachkommen von deutsch-österreichischen Auswanderern. Ich kann aber kein Wort Deutsch, denn mein Vater hat es mir nie beigebracht. Ich bin das fünfte von sieben Geschwistern: Elsa, Herta, Helmut, Gerhard, ich, Margot und Inge.
„Chichi, Chichi! Wo bist du?“, rief Elsa und Herta schrie „Werner!“ Wenn es ernst galt, nannte sie mich immer bei meinem richtigen Namen. An meine ersten sechs Lebensjahre kann ich mich nicht gut erinnern. Von meinen älteren Geschwistern weiss ich, dass ich immer sehr früh aufstand, stets fröhlich war und ständig Melodien pfiff. Und das Wichtigste: Ich liebte die Natur! Oft mussten mich meine Schwestern am Morgen suchen, weil ich nicht mehr in meinem Bettchen lag. Schliesslich entdeckte mich Elsa im Garten unserer Nachbarn, der Familie Flores. Die Flores waren Kaffeebauern wie wir und ihr Hof befand sich etwa dreihundert Meter vom unsrigen entfernt. Sie hatten neun Kinder etwa in unserem Alter, alles Jungs und zwei Mädchen. „Schau, der schöne Schmetterling!“ Ich stand vor einem Orangenbäumchen und bewunderte den leuchtend roten Falter, der gerade auf einer duftenden Blüte Halt gemacht hatte. „Du bist ja nicht einmal richtig angezogen!“, schimpfte meine Schwester. Sie nahm meine Hand und zerrte mich nach Hause, wo Mama mit dem Frühstück auf uns wartete.
Wie jeden Morgen gab es selbstgebackenes Brot, Milch, Eier und gebratene Yuca oder Kochbananen. Ich streckte Mutter meinen Blechteller hin. Unter dem strahlend weissen Email klaffte ein rostiger Fleck hervor. Doch nachdem Mama geschöpft hatte, sah man diesen nicht mehr. Als einziges Besteck dienten uns Löffel; Messer und Gabeln benutzten wir nie. Mein Vater nahm einen Schluck Milchkaffee aus seiner hellgrünen Tasse, die bestimmt einen Liter fasste. „Ich muss heute nach Villa Rica, um Einkäufe zu machen“, verkündete er. „Wir wollen mit!“, schrien wir Kinder. Für uns bedeuteten die wenigen Gelegenheiten, vom Hof wegzukommen, stets eine willkommene Abwechslung.
Unsere Kaffeeplantage lag im bergigen Urwaldgebiet Perus auf etwa 1500 Meter über Meer. Mein Vater hatte das Grundstück zu einem günstigen Preis von einem Einheimischen erworben. Zu Beginn lebten er, meine Mutter und meine älteste Schwester in einer einfachen Hütte, die dort stand. In den folgenden Jahren baute Papa unser Haus. Das nächste grössere Dorf war Villa Rica, das lange Zeit nur über einen Saumpfad erreichbar war. Später wurde eine holperige Fahrpiste gebaut. Mit seinem alten Geländewagen benötigte mein Vater etwa zweieinhalb Stunden, um ins Dorf zu gelangen. „Heute fahre ich alleine!“, bestimmte er. „Es sieht nach Regen aus, da kann es kompliziert werden.“ Wir wussten, dass es keinen Sinn hatte, ihn weiter zu bedrängen.
Mein Grossvater und seine Familie waren zur Zeit des Zweiten Weltkriegs nach Peru ausgewandert, als der älteste Sohn von Hitler in den Krieg eingezogen werden sollte. Als sie Deutschland verliessen, war Papa zehn Jahre alt. Er, der sehr gerne zur Schule gegangen war, lebte nun weitab jeglicher Zivilisation, an Bildung war nicht zu denken. Trotzdem las er immer sehr gerne und beschaffte sich später alle deutschen Bücher und Zeitschriften, die er nur kriegen konnte. So war er trotz seiner wenigen Schuljahre sehr belesen.
Als Teenager war Vater im Gegensatz zu seinem älteren Bruder Engelbert nicht angepasst und fleissig. Er stellte seine Eltern in Frage, rebellierte und stiess sie mit seinen Reaktionen oft vor den Kopf. „Helmut!“, wiesen sie ihn immer wieder zurecht. „Nimm dir deinen Bruder zum Vorbild!“ Es muss sehr hart für Vater gewesen sein, dass sie Engelbert stets bevorzugten. Als dieser bei einem Sprengunglück im Strassenbau mit nur 21 Jahren ums Leben kam, hörte Papa meinen Grossvater sagen: „Warum musste nur Engelbert sterben? Warum war es nicht Helmut?“ Kurz darauf haute Vater ab und lebte einige Jahre bei den Indianern.
Als er wieder auftauchte, heiratete er bald darauf meine Mutter. Er hatte sie im Dörfchen Villa Rica kennengelernt, wo sie bei Verwandten lebte.
Ursprünglich kam Mutter aus Pozuzo. Dieses Siedlerdorf war mitten im peruanischen Urwald von einer Auswanderergruppe aus Tirolern und Rheinländern gegründet worden. Die Armut und die Not in der Heimat brachten diese Europäer dazu, sich 1857 in ein völlig neues Land aufzumachen. Nachdem sie die südamerikanische Westküste erreicht hatten, überquerten sie mit ihren Maultieren unter grossen Schwierigkeiten die Anden und bahnten sich einen Weg in den Dschungel. Lediglich 156 von ursprünglich 304 Emigranten erreichten das Tal, das sie besiedeln sollten. Später gesellte sich noch eine weitere Gruppe dazu, und gemeinsam gründeten sie Pozuzo, das sich bis heute als die „einzige österreichisch-deutsche Kolonie der Welt“ bezeichnet. Bis 1975 war das Dorf nur über einen Trampelweg zu erreichen. Entsprechend behielten die Bewohner ihre besondere Kultur und den Tiroler Dialekt noch lange bei.
„Venado, Tato, Chichi, kommt! Es gibt Abendessen!“, rief meine Schwester Herta, die mein Vater auch Chumpi nannte. Papa gab allen von uns Spitznamen: Venado war Helmut, Tato war Gerhard und Chichi war ich. Wir drei waren oft miteinander unterwegs. Wir durchstreiften die Plantage und spielten Verstecken um die unübersichtlich gepflanzten Kaffeestauden. Besonders gerne zielten wir mit unseren Steinschleudern auf Vögel oder versuchten, uns an Lianen über Bächlein zu schwingen. Anschliessend schlugen wir uns die Bäuche voll mit Avocados, Orangen und anderen exotischen Früchten, deren Bäume als Schattenspender zwischen den Kaffeepflanzen standen.
„Wo ist eigentlich Elsa?“, fragte ich meine Brüder eines Nachts, als wir nebeneinander auf unseren Betten lagen. Die Matratze aus getrockneten Maisblättern knirschte, als Helmut sich zu mir drehte. „Sie ist weg“, klärte er mich auf. Unsere älteste Schwester war fast schon so gross wie Mutter. Sie war es, die uns Kleinen vor dem Abendessen immer sauberschrubbte. Heute hatte Chumpi diese Aufgabe übernommen. „Wohin?“, wollte ich wissen. Nun ergriff Tato das Wort: „Als ich gestern im Garten war, klangen laute Stimmen aus der Küche heraus. Ich schlich zum Fenster und guckte hinein. Da standen Papa, Mama und ein Unbekannter, der seinen Arm um Elsa gelegt hatte. Sie haben gestritten.“ Näheres konnte er nicht berichten, denn Mutter hatte ihn entdeckt, sodass er vom Fenster verschwinden musste. „Ich habe gesehen, wie sie sich geküsst haben!“, machte Helmut sich nun wichtig. Wir kicherten. „Ob Elsa den Mann wohl heiratet?“, überlegte ich. „Das glaube ich nicht!“, meinte Tato. „Der Mann ist kein Siedler. Und Vater sagt immer, dass seine Töchter nur Partner europäischer Abstammung heiraten dürfen!“ „Vielleicht doch!“, mutmasste Helmut. „Immerhin habe ich sie zusammen wegfahren sehen!“
Wenig später wurde Vater wütend, weil er mitbekommen hatte, wie Chumpi sich ebenfalls mit einem jungen Mann getroffen hatte. Kurz darauf wurde sie zu Verwandten in die Gegend von Iscozacín ins Palcazú-Tal geschickt.
Wir waren als Familie praktisch nie allein. Ständig wohnten ein paar Einheimische bei uns, die auf der Kaffeeplantage mithalfen. In den drei Monaten der Kaffeeernte kamen noch weitere Arbeiter aus dem peruanischen Hochland sowie aus der Urwaldgegend dazu. Diese lebten in einfachen Hütten auf unserem Land und verpflegten sich selbst. In der Haupterntezeit waren es bis zu vierzig Personen.
Die Hochland-Indios und die Urwald-Indianer vermischten sich allerdings nie. Sie hatten völlig verschiedene Lebensweisen und redeten auch nicht dieselbe Sprache. Während die einen an Kartoffeln, Mais und Käse gewohnt waren, kamen die anderen aus unserer Gegend und wussten genau, was bei uns in der Natur geniessbar war. Sie hatten ihre Hütten am Rand des Dschungels errichtet und sammelten bei der Arbeit essbare Pflanzen, Maden und Vögel, mit denen sie ihre Yuca-Gerichte ergänzten. Nur wenn wir abends miteinander Fussball spielten, machten alle mit. Die gemeinsame Sprache war Spanisch, und wenn nötig musste jemand ins Quechua oder in eine Stammessprache übersetzen. An Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen kann ich mich nicht erinnern.
Am liebsten hielt ich mich bei den Urwald-Indianern auf. Ich liebte die Tiere und die Natur, und sie kannten sich bestens damit aus. Stets waren sie freundlich und hatten nichts dagegen, wenn ein kleiner, weisshäutiger Pimpf ihnen Gesellschaft leistete.
Unsere nächsten Nachbarn war die Familie Flores, aber durch die viele Arbeit hatten meine Eltern nicht viel Gelegenheit, Kontakt mit ihnen zu pflegen. Manchmal gab es Streit zwischen den beiden Plantagebesitzern. Eines Tages beispielsweise nahm Papa mich an der Hand und sagte: „Komm, wir gehen zu Don José.“ Unterwegs ging er aber nicht auf mein fröhliches Geplapper ein, sondern murmelte verärgert deutsche Wörter vor sich hin. Wir trafen José auf der Bank vor seinem Haus. Wie immer hatte er seinen Hut tief ins Gesicht gezogen. „Deine Arbeiter haben schon wieder bei mir gepflückt!“, fuhr Papa ihn an. „Du weisst genau, die Grenze geht bis zum Bach!“ „Und deine Leute erst?“, entgegnete José kämpferisch, „die haben mein ganzes Gebiet hinter dem Hügel abgeerntet!“ Nun gab ein Wort das andere, und die Männer stritten, drohten und beschimpften einander so, dass mir angst und bange wurde. „Chichi, komm hinters Haus und hilf meinen Buben!“, rief Mama Flores. Dort waren Lino und Hugo dabei, Kaffeekirschen zu sortieren. Als wir fertig waren, kehrte ich zu Papa zurück. Er und Don José sassen nun friedlich nebeneinander. Beide hatten eine Tasse mit Branntwein in der Hand, die Flasche auf dem Boden war fast leer. „Ich muss gehen“, meinte mein Vater, als er mich erblickte. „Vielen Dank nochmal!“ Er klopfte dem Nachbarn freundschaftlich auf die Schulter. „Keine Ursache! Bis zum nächsten Mal!“, entgegnete dieser. Auf dem Heimweg stolperte Papa über einen Stein. Als er sich wieder gefangen hatte, murmelte er: „Weswegen haben wir den alten Flores schon wieder besucht?“
Mama war eine fleissige Hausfrau und ausgezeichnete Köchin. In ihrem grossen Garten wuchsen die verschiedensten Gemüse sowie Mais, Kartoffeln und Getreide. Wir besassen viele Hühner und einige Kühe, Schweine und Maultiere. Dazu hatten wir auch exotische Tiere, die mein Vater aus der Urwaldgegend bei Iscozacín mitgebracht hatte. Da waren zum Beispiel der lustige Papagei Loro und der freche Affe Felipe, den ich besonders mochte. Doch nachdem sich dieser eines Tages über unseren Schmalz hergemacht hatte, reichte es meinem Vater. Kurzerhand setzte er dem Leben des armen Tiers ein Ende.
Viele unserer Kleider nähte Mama selbst. Für den Baumwollstoff verwertete sie die grossen Mehlsäcke, die sie in einer Lauge aus Asche kochte, bis sie strahlend weiss waren. Daraus fertigte sie unsere Unterwäsche und die Röcke der Mädchen an. Als Gummizug dienten Schläuche von Autopneus, die sie in dünne Streifen schnitt.
Mein Vater arbeitete handwerklich äusserst geschickt - wenn er nicht gerade auf dem Sofa lag und lesen wollte. Dann verströmte er einen eigenartigen, üblen Geruch und schlief oft. Bald hatten wir begriffen, dass wir ihn zu diesen Zeiten besser in Ruhe liessen. Manchmal rief er uns Kinder aber zu sich und eröffnete: „Nun werde ich euch eine Geschichte erzählen!“ Mucksmäuschenstill sassen wir dann neben ihm auf dem Boden und lauschten seinen Erzählungen über Tarzan oder über etwas, was er gerade gelesen hatte. Ich liebte meinen Papa!
Mit sechs Jahren kam ich in die Schule nach Villa Rica. Da mein Vater unmöglich täglich den weiten Weg ins Dorf fahren konnte, meldeten mich meine Eltern im Klosterinternat an. So würde ich, gemeinsam mit anderen Buben der Gegend, die Woche über bei den Ordensfrauen leben und die staatliche Schule des Dorfes besuchen. An den Wochenenden durfte ich nach Hause.
„Mama, ich will da nicht mehr hin!“, jammerte ich jeden Sonntagabend. Ich hasste das Leben im Internat! Nicht nur, weil ich auf einmal weit weg von meinen Eltern und meiner gewohnten Umgebung leben musste. Ich fürchtete die hartherzigen Nonnen, die ihre Regeln eisern durchsetzten. Das Essen, das man uns auftischte, brachte ich kaum herunter. Täglich fanden wir Maden und Würmer in der Polenta, frisches Obst und Gemüse gab es praktisch nie. Oft waren wir Buben auf uns allein gestellt.
Natürlich mussten wir immer zur Kirche, die uns mit ihrer dunklen, geheimnisvollen Atmosphäre gleichermassen faszinierte wie abschreckte. Bald gehörten mein Freund Clemens und ich zu den Messdienern, die dem Priester assistieren durften. Bevor die Messe begann, begaben wir uns in die fensterlose Kammer der Sakristei, wo uns die Ministranten-Talare übergezogen wurden. Dann mussten wir uns zur Wand drehen, sodass wir nicht sehen konnten, wie der Messwein eingeschenkt wurde. Was es damit wohl auf sich hatte? Diese mysteriöse Angelegenheit weckte mehr und mehr unser Interesse. Anschliessend bestand unsere Aufgabe darin, immer zum richtigen Zeitpunkt mit der Schelle zu klingeln, dem Priester die Schüssel mit dem Weihwasser zu reichen und ihm sonst wo nötig zur Hand zu gehen. Für uns war es eine grosse Ehre, dies tun zu dürfen.
Jeden Tag drückte man uns den Rosenkranz in die Hand. Die Nonnen sagten: „Nun werden wir alle den Rosenkranz beten. Wenn ihr gesündigt habt, wird Gott euch von euren Sünden befreien.“ Abends mussten wir noch einmal in die Kirche. Viele meiner Kameraden schliefen dann ein. Aber ich nicht. Ich passte so gut wie möglich auf, denn es war mir wichtig, alles gut zu machen. Ausserdem wollte ich auf keinen Fall von Gott bestraft werden oder gar in die Hölle kommen.
Unser Priester hiess Pater Javier. Er war gross, dick und trug eine braune Soutane, darunter eine Umhängetasche. Clemens und ich hatten beobachtet, wie er manchmal etwas vom Geld der Kollekte in diesen Beutel tat. Es war eine wunderliche Tasche, in die wir gerne mal reingeguckt hätten. Von dort nahm er nämlich auch die Zigaretten heraus, die er zu rauchen pflegte.
Eines Tages sahen Clemens und ich, wie Pater Javier seine Zigarette ausmachte und liegen liess. „Wie schmeckt das wohl?“, fragte Clemens, und ich schlug vor: „Lass uns probieren!“ Wir rochen daran und fanden einen Weg, sie wieder anzuzünden. Doch wir mussten nur husten und fragten uns, was die Erwachsenen am Rauchen so interessant fanden. Ganz anders verhielt es sich mit dem herrlich süssen Messwein. Wenn da etwas übrigblieb, waren wir beide schnell zur Stelle und leerten die letzten Tropfen mit Genuss. Interessant, aber nicht unangenehm war das leicht schwindlige Gefühl, das ich im Nachhinein verspürte ...
Doch die düstere Kirche verbarg auch viel Unheimliches, Furchteinflössendes. Da war zum Beispiel jene grosse Statue eines Heiligen, die sich direkt vor unserer Kirchenbank erhob. Mit seinem Fuss trat er auf einen Schädel, und in der Hand hielt er einen weiteren Totenkopf, der uns ständig anzustarren schien. In der dunklen, nur mit Kerzenlicht erhellten Kirche jagte uns diese Figur immense Angst ein. Wir fürchteten uns auch, die finstere Sakristei zu betreten, und etwas vom Schlimmsten war es, wenn wir den Glockenturm besteigen mussten. Dann hielten wir uns an den Händen, um uns gegenseitig Mut zu machen.
Auch die Ordensfrauen hielten uns Kinder mit Angst unter Kontrolle. Sie waren sehr streng, selten gab es ein freundliches Wort von ihnen. „In der Nacht dürft ihr nicht aufstehen“, ordneten sie an. „Euer Platz ist in eurem Bett. Wenn ihr es trotzdem tut, wird er euch erwischen ...“ Obwohl wir nicht wussten, wer mit er gemeint war und was er mit uns tun würde, war uns klar, dass wir besser gehorchten. Auch in unserem Schlafraum brannten nur Kerzen, die gespenstische Schatten an die Wand warfen. Im Dach nisteten die Fledermäuse und wir hörten seltsame Geräusche. Manchmal tauchte geräuschlos eine Gestalt mit Kapuze auf und lief in unserem Schlafsaal hin und her. Ich zog die Decke über meinen Kopf und hielt starr vor Schreck die Luft an. „Das ist bloss Pater Javier, der uns Furcht einjagen will!“, beruhigten uns die grösseren Jungs. Trotzdem war es schrecklich! Besonders nachts plagte mich panische Angst, und als Sechsjähriger vermisste ich mein Zuhause sehr.
Dann wurde ich krank. Ich weiss noch, wie ich im Internat hohes Fieber bekam und mehrere Tage im Bett lag. Die Ordensfrauen befahlen mir, mich möglichst nicht zu bewegen, und gaben mir kalten Orangensaft zu trinken. Das war alles.
Wie mir meine Mutter später erzählte, erschrak sie zutiefst, als sie mich am folgenden Samstag abholen wollte. Sie fand mich in meinem Bett, wo ich unter starkem Schüttelfrost zitterte und im Fieber fantasierte. „Warum haben Sie uns nicht informiert?!“, rügte sie die Nonnen und schickte sie, sofort den Doktor zu holen. Doch der konnte nicht mehr viel ausrichten, denn inzwischen war ich ins Koma gefallen. Da es im Dörfchen Villa Rica kein Krankenhaus gab, brachte man mich ins Haus meiner Grossmutter. Mama wachte bei mir und es folgten Tage bangen Zuwartens. Der Arzt hatte gesagt, wenn ich bis in sieben Tagen nicht aus dem Koma aufwachen würde, bestünde keine Hoffnung mehr.
Aber genau am siebten Tag schlug ich die Augen auf und verlangte nach Brot. Ausser sich vor Freude rief Mutter den Doktor. Nun taten sie alles, um meinen Genesungsprozess zu unterstützen. Endlich nahm ich wieder Flüssigkeit und Nahrung zu mir und konnte nach einiger Zeit wieder aufstehen. Nachdem sich mein Zustand stabilisiert hatte, fuhren wir nach Hause auf den Palomar.
Alle waren nun sehr besorgt um mich. „Der Bub hatte eine Hirnhautentzündung. Er muss ordentlich essen, um wieder zu Kräften zu kommen“, hatte der Doktor angeordnet, „und er darf sich auf keinen Fall aufregen!“ Die Schule sollte ich erst einmal nicht mehr besuchen. In der Folge behandelten mich alle mit grosser Fürsorge, Milde und Nachsicht. Ich lernte schnell, dies auszunutzen. Nur zu bald hatte ich herausgefunden, wie ich mein ganzes Umfeld herumkommandieren konnte, und ich machte von diesem Wissen gebührend Gebrauch. Mutter kochte meine Lieblingsgerichte, meine Brüder liessen mich beim Spielen gewinnen und Vater trug mir keine Arbeiten mehr auf. Ich hatte sie total in der Hand. Kaum fing ich an, mein Gesicht säuerlich zu verziehen, gaben alle nach. Schliesslich hatte der Arzt gesagt, ich müsse mich schonen. So wurde ich umsorgt, verwöhnt und verhätschelt - und entwickelte mich zu einem anspruchsvollen kleinen Tyrannen.
Aber einmal ging ich zu weit. Als Mama mich um einen kleinen Gefallen bat, gab ich ihr eine so freche Antwort, dass sie mir eine Ohrfeige verpasste. Mein Vater, der sich gerade in der Nähe befand und den Vorfall mitbekam, teilte ihre Meinung. Er holte einen Keilriemen und verpasste mir zusätzlich eine Tracht Prügel. Ich war regelrecht schockiert. Weniger wegen des körperlichen Schmerzes als vielmehr aus Überraschung und verletztem Stolz. Unsere Eltern schlugen uns nie! Doch mein Benehmen in den vergangenen Monaten hatte das Fass zum Überlaufen gebracht.
Nach wie vor ging ich bei meinen Indianerfreunden vorbei, die für uns arbeiteten. Pepe mochte ich besonders gerne. Als er einmal an einem Sonntagnachmittag seine Sachen zusammenpackte, fragte ich: „Wo gehst du hin?“ - „Zum Fischen“, meinte er. „Nimmst du mich mit?“ Und so führte er mich in die Faszination des Angelns ein. Ich liebte es! Man suchte sich einen wunderschönen Fleck Natur an einem Bach, besorgte sich ein paar Köder und liess den Haken ins Wasser sinken. Dann konnte man an einem schattigen Ort das Glitzern der Sonne auf dem kristallklaren Wasser bewundern, Vögel beim Jagen beobachten und die wunderbare Ruhe geniessen. Fing man einen Fisch, gab es überdies ein köstliches Essen.
Pepe und ich sprachen nicht viel, das war gar nicht nötig. Jedes Mal holte er einige getrocknete Pflanzen-Blätter aus seiner Pushaca, der gewobenen Indianertasche, und steckte sie in den Mund. „Was ist das?“, wollte ich wissen. „Das sind Koka-Blätter“, erklärte er. „Aber das ist nichts für Siedler-Kinder! Das nehmen wir Indianer-Männer auf der Jagd und beim Fischen.“ Ich war zufrieden mit der Antwort und gewöhnte mich daran, still neben ihm zu sitzen, während er die Blätter kaute und in seiner Backe zu einer runden Kugel formte.
Als das neue Schuljahr begann, beschlossen meine Eltern, mich für die dritte Klasse ins selbe Internat zu schicken, das meine älteren Brüder Helmut und Tato bereits besuchten. Es befand sich in der Stadt Huancayo, im Hochland Perus, und wurde von Priestern geführt. Wieder begann eine schlimme Zeit für mich. Obwohl meine Brüder in der Nähe waren, hatte ich grösste Mühe, mich an den Drill der Jungenschule zu gewöhnen. Für mich war es normal, in jeder Beziehung verhätschelt und verwöhnt zu werden. Hier aber galten straffe Ordnungen: „Wenn ihr den Gong hört, steht ihr sofort auf, schlagt die Bettdecken zurück und geht in den Waschsaal“, ordneten die Priester an. „Dann habt ihr genau drei Minuten Zeit, um das Gesicht zu waschen, und zwei weitere, um die Zähne zu putzen. Danach wird das Bett gemacht.“ Alles musste schweigend und in Reih und Glied verrichtet werden. Eine Woche bekamen wir Neuankömmlinge, um uns alles zu merken. Ab dann mussten wir mit einer Strafe rechnen, wenn wir uns nicht an die Regeln hielten. Zwar gab es keine Schläge, aber es konnte bedeuten, dass man stundenlang in der klirrenden Kälte des Klosterhofes stehen musste, bloss weil man sich die Seife vom Nachbarn ausgeliehen hatte.
In der Stadt dröhnten und stanken die Autos. Die Luft war kalt und trocken, die Natur karg und rau. Bei den meisten Schulkameraden handelte es sich um Söhne von Bergbauarbeitern, die in der Gegend wohnten. Nur wenige kamen wie wir aus der Urwaldgegend. Schnell schlossen wir uns zusammen und wurden Freunde. Trotzdem vermisste ich meine Eltern sehr und gewöhnte mich nur schwer an die neuen Lebensbedingungen.
Deshalb freute ich mich riesig, als endlich die Ferien begannen und wir nach Hause durften. Nun war vor allem Fussball angesagt. Gemeinsam mit den Jungs der Nachbarfamilie Flores spielten wir jeden Nachmittag. Unser Feld war die grosse Fläche, wo unsere Arbeiter die Kaffeekirschen zum Trocknen auslegten; als Ball diente eine grosse, unreife Grapefruit oder wir knoteten alte Lumpen zusammen. Plastik- oder gar Lederbälle waren in unserer Gegend nicht erhältlich.
Nach einem dieser Spiele fragte Lino Flores: „Kommt ihr mit uns auf die Jagd?“ Helmut und ich waren gleich mit von der Partie. Für ein Abenteuer in der Natur waren wir stets zu haben. Tato lehnte ab. Er wollte lieber an seiner Holzarbeit weiterbasteln. So zogen wir los. Die Flores und Helmut hatten je eine kleine, 16-kalibrige Jagdflinte und unser Ziel bestand darin, ein Majaz, eine Art Beutelratte, zu erlegen. Als wir im Dschungel ankamen, meinte Lino: „Zuerst müssen wir uns auf die Jagd ,einstimmen'.“ Sie suchten eine Lichtung mit einem grossen Stein und breiteten darauf aus, was sie in ihren Umhängetaschen mitgebracht hatten. „Rüstzeug“ nannten sie es. Da lagen Koka-Blätter, Zigaretten und Schnaps, aber es hatte auch Kalksteine und längliche, getrocknete Pflanzenteile, die ich nicht kannte. Lino nahm als Erster einige Koka-Blätter in den Mund. Dann kam Hugo an die Reihe. „Wollt ihr auch?“, fragte er. Natürlich waren wir dabei und taten es ihm nach. „Pfui Teufel!“, rief Helmut, „das schmeckt ja scheusslich!“ Auch ich verzog das Gesicht. Zudem fühlte ich, wie meine Zunge ein bisschen taub wurde. „Nun, ihr müsst ja auch noch Kalk und Chamairo dazunehmen. Das verstärkt die Wirkung und macht es geniessbar“, erklärte Lino. Und tatsächlich: Kaum hatte ich dies getan, bekam das Ganze einen süsslichen Geschmack. „Nun werdet ihr nicht müde werden und keinen Hunger verspüren“, erklärte Hugo. „Das tun die echten Jäger.“ Mit meinen zehn Jahren fühlte ich mich gross und erwachsen.
Wieder zu Hause fragte ich Helmut, was Chamairo denn sei. „Das ist eine Liane, die aus der tiefer gelegenen Urwaldgegend kommt. Hast du nicht gesehen? Vater hat davon aus Iscozacín mitgebracht. In unserem kleinen Laden für die Plantagen-Arbeiter befindet es sich direkt neben den Koka-Blättern.“ Tatsächlich entdeckte ich die Stängel. Und als niemand in der Nähe war, steckte ich einige davon in meine Tasche.
Ich hoffte sehr, dass uns die Flores am folgenden Tag nach dem Fussball wieder zur Jagd einladen würden. Zwar wollten sie diesmal fischen gehen, aber auch darauf musste man sich gebührend „einstimmen“. Als sie uns die Koka-Blätter verteilten, nahm ich stolz den Chamairo aus der Tasche und legte ihn auf den Stein. Das sollte mein Beitrag sein. An diesem Tag lernte ich noch etwas dazu: Die „richtigen Jäger“ rundeten das Ganze mit einem kräftigen Schluck Schnaps ab.
„Tato, komm doch auch mit!“, drängte ich meinen Bruder bei der nächsten Gelegenheit und erzählte ihm von unserem Abenteuer. „Das Jagen ist einfach grossartig!“ Und so begleitete Tato uns beim nächsten Mal. Aber im Gegensatz zu Helmut und mir konnte er der Angelegenheit nicht viel abgewinnen.
Nur zu bald neigten sich die Ferien dem Ende zu und wir mussten wieder ins Internat zurück. Erneut konnte ich mich kaum auf das harte Leben der Schule umstellen. Ich war ein guter Schüler, und da ich den Religionsunterricht mochte, wurde ich auch dort bald Messdiener. Ich gab mich brav und fromm. Doch in Wahrheit träumte ich ständig den vergangenen Streifzügen mit den Flores nach und malte mir neue aus.
An den Wochenenden unternahm ein Freund meines Vaters, der in Huancayo lebte, manchmal etwas mit uns. Einmal nahm er mich mit zu einer Totenwache. Dort wird der Verstorbene aufgebahrt und alle Verwandten und Bekannten kommen und setzen sich eine Zeitlang zusammen. Oft werden diese Anlässe zu geselligen Runden, da man Leute trifft, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Auch bei solchen Gelegenheiten ist es üblich, dass ein Korb mit Koka-Blättern die Runde macht. Als er bei mir ankam, konnte ich nicht widerstehen. Ich reichte ihn nicht weiter, so wie ich es als Kind hätte tun müssen, sondern nahm unbemerkt eine grosse Handvoll davon und verbarg sie in meinem Ärmel. Dann schlich ich hinaus, steckte sie in den Mund und nahm einen Schluck Traubenschnaps aus der fast leeren Flasche, die jemand achtlos in eine Ecke gestellt hatte. Doch es bekam mir nicht. Als wir zum Internat zurückkehrten, war mir speiübel. Mir wurde so schlecht, dass ich mich übergeben musste. „Was ist bloss los mit dir?“, wollten die Priester wissen. „Ich muss etwas Schlechtes gegessen haben“, schwindelte ich. Es war das erste Mal, wo ich ganz bewusst log, um zu verbergen, dass ich Koka und Alkohol genommen hatte. Noch lange plagte mich mein schlechtes Gewissen wegen dieser Ausrede ...
Endlich kamen die grossen Sommerferien. Sie dauerten fast drei Monate. Da ich in Englisch eine Ungenügende hatte, musste ich morgens bei der Kaffeeernte helfen. Stets arbeitete ich so schnell wie möglich, um meine vier Kisten mit Kaffeekirschen zu füllen.
Nachdem wir unsere Aufgaben in Haus und Hof verrichtet hatten, war erneut Fussball angesagt... natürlich mit den Flores, mit denen Helmut und ich daraufhin oft wieder loszogen. Tato war meist nur bis zum sportlichen Teil mit uns zusammen. Manchmal half er mir allerdings noch dabei, unsere „Zutaten“ für das „Rüstzeug“ zu besorgen. Für ein paar Münzen, die Helmut uns gab, gingen wir zu den Kaffeearbeitern und schauten, wem wir etwas abkaufen konnten. Auch für Tato war es völlig normal, dass Koka, Schnaps und die anderen Dinge zum Jagen dazugehörten.
Als meine Schwester Chumpi wieder einmal zu Besuch war, sass sie eines Abends mit Mutter und mir am Küchentisch. Vater war in die Stadt gefahren, um Kaffee zu verkaufen. Meist kam er stockbetrunken nach Hause und Geld brachte er selten mit. Besorgt schaute meine Schwester in Mutters müdes Gesicht. „Warum lässt du dir das gefallen?“, fragte sie. „Vater tut ja nichts! Ständig lässt er sich volllaufen und überlässt dir die ganze Arbeit!“ Mama, die gerade ein Huhn rupfte, drehte es auf die andere Seite und zuckte mit den Schultern. Sie hatte Tränen in den Augen. Daraufhin ging Chumpi ins Zimmer, wo Vater sich hinzulegen pflegte, leerte alle Flaschen aus und stapelte sie auf dem Boden. Es waren ganz schön viele. „Ich werde ihm klarmachen, was er mit seiner Trinkerei anrichtet. Er soll endlich damit aufhören!“, ereiferte sie sich. Mutter versuchte sie zu beschwichtigen: „Besser nicht! Sonst wird er nur wütend!“
Wie leid tat mir Mama in diesem Augenblick! Ich ging zu ihr hin und schlang meine Arme um sie. Chumpi hatte recht: Meine Mutter stand täglich vor vier Uhr auf, stellte alle Gerätschaften bereit, verteilte den Arbeitern ihre Aufgaben, bereitete das Frühstück zu und war Ansprechperson für alles. Vater stand meist viel später auf, machte einen Rundgang und fand schon bald eine Gelegenheit, um sich einen Schluck zu genehmigen. Während ich sie fragte, womit ich ihr am folgenden Tag helfen konnte, wanderten meine Augen zu den Flaschen, die Chumpi eben erst geleert hatte. Morgen Abend würde ich wieder mit den Flores unterwegs sein, und ich hatte doch versprochen, für den Schnaps zu sorgen. Schnell griff ich nach einer der leeren Flaschen und stahl mich in den Laden, um sie heimlich aus dem grossen Fass dort abzufüllen.
So vergingen die Ferien. Helmut und ich waren nun praktisch jeden zweiten Abend mit den Flores unterwegs. Übrigens blieb es nicht beim „Einstimmen“. Bald fingen wir auch an, zwischendurch Pausen einzulegen, um noch ein bisschen „nachzuschieben“. Mittlerweile hatte auch ich angefangen, Zigaretten zu rauchen.
Kamen wir zurück, rochen wir ebenso stark nach Koka und Zuckerrohrschnaps, wie wir es von meinem Vater her kannten. Als ich eines Nachts die Küche betrat, sass Mutter noch da und schnitt Gemüse klein. „Chichi“, sagte sie, hob den Kopf aber nicht. „Es ist nicht gut, was ihr da tut. Koka kauen und Schnaps trinken, das tun die Einheimischen, um auf die Jagd zu gehen. Euch Siedler-Jungen steht ein solches Verhalten nicht an. Du sollst einmal eine gute Ausbildung und einen Beruf haben.“ „Ja Mama“, sagte ich als gehorsamer 12-Jähriger ... aber insgeheim überlegte ich bereits, was wir bei unserem nächsten „Ausflug“ unternehmen könnten.
Auch meinem Vater muss unser Geruch und unser Benehmen aufgefallen sein. Er sagte jedoch kein einziges Mal etwas. Vielmehr trank er seinen Tee mit Rum und streckte sich mit einem Buch auf dem Sofa aus.
In der Schule wurde ich immer schlechter. Ich dachte an unsere Streifzüge und konnte mich kaum konzentrieren. Ungeduldig sehnte ich die nächsten Ferien herbei. Schliesslich wechselten meine Brüder an eine Schule nach Lima, um dort neben der Oberstufe auch eine Berufsausbildung zu machen. Der Einfachheit halber meldeten mich meine Eltern ebenfalls dort an. Wieder handelte es sich um ein Internat desselben Priesterordens, und wieder waren wir nur eine kleine Gruppe von Schülern aus der Urwaldgegend. Irgendwie stand ich den Unterricht durch.
Während Helmut Mechaniker lernte, wählte Tato den Fachbereich Möbelschreiner, hatte er es doch von jeher gemocht, mit Holz zu arbeiten. Er lernte fleissig und gehörte im Gegensatz zu mir stets zu den Klassenbesten. Als ich in die siebte Klasse kam, wählte ich dieselbe Ausbildung. Während die Schulbank für mich zur reinsten Qual geworden war, freute ich mich stets auf die Stunden in der Werkstatt, wo wir sägen, feilen und nageln durften.
Eines Tages haute Helmut ab. Bis heute weiss ich den Grund dafür nicht genau. Hatte es etwas zu tun mit dem Priester, der nachts bestimmte Jungen suchte und sie mit sich hinter den Vorhang zog? Oder wollte man meinen Bruder zwingen, Priester zu werden? Jedenfalls war er auf einmal verschwunden. Später erfuhr ich, dass er sich alleine zurück in den Palomar durchgeschlagen hatte.
In den folgenden Ferien war die Atmosphäre zunehmend angespannt. Mein Vater, der in den vergangenen Jahren den ganzen Erlös der Kaffeeernte vertrunken und verspielt hatte, war mittlerweile auch bei der Bank hoch verschuldet. Ich erinnere mich an einen Herrn im Anzug, der immer wieder bei uns aufkreuzte und Mutter das wenige Geld abnahm, das in der Kasse war. Mama war eine Kämpfernatur. Sie arbeitete unermüdlich und hart, sowohl auf der Kaffeeplantage als auch im Garten und im Haushalt. Entschlossen und unbeirrt mühte sie sich ab, um unser Schulgeld zusammenzusparen. Dazu verkaufte sie die Eier ihrer Hühner und versteckte den Verdienst, damit er von den Gläubigern nicht entdeckt wurde. Doch so stark sie auf dem Hof und den Arbeitern gegenüber war, so hilflos und schwach begegnete sie den Problemen, die sich in unserer Familie anstauten. Nie hörte ich, dass sie meinem Vater etwas entgegengehalten hätte. Nie forderte sie ihn auf, weniger zu trinken. Nie bat sie ihn, eine bestimmte Arbeit endlich anzupacken. Im Gegenteil, sie verhielt sich völlig passiv und bereitete ihm seine alkoholischen Getränke sogar noch zu.
Helmut und ich waren keine Unterstützung für sie, denn wir hatten bloss unsere Abenteuer im Kopf. Nur Tato widersprach Vater manchmal und bot ihm Kontra.
Die Schlinge um unsere finanzielle Situation zog sich enger, sodass Vater nach einem erneuten Besuch des Herrn im Anzug folgenden Entschluss fällte: Meine Eltern, Tato und ich sowie meine jüngeren Schwestern würden wegziehen und auf unserem Grundstück bei Iscozacín eine Vieh- und Forstwirtschaft beginnen. Indessen sollte Helmut, der inzwischen 21 Jahre alt war, auf dem Palomar bleiben, die Plantage betreiben und die Schulden abzahlen. Obwohl ich realisierte, dass mein Vater mit diesem Plan nur vor den Problemen flüchtete, stimmte ich sofort zu. Die tiefer gelegene Urwaldgegend des Palcazú-Tals war wunderschön, und auf die Jagd würde man auch dort gehen können ...
Als es Zeit war, mich fürs neue Schuljahr einzuschreiben, weigerte ich mich. Ich hatte keine Lust, hinzugehen. Ausserdem hatte Tato die Schule bereits abgeschlossen, sodass ich nun allein im Internat wäre. Mama weinte, als ich ihr meinen Entschluss mitteilte. Wie hatte sie gekämpft und gespart, um uns wenigstens eine gute Schulbildung zu ermöglichen! Und nun schmiss ich alles hin. Aber noch immer war ich ihr Chichi, dem sie jedes Mal nachgab, wenn er sich stur stellte. Papa hingegen freute sich. „Gut“, meinte er, „dann haben wir auf dem neuen Hof eine Arbeitskraft mehr.“ So kam es, dass ich die Schule drei Jahre vor dem Abschluss abbrach.
Bei unserem Umzug ins Palcazú-Tal bei Isco, wie wir Iscozacín inzwischen nannten, nahmen wir nur das Allernötigste mit. Dennoch dauerte es etwas, bis wir unsere Habseligkeiten vom Palomar nach San Ramón gefahren, nach Isco geflogen und mit dem Boot die zwei Stunden zu unserem Grundstück geschippert hatten. Vater, Tato und ich wollten ein Haus bauen. Wir überlegten, wie wir unseren Viehbestand vermehren konnten. Mutter, Margot und Timpis, wie wir meine jüngste Schwester Inge nannten, kümmerten sich um die Küche, den Garten und die Wäsche.
Meine erste Sorge am neuen Ort bestand darin, wie ich an Koka-Blätter und an Branntwein rankommen konnte. Nervös wartete ich eine Gelegenheit ab, um unseren Aufseher Oscar unter vier Augen zu fragen, wo man hier denn „etwas zum Jagen“ auftreiben konnte. Er verstand gleich, was ich meinte. „Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich das Indianerdorf Shiringamazú“, erklärte er. „Die Bewohner dort bauen für den Eigenbedarf selbst Koka an. Dort kannst du welches kriegen.“
Bei nächster Gelegenheit lieh ich mir unter einem Vorwand das Boot meines Vaters, packte ein paar Angelhaken und Batterien ein und fuhr nach Shiringamazú. Ich hatte keine Berührungsängste mit den Indianern, war ich doch von klein auf gewohnt, mit ihnen zusammen zu sein. Sie wiederum freuten sich über den Besuch und die Mitbringsel ihres neuen Nachbarn und luden mich auf eine Runde Masato ein. Während wir das alkoholische Getränk zusammen schlürften, fragte ich: „Gibt es hier eigentlich auch Koka?“ „Komm, gib mir deine Pushaca“, meinte einer der Männer, ging zum Haus und füllte meine Umhängetasche mit den begehrten Blättern. Als ich einige Zeit später wieder nach Hause zurückkehrte, war ich glücklich. Ich hatte sowohl neue Freunde gefunden als auch eine einfache Möglichkeit, an Alkohol und an Koka-Blätter ranzukommen.
Die folgenden Jahre waren von harter Arbeit und vielen Spannungen mit Vater geprägt. Regelmässig meinte ich abends: „Ich gehe noch auf die Jagd“, und haute ab in den Dschungel. Dieser war in der flachen Urwaldgegend anders, aber genauso faszinierend wie im Palomar. Hier gab es unter anderem Wildkatzen und Tapire, und ich versuchte immer wieder und mit grosser Geduld, eines dieser seltenen Tiere zu erlegen. Natürlich war ich äusserst stolz, wenn mir dies einmal gelang. Doch im Urwald lauern viele Gefahren. Zwar hatte ich das Interesse an religiösen Dingen längst verloren. Trotzdem bekreuzigte ich mich jedes Mal, bevor ich loszog, und murmelte dazu: „Gott schütze mich!“
Eines Nachts befand ich mich auf dem Heimweg von einem „Jagdausflug“. Ich hatte ein Gürteltier erlegt und deshalb ziemlich viel zu tragen: Über den Schultern hingen die Beute und die gesicherte Flinte und in den Händen hielt ich die Taschenlampe und die Machete, ohne die ich den Dschungel nie betrat. Ich befand mich auf einem schmalen Trampelpfad mitten im dichten Regenwald.
Plötzlich ging die Taschenlampe aus. Das war nichts Ungewöhnliches, und so blieb ich stehen und wechselte die Batterie. „Mist!“, flüsterte ich, als das Ding noch immer nicht funktionierte. Wahrscheinlich war die Birne kaputtgegangen. Im Urwald ist es nachts stockdunkel, denn das dichte Blätterdach macht es dem Mond und den Sternen unmöglich, dass ihr Schein bis zum Boden durchdringt. Da ich den Weg nicht finden würde, entschied ich mich, erst einmal abzuwarten. Vorsichtig legte ich das Gürteltier und die Flinte neben mich auf den Boden und setzte mich auf den Weg. Gewohnheitsmässig griff ich in meine Pushaka, entnahm ihr einige Koka-Blätter und schob sie in den Mund. Nachdem ich noch einen Schluck Schnaps hinterhergegossen hatte, gab ich mich der Wirkung der Drogen hin und übte mich in Geduld ...
Als ich da so sass, kam mir auf einmal in den Sinn, dass es in der Taschenlampe vielleicht eine Reservebirne gab. Ich drehte den hinteren Teil auf und tastete in die Öffnung. Tatsächlich: Hier befand sich eine Ersatzbirne! Ungeschickt hantierte ich herum, und schliesslich gelang es mir, sie einzusetzen. Endlich funktionierte die Lampe wieder. Doch als ich vor mich auf den Weg leuchtete, erschrak ich so, dass mir das Blut in den Adern stockte. Ich blickte direkt in die Augen einer riesigen Shushupe-Viper! In Angriffsstellung aufgerollt lag die Schlange keine zwei Meter direkt vor mir auf dem Weg. Dieses nachtaktive, hochgiftige Reptil lebt eigentlich von kleineren Säugetieren. Es jagt seiner Beute aber nicht hinterher, sondern lauert auf Pfaden, an Schlafstellen und Wasserlöchern. Sobald ein Warmblüter in die Reichweite der Viper kommt, bohrt sie ihm ihre bis zu 35 Millimeter langen Giftzähne ins Fleisch. Hätte ich im Dunkeln nur zwei Schritte mehr getan, wäre ich jetzt wohl nicht mehr am Leben. Vorsichtig stand ich auf, wich einige Schritte zurück und griff nach einem Stecken. Dann schlug ich die Schlange tot, hieb ihr den Kopf ab und vergrub diesen, damit das Gift niemandem schaden konnte. Verstört eilte ich nach Hause.
Abenteuer wie dieses erschreckten mich zwar. Ich war mir bewusst, dass Gott mich bewahrte. Trotzdem hielten sie mich nicht davon ab, abends immer wieder loszuziehen.
Manchmal ging ich mit meinen Indianerfreunden auf die Pirsch. Diese nahmen zwar ebenfalls ihre Rationen an Koka und Feuerwasser, waren aber irritiert über die Mengen, die ich konsumierte. Das tut ein Siedler eigentlich nicht“, pflegten sie vorsichtig zu bemerken. Die älteren von ihnen weigerten sich gelegentlich sogar, wenn ich ein Tauschgeschäft vorschlug.
Auch die Siedler des Tals trafen sich ab und zu, wobei bei diesen Treffen immer viel Bier getrunken wurde. Als Weisser gesellte ich mich zu ihnen, aber unter den Indianern fühlte ich mich wohler.
„Weil du den Zaun nicht kontrolliert hast, sind die Rinder abgehauen!“, herrschte mich Vater an. Meine häufige Angetrunkenheit schlug sich auch auf meinen Arbeitsstil nieder. Im Grunde war ich ein sehr kräftiger, geschickter junger Mann, der viel hätte leisten können. Doch auf mich war kein Verlass, was meinen Vater oft in Rage brachte. Er schnauzte mich dann an und überschüttete mich mit Vorwürfen. Doch was konnte er mir schon sagen? „Du trinkst ja auch!“, gab ich zurück.
Eines Tages fragte Tato, ob ich in Zukunft auch zu seinen Kühen schauen könne. Man habe ihm eine Stelle bei der Vieh-Genossenschaft des Tals angeboten. Er würde im Dorf Iscozacín stationiert sein und von dort aus das Schlachten der Rinder und das Ausfliegen des Fleisches organisieren. Natürlich sagte ich zu, war aber ein bisschen traurig, dass mein Bruder nicht mehr bei uns wohnte.
Ich traf ihn jedoch immer, wenn ein Fussball-Turnier in Isco mit anschliessendem Tanz organisiert wurde. Dazu kamen die jungen Siedler aus der ganzen Gegend angereist und ich fuhr mit meiner Schwester Timpis hin. Nachdem wir Jungs Fussball gespielt hatten, badeten wir im Fluss und zogen uns danach um. Später tanzten wir mit den Mädchen zur tropischen Cumbia-Musik, die aus dem Lautsprecher eines alten Plattenspielers schepperte. Während die einen tanzten, genehmigten sich die anderen ein Bierchen. Ich tat beides.
Eines Tages nahm Tato mich beiseite: „Bruder, es ist nicht gut, dass du so viel trinkst. Du bringst einen schlechten Ruf über unsere ganze Familie! Kannst du es nicht lassen, dich ständig zu betrinken?“ Traurig senkte ich den Kopf. Doch dann hob ich ihn wieder und sagte trotzig: „Ich kann jederzeit damit aufhören!“ „Dann tu das!“, meinte Tato und klopfte mir auf die Schulter. „Das ist das Beste für dich und für uns alle ...“
Denen würde ich es beweisen! Mit dem festen Vorsatz, in Zukunft nüchtern zu bleiben, kehrte ich nach Hause zurück. Einige Tage hielt ich durch. Doch kurz darauf hatte ich erneut eine Auseinandersetzung mit meinem Vater. „Das halte ich nicht mehr aus!“, schrie ich ausser mir und stürmte mit hochrotem Kopf aus dem Haus. In mir brodelte es. Ich brauchte dringend etwas, um meinen Zorn zu dämpfen. „Ich gehe angeln!“, rief ich Mutter zu, griff nach meiner Pushaka und eilte zum Fluss. Es war nach Mitternacht, als ich nach Hause torkelte und vollgedröhnt ins Bett sank.
Das war ein einmaliger Ausrutscher, redete ich mir ein. Ich habe es im Griff. Immer wieder versuchte ich nun, meinen Süchten beizukommen, wurde aber jedes Mal mit der Tatsache konfrontiert, dass ich es nicht schaffte. Nur ein Schluck, um mich abzuregen, pflegte ich mich zu rechtfertigen oder: Was für ein anstrengender Tag! Da habe ich eine Belohnung verdient! Im Nachhinein überfiel mich das heulende Elend. Du Schwächling!, schalt ich mich. Du Nichtsnutz! Die Enttäuschung über mich selbst war so gross, dass ich diesen Frust erneut in Alkohol ertränkte.
Eines Nachts betrat ich das Haus. Mama, Papa und Timpis brachen ihr Gespräch ab, als sie mich erblickten. Doch zu spät! Ich hatte bereits gehört, dass es um mich ging. „Was ist los?“, regte ich mich auf. „Was habt ihr wieder an mir auszusetzen?“ Mutter und Vater wichen meinem Blick aus, doch Timpis meinte: „Wir sprachen über deine ständigen Eskapaden. Weisst du, was wir denken? Du solltest heiraten! Nur eine Frau wird dich ändern können ...“
2
Ilse
Oktober 1957 - März 1977
Die Besiedelung der Gegend um Iscozacín durch Europäer geht weitgehend auf meinen Urgrossvater Johannes Wilhelm Frantzen zurück. Er war ein Seefahrer und Abenteurer, der mit Kautschuk handelte. Von Hamburg aus fuhr er mit dem Schiff an die brasilianische Küste und von dort über den Amazonas bis in peruanisches Gebiet hinein. In Iquitos stieg er auf kleinere Boote um und fuhr weiter die Flüsse hoch, hinein in Gegenden, wo er mit den Indianern Handel treiben konnte. Da er von den deutschösterreichischen Siedlern gehört hatte, die Pozuzo gegründet hatten, suchte er auch sie auf. Man sagt, dass er mit einigen von ihnen auf Goldsuche ging.
Wahrscheinlich mit wenig Erfolg, denn bald widmete er sich wieder vorwiegend dem Kautschuk-Handel. Gerade im Palcazú-Tal schien es viele dieser besonderen Bäume zu geben, heisst doch ein Indianerdorf der Gegend Shiringamazú, was auf Deutsch Kautschuk-Fluss bedeutet. In Iquitos lernte „Juan“, wie er auf Spanisch genannt wurde, meine Urgrossmutter kennen. Diese kam ursprünglich aus dem Siedlerdorf Pozuzo, war mit ihrem Töchterchen aber von dort weggezogen, nachdem ihr Mann jung gestorben war.





























