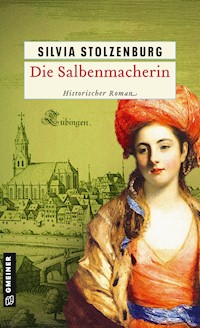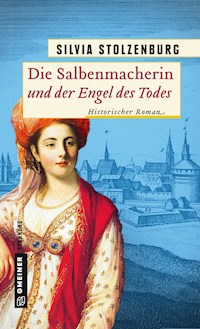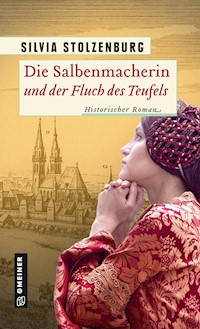3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookspot Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Aglaia
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Venedig anno 1570: Das geordnete Leben der jungen Desdemona Brabantio gerät aus den Fugen, als sie den temperamentvollen General Christoforo Moro kennenlernt. Trotz eines erheblichen Altersunterschieds verlieben sie sich ineinander. Das ungleiche Paar lässt sich vom Strudel der Gefühle mitreißen und schmiedet einen riskanten Plan: Nach einer heimlichen Hochzeit soll Desdemona ihrem Gemahl nach Zypern folgen. Der schlachterprobte General muss die strategisch wichtige Insel vor den osmanischen Angreifern retten. Doch Moro hat einen Feind, der sie verrät und eine tödliche Intrige entfacht … Eine Othello-Adaption mit lebendigen Charakteren - Spannung und Emotion pur!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Töchter der Lagune
Roman
Das Mittelmeer um 1570
Für Drehumdiebolzen-Effan, der für mich die Welt aus den Angeln hebt.
Vorbemerkung der Autorin
Prolog
Im Norden Italiens – zwischen Alpen und Adria – liegt die reiche Ebene Venetiens – einst entstanden durch fruchtbaren Mutterboden aus den Bergen, der von reißenden Bächen in die Täler hinabgetragen wurde. Der von diesen Flussläufen angespülte Schwemmsand wird parallel zum Ufer abgelagert, sodass dort Sandbänke entstehen. Zwischen diesen Sandbänken und der Küste liegen Gruppen von kleinen Inseln verstreut über die brackigen Lagunen. Jenseits der Sandbänke auf einem Archipel, das Hunderte von Inseln in der Mitte der Lagune umfasst, thront die Serenissima, die Königin der Meere – Venedig. Ihr Labyrinth von Gässchen und Kanälen schüchtert den Besucher ein und erfüllt den Venezianer mit Stolz und Liebe für seine Stadt.
Nachdem sie während der Kreuzzüge zu einer der wichtigsten Seemächte aufgestiegen war, erlebte die Republik Venedig während des 15. Jahrhunderts ihre Blütezeit als größte Territorialmacht in Oberitalien. Ihr Reichtum hing nicht länger ausschließlich vom Handel mit fernen Ländern ab. Innerhalb der Stadt selbst war eine umfassende Industrie entstanden, welche unter anderem den Buchdruck, die Seiden- und Baumwollweberei, die Glasbläserei, die Holz- und Elfenbeinschnitzerei, Geschützgießereien und vieles mehr umfasste. Bis zum 14. Jahrhundert war Venedig zur beherrschenden Macht in der Adria, der Ägäis und dem Schwarzen Meer aufgestiegen, vertreten in den Häfen Syriens, mit Handelsniederlassungen in Thyrrenien, Sidon und anderen Städten der Levante. Die Annexion Zyperns im Jahre 1489 markierte den Höhepunkt venezianischer Expansion in der Levante.
Diese Vorherrschaft und die Kontrolle der Handelsrouten zwischen Europa und der östlichen Welt machten die Republik zum natürlichen Feind des ebenso expandierenden Osmanischen Reiches, das im Jahre 1453 Konstantinopel der Kontrolle der Serenissima entriss. Als gut sechzig Jahre später auch Ägypten dem Feind in die Hände fiel, war Zypern plötzlich von türkischen Gebieten umgeben. Die europäischen Mächte, die der wachsenden Stärke der Republik Venedig neidvoll gegenüberstanden, ließen sie im Kampf gegen die islamische Macht im Stich. Die Venezianer waren daher gezwungen, den Türken nahezu ohne fremde Hilfe entgegenzutreten. Zunächst gelang es der Republik, durch hohe Tributzahlungen an Süleyman den Prächtigen eine Konfrontation zu vermeiden. Nachdem es allerdings seit 1522 im Mittelmeerraum immer wieder zu türkischen Vorstößen gekommen war, beschloss die Serenissima, sich auf einen osmanischen Angriff vorzubereiten. Sie entsandte den namhaften Festungsbauer Giovanni Girolamo Sanmichele, um die Befestigungsanlagen der Zitadellen von Famagusta, Nikosia und Kyrenia zu verstärken, womit sie sich den Zorn des türkischen Feindes zuzog. Als im Jahre 1569 das gesamte Magazin des Arsenals in Venedig – der größten Schiffswerft der Welt – in die Luft flog, glaubte Sultan Selim II. die Republik geschwächt und wagte einen Großangriff auf Zypern.
Die Eroberung der Insel reizte den Sultan nicht nur aufgrund ihrer strategisch wichtigen Lage, sondern weil sie ihm zusätzliche Einnahmen bescheren und den Nachschub an seinen Lieblingsweinen sichern würde. Durch die Vorherrschaft im östlichen Mittelmeer würde er gleichfalls in der Lage sein, die Pilgerroute nach Mekka zu sichern, die in der Vergangenheit immer wieder durch Kreuzzug führende Galeeren aus den Häfen Zyperns gefährdet worden war. Am 1. Juli 1570 tauchte die türkische Flotte mit 350 Schiffen vor der Westküste der Insel auf und warf Anker vor Larnaka. Der türkische Kommandant, Lala Mustafa Pascha, schickte Aufklärer ins Innere, um die Stärke und den Widerstandswillen der Siedlungen auszukundschaften. Nikosia und Kyrenia fielen, und Famagusta blieb die letzte befestigte Stadt, die es gegen die Feinde zu verteidigen galt. Im Oktober 1570 führte Mustafa Pascha seine gewaltige Armee gegen Famagusta, nachdem die Venezianer sich geweigert hatten, das Ultimatum Selims II. einzuhalten und Zypern an die Türken abzutreten. Die Venezianer waren der osmanischen Flotte um ein Vielfaches unterlegen und die Chancen eines Sieges daher vernichtend gering. Unter den Verteidigern Famagustas breitete sich Verzweifelung aus. Erst im Januar 1571, nachdem die türkische Flotte für den Winter nach Konstantinopel zurückgekehrt war, erreichten zwölf venezianische Schiffe mit Munition, Proviant und Verstärkung die umkämpfte Küstenstadt.
Kapitel 1
Zypern, die Zitadelle von Famagusta, Dezember 1570
Marcantonio Bragadin, der Gouverneur von Famagusta, war rastlos. Er hatte bereits vor geraumer Zeit Boten nach Venedig gesandt, um den Senat über die verzweifelte Lage der Stadt zu informieren, aber bisher hatte ihn noch keine Antwort erreicht. Sie benötigten dringend mehr Männer, Munition und Nahrungsmittel, ansonsten würden sie sich der türkischen Belagerungsmacht ergeben müssen. Obwohl die osmanische Flotte über den Winter nach Konstantinopel zurückgekehrt war, hatte sich die Lage kaum entspannt. Die Landmacht, die in Pomodamo ihr Lager aufgeschlagen hatte, war immer noch Furcht einflößend genug – auch wenn das Dorf drei Meilen südlich von Famagusta lag. Er befürchtete, dass die Angriffe, die sie zurzeit erfuhren, nur einen Vorgeschmack auf Zukünftiges darstellten, und was nutzte ihnen der ungehinderte Zugang zum Hafen, wenn es keine verbündeten Schiffe gab, die dort landeten.
Die See gab sich ruhig an diesem Tag, denn das Wetter war umgeschlagen. Anstelle des stürmischen Klimas, das sie in den letzten paar Wochen hatten ertragen müssen, strich nun ein sanfter, warmer Wind von Osten her über das Land. Der Gouverneur stand auf den Zinnen des trutzigen Rundturms der Zitadelle, der sogenannten Seefestung, die nach Osten wies. Die Zitadelle mit den dicken Mauern und dem ausgeklügelten Verteidigungssystem war eine Festung innerhalb der Festung – der letzte Kern des Widerstands, sollte die Stadt fallen.
Die Palmen und Zypressen wiegten sich in der sanften Brise und Marcantonio hätte die Wärme der Dezembersonne genossen, wäre er nicht von Sorge zerfressen gewesen. Falls sich die Verstärkung nicht beeilte, würde bald nichts mehr übrig sein, das verstärkt werden konnte. Die Türken griffen nun seit beinahe drei Monaten ohne Unterlass den äußeren Verteidigungsring an und, er seufzte innerlich, noch hielt er stand. Aber wie lange noch? Hinter sich hörte er den dumpfen Donner der Kanonen. Er wusste, dass der ununterbrochene Beschuss der Stadtmauern nur ein einziges Ziel verfolgte: sie in der Stadt einzuschließen und dazu zu zwingen, ihre Vorräte aufzubrauchen. Famagusta war zu einem gewaltigen Gefängnis geworden. Die schrill tönende Alarmglocke riss ihn aus seinen Gedanken. Er wurde im Kampf gebraucht. Hastig stürzte er die Stufen ins Innere der Festung hinunter.
*******
Venedig, eine Casa in der Nähe der Piazza San Marco, Dezember 1570
„Wie kannst du es wagen?!“ Angelina funkelte ihre Schwester Desdemona wütend an, die braunen Augen dunkel vor Zorn. Ihre schlanke Silhouette wurde von den Strahlen der frühen Morgensonne, die zaghaft durch das hohe Doppelfenster fielen, hervorgehoben. Bei Desdemonas Zurechtweisung war sie herumgewirbelt, wobei ihr langes schwarzes Haar und die sich bauschende Camicia der abrupten Bewegung mit einem flüsternden Geräusch folgten. Ihre hübschen Gesichtszüge waren vor Wut verzerrt, und die Erregung malte rote Flecken auf ihre ansonsten makellos weißen Wangen. „Du kennst ihn ja überhaupt nicht!“ Sie schleuderte ihrer Schwester die Worte entgegen, als ob die bloße Heftigkeit, mit der sie sie hervorstieß, den ungeheuerlichen Vorwurf auszulöschen vermochte.
Desdemona saß in eine leichte Leinendecke gewickelt mit gekreuzten Beinen auf dem ausladenden Himmelbett. Ihre hüftlangen, blonden Locken waren vom Schlaf zerzaust, doch ihre intelligenten blauen Augen ruhten mit einem überraschten und gleichzeitig verletzten Ausdruck auf Angelinas hochrotem Gesicht. Die beiden Mädchen hatten die Nacht nach dem gestrigen Ball zusammen verbracht – Angelina war zu aufgewühlt gewesen, um in ihrer eigenen Kammer zu schlafen. Desdemona hatte versucht, das Thema in den frühen Morgenstunden anzuschneiden, als es ihr endlich gelungen war, ihre Schwester davon zu überzeugen, dass es an der Zeit war, sich zurückzuziehen. Doch Angelina hatte ihr keine Gelegenheit gegeben, ihre Zweifel über die Natur von Cesares Aufmerksamkeiten zu äußern. Nachdem sie dem vernarrten Geplapper ihrer Schwester zugehört hatte, während sie sich die unzähligen Lagen Kleidung vom Leib schälte, war sie schließlich zu müde gewesen, um zu streiten. Aber nun, nach ein paar Stunden erfrischenden Schlafes, fühlte sie sich der Aufgabe gewachsen, ihre Schwester zur Vernunft zu bringen. „Ja, du hast recht.“ Sie hob beschwichtigend die Hand, um Angelina davon abzuhalten, sie zu unterbrechen. „Aber du kennst ihn nicht richtig. Alles, was du weißt, ist, dass er der Sohn irgendeines Adeligen ist.“ Angelina warf trotzig den Kopf in den Nacken. „Und ich weiß, dass er mich liebt!“, rief sie wütend aus. „Er hat es mir gestern Abend gesagt, als er mit mir getanzt hat!“
Der Ball, den ihr Vater in ihrer Casa – einer schamlosen Untertreibung für den prächtigen Palazzo, in dem sie lebten – gegeben hatte, war ein Fest für die Sinne gewesen. Wieder einmal hatte die Oberschicht von Venedig es verstanden, die Luxusgesetze zu umgehen, die der neue Doge erst ein paar Monate zuvor erneuert hatte. Daher hatten sie, anstatt ihren Reichtum mit prunkvollen Übergewändern zur Schau zu stellen, auf den alten Trick zurückgegriffen, mehrere Schichten unscheinbarer, bescheidener Kleidung über Untergewändern von unbeschreiblicher Schönheit und Finesse zu tragen. Indem sie die Ärmel und Röcke ihrer Wämser und Kleider aufschlitzten, hatten die Signori und Signore dafür gesorgt, dass all die kostbaren Einzelheiten ihrer Garderobe dem Auge des eifersüchtigen Betrachters nicht entgingen. Angelina war eine der atemberaubendsten Signorine gewesen – das schwarze Haar und die makellose Haut unterstrichen von einem reich bestickten, mokkafarbenen Kleid. Sie hatte bewusst darauf verzichtet, andere Juwelen anzulegen außer einer Auswahl von bläulichen Perlen, die wie zufällig aus ihren aufgetürmten Locken hervorschimmerten. Die Augen aller jungen Edelleute waren ihr gefolgt, als sie die lange Treppenflucht zum Ballsaal hinabgestiegen war. Insbesondere ein junger Mann war den ganzen Abend nicht dazu in der Lage gewesen, seinen Blick von ihr loszureißen, und aus genau diesem Grund war Desdemona besorgt.
Cesare di Luigno war einer der berüchtigtsten Frauenhelden von Venedig. Desdemona hatte über Christoforo Moro von ihm erfahren, das letzte Mal als dieser Gast im Hause ihres Vaters gewesen war. Einen Moment lang schweiften ihre Gedanken zu dem stattlichen General ab, dessen Bild sie tagein, tagaus verfolgte. Wann hatte sie ihn das letzte Mal gesehen? Vor zwei Monaten? Oder waren es sogar schon drei? Sie unterdrückte ein Seufzen und das aufsteigende Gefühl der Sehnsucht. Sicherlich würden er und die venezianische Flotte den Zwist mit den Türken schon bald für die Lagunenstadt entscheiden, sodass er endlich wieder zurückkehren und ihrem Leben einen Sinn geben würde. Sie verscheuchte den Gedanken an ihn mit einer ungeduldigen Geste, wodurch sie den zusammengekniffenen Blick ihrer Schwester auf sich lenkte. Desdemona zog vorsichtig das rechte Bein unter ihrem Gesäß hervor und streckte es, wobei sie gleichzeitig die Decke enger um ihren Körper schlang. Sie seufzte. „Angelina.“ Ein flehender Ausdruck trat in ihre Augen. „Bitte glaube mir. Der Mann ist nur hinter deiner Mitgift her.“ Mit einer wütenden Bewegung verschränkte Angelina die Arme vor der Brust und schnaubte verächtlich. „Wieso denkst du so etwas?“, focht sie Desdemonas Feststellung an. „Du weißt ja nicht, wie er mich in seinen Armen gehalten hat, wie er mich angesehen hat.“ Sie hielt inne und stieß einen tiefen Seufzer aus. „Wenn du den Ausdruck in seinen Augen gesehen hättest, würdest du nicht so reden!“ Sie trat näher ans Bett und warf sich bäuchlings neben ihre Schwester. Desdemona legte ihr eine beschwichtigende Hand auf den Rücken und begann, mit ihrem Haar zu spielen. Geistesabwesend wickelte sie sich eine Strähne von Angelinas rabenschwarzen Locken um den Zeigefinger, während sie aus dem Fenster starrte und den Tanz der winzigen Staubkörnchen im Sonnenlicht verfolgte. „Lass das!“ Angelina rollte sich auf den Rücken und riss Desdemona unwillig ihr Haar aus der Hand, bevor sie sich auf die Ellenbogen stützte. „Du bist doch nur eifersüchtig!“ Sie blitzte ihre Schwester wütend an. Desdemona wandte sich ihr zu und schüttelte langsam den Kopf. „Nein“, sagte sie ruhig. „Aber ich weiß, dass du nicht die einzige reiche Signorina bist, der er geschworen hat, sie bis ans Lebensende zu lieben.“ Als sie den schockierten Ausdruck auf Angelinas Gesicht sah, fuhr sie schnell fort, ehe ihre Schwester sie unterbrechen konnte. „Er spielt mit unerfahrenen jungen Frauen, die noch nicht wissen, was Liebe bedeutet.“ Sobald die Worte ihren Mund verlassen hatten, hätte sie sich am liebsten die Zunge abgebissen. Anstatt ihre zornige Schwester zu besänftigen, hatten sie zur Folge, dass sie aufsprang, die Hände in die Hüften stemmte und sie wutentbrannt anstarrte.
„Was?!“ Ihre braunen Augen funkelten vor Entrüstung. „Hört nur, wer da spricht!“ Sie fuchtelte mit dem Zeigefinger vor Desdemonas Gesicht herum. „Bist du nicht diejenige, die sich heimlich mit einem Mann trifft?“ Sie überlegte einen Moment. „Christoforo Moro, nicht wahr? Er ist doch einer der Generäle der venezianischen Armee!“ Sie war sichtlich stolz auf diese Information. „Glaubst du nicht, dass seine Absichten ebenso durchsichtig sind wie die, die du Cesare unterstellst?“ Desdemona öffnete den Mund, um etwas auf diesen törichten Vorwurf zu erwidern, doch Angelina fuhr hastig fort. „Wenigstens ist Cesare nicht zwanzig Jahre älter als ich!“ Desdemona verdrehte die Augen und zwang sich zur Ruhe. Sicherlich sah sie Christoforo in letzter Zeit häufig, aber ihr Vater war über diese Zusammenkünfte informiert. Er hatte sie sogar dazu ermutigt, ihm und Christoforo Gesellschaft zu leisten, wenn der General über seine Abenteuer berichtete, da es ihm zu schmeicheln schien, einen so willigen Zuhörer gefunden zu haben wie sie. Sie war sich ihrer Gefühle für ihn nicht sicher gewesen bis zu dem Morgen, an dem er nach Kreta aufgebrochen war. Erst in der tristen Morgendämmerung hatte sie verstanden, dass das leere Gefühl in ihrer Brust, die dumpfe Angst, die sie des Schlafes beraubte, Liebe sein musste. Liebe für den Mann, in dem sie zunächst nur einen väterlichen Freund gesehen hatte.
Sie konnte die Gedanken ihrer Schwester nachvollziehen, zumal diese im Moment von Wut angefacht wurden. Allerdings war Christoforos Familie so unanständig reich, dass sie sicher sein konnte, dass er nicht hinter ihrem Vermögen her war. Zudem war er in vornehmen Kreisen trotz seiner Herkunft hoch angesehen. Er hatte ihr berichtet, wie es dazu gekommen war, dass er – ein Mann mit maurischem Aussehen – der Sohn eines venezianischen Edelmannes war. Sein Vater war in Nordafrika stationiert gewesen, als er sich unsterblich in die Tochter eines einheimischen Fernhändlers verliebt hatte. Sie hatten ohne die Zustimmung seiner Eltern geheiratet, die über den Affront so schockiert waren, dass sie ihn beinahe aus der Familie verstoßen hätten, als die Nachricht sie erreichte. Als ihr Sohn jedoch mit einer wunderschönen Braut zurückgekehrt war und zudem noch ein immenses Vermögen zur Rettung des maroden Familienbesitzes mitbrachte, waren sein Großvater und seine Großmutter versöhnt gewesen. Es gab zwar immer noch einige Familien in Venedig, die ihn als Bastard oder gar Schlimmeres betrachteten, doch er hatte mit seinen Taten unter Beweis gestellt, dass er weitaus mehr wert war als die meisten der reinblütigen Venezianer. Der Doge selbst achtete ihn so hoch, dass er ihm die wichtigsten Staatsgeheimnisse anvertraute.
Die Leinendecke, in die sie sich gehüllt hatte, war Desdemona von den Schultern geglitten und zitternd zog sie den dünnen Stoff wieder um sich. Die feinen Härchen auf ihren Armen standen zu Berge. Es war nicht übermäßig kalt in Venedig zu dieser Jahreszeit – sie hatten immer noch über zehn Grad – und der Raum wurde von einem prasselnden Holzfeuer in dem großen Kamin geheizt. Aber sie war übermüdet und hungrig. Mit traurigen Augen blickte sie zu Angelina auf. Sie wollte sich nicht mit ihr streiten. Immerhin liebte sie ihre kleine Schwester mehr als sonst jemanden auf dieser Welt. Nun ja, beinahe. Jedenfalls konnte sie nicht tatenlos dabei zusehen, wie ihre Schwester kopfüber in ihr Unglück rannte, ohne alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sie davon abzubringen, diesen Mann wiederzusehen. „Christoforo mag vielleicht älter sein als ich“, erwiderte sie ruhig. „Aber wenigstens ist er kein verweichlichtes Püppchen!“ Sah Angelina denn nicht, wie lächerlich sich Cesare machte, wenn er wie ein Pfau durch die Stadt stolzierte? Und wie weich seine Gesichtszüge waren?! Beinahe weibisch. Ohne auf den empörten Ausdruck auf dem Gesicht ihrer Schwester zu achten, fuhr sie fort: „Christoforo ist ein Kämpfer, ein Mann, der sein Leben opfern würde für diejenigen, die er liebt. Wenigstens könnte ich mich bei ihm sicher fühlen, wenn er mein Gemahl wäre!“ Sie errötete leicht, als sein Körper vor ihrem inneren Auge Gestalt annahm. Die breiten Schultern, die starke Kinnlinie und der energische Mund. Er überragte sie um mehr als einen Kopf, und obwohl er über dreißig sein musste, zeigte sein dichtes schwarzes Haar noch keine Anzeichen von Grau.
„Hah!“ Angelina warf die Hände in die Luft. „Es ist mir egal, wie Cesare aussieht!“, rief sie aus. „Ich weiß, dass es Liebe ist! Er ist derjenige, auf den ich gewartet habe.“ Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und sie wandte sich hastig ab, um sie zu verbergen. Langsam ging sie zum Fenster zurück und schwieg einen Augenblick, wobei sie die Arme um ihren schmalen Körper schlang. Mit ihren vierzehn Jahren war sie fraulich, wenn auch außergewöhnlich schlank. Sie hatte einen vollen Busen und wohlgeformte Hüften. Als sie die Fassung wieder erlangt hatte, fuhr sie – immer noch aus dem Fenster starrend – fort: „Ich liebe ihn, und ich weiß, dass er mich auch liebt. Ohne ihn wäre mein Leben öde und leer.“ Mit entschlossener Miene fuhr sie herum. „Ich werde nicht zulassen, dass du ihn verleumdest oder schlechtmachst! Mein Herz schlägt schneller, wenn ich nur an ihn denke, und mein Blut kocht über, wenn er in meiner Nähe ist.“ Mit einer Bewegung, die sie, so hoffte Desdemona, niemals in der Öffentlichkeit wiederholen würde, strich sie mit der rechten Hand über ihren linken Arm. Desdemona beschloss, noch einen letzten Versuch zu unternehmen, bevor sie aufgab. „Glaubst du nicht, dass es möglich wäre, dass du nur in das Gefühl des Verliebtseins vernarrt bist?“ Ihr war klar, dass diese Frage einer Beleidigung gleichkam, da sie die Gefühle ihrer Schwester infrage stellte, aber es war ihr gleichgültig. Wenn es half, eine Katastrophe abzuwenden, würde Angelina ihr vergeben.
Als sei sie in der Bewegung eingefroren, starrte Angelina sie ungläubig an. Dann raffte sie ihre Kleider vom Boden auf und stürmte, ohne die Frage beantwortet zu haben, aus dem Zimmer, die Wangen von heißen Tränen überströmt. Desdemona seufzte. Sie hoffte nur, dass niemand Angelina dabei sah, wie sie nur mit einer Camicia
Kapitel 2
Venedig, eine Casa am Rialto, Dezember 1570
Elissa di Morelli war aufgewühlt. Kopflos rannte sie vom Kleiderschrank zur Truhe und wieder zurück, wobei sie Kleider und Habseligkeiten in den bereits überfüllten Holzkoffer warf, nur um sie kurz darauf wieder herauszuziehen. Sie hatte ihre Zofe geschickt, ihre Juwelen zu holen, da sie in der großen Stadt wie eine Dame aussehen wollte. Was trugen die Frauen in Rom nur? Sie hatte gehört, dass die Signore in der beängstigend riesigen Stadt unglaublich elegant sein sollten. Ihr Vater musste sich um sein Geschäft kümmern, musste Verträge unterzeichnen, Klienten besuchen, und er hatte Gattin und Tochter gefragt, ob sie ihn auf der Reise um die Halbinsel begleiten wollten. Sie würden mit dem Schiff reisen, da dies um vieles schneller und sicherer war als der Landweg. In Rom würden sie der weltberühmten Sixtinischen Kapelle einen Besuch abstatten, und sie würde endlich die unvergleichlichen Freschi des großen Meisters Michelangelo zu Gesicht bekommen! Einer der Geschäftsfreunde ihres Vaters hatte eine Skizze des namhaften Künstlers erworben und sie ihr voller Stolz gezeigt. Der Entwurf war so unbeschreiblich schön gewesen, dass Elissa vor Bewunderung die Luft angehalten hatte.
Sie hielt zwei Kleider hoch, eines in jeder Hand, unfähig zu entscheiden, welches sie einpacken sollte. In der Truhe war nicht mehr viel Platz, und ihr Vater hatte ihr unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass die Menge an Gepäck, die sie würde mitnehmen können, beschränkt war. Er hatte halb scherzhaft bemerkt, dass er auf keinen Fall eine zusätzliche Gondel nur für die Koffer seiner Frau und Tochter mieten wollte. Seine Augen hatten gelacht, als er das gesagt hatte, doch sein Mund war zu einer strengen Linie zusammengekniffen. Und sie wusste sehr genau, dass es ihm ernst war, wenn er sie so ansah. Sie trat näher an den großen, goldgerahmten Spiegel, der das wichtigste Möbelstück im Zimmer darstellte. Immer noch nur mit einem Untergewand bekleidet, hatte sie sich noch nicht entschieden, was sie darüber tragen sollte. Vielleicht konnte sie eines der Kleider anlegen und das andere einpacken. Sie legte das rote Gewand auf einen einfachen Stuhl neben dem Spiegel und hielt sich das goldene an, um zu sehen, wie sie darin aussah. Die Farbe passte hervorragend zu ihrem hellblonden Haar und den blauen Augen, ließ sie jedoch sonnengebräunt erscheinen wie eine Bäuerin. Mit einem unwilligen Laut schob sie die Unterlippe vor und kniff die Augen zusammen. Wie sie ihre Haut hasste! Wie gern würde sie auch über die edle Blässe ihrer Mutter und der anderen Signore verfügen, obschon sie vermutete, dass diese nicht ganz natürlich war. Sie zwickte sich in die Wange und betrachtete versonnen die leichte Rötung, die sich daraufhin ausbreitete. Warum, um alles in der Welt, konnte sie nicht die Färbung eines Schwanes haben – so wie die Mode es verlangte?! Warum, bei allen Heiligen, musste sie aussehen wie eine Walnuss, die man in der Sonne getrocknet hatte? Ärgerlich über sich selbst fegte sie ihr Haar aus der Stirn, legte den Kopf schief und begutachtete ihre Erscheinung von Kopf bis Fuß. Mit dem Rest ihres Körpers war sie mehr oder weniger zufrieden, auch wenn sie sich manchmal wünschte, ihre Hüften wären ein wenig ausladender und ihre Brust ein wenig voller. Kopfschüttelnd wandte sie sich nach einigen Augenblicken vom Spiegel ab und blinzelte den Ärger beiseite.
Gerade als sie das goldene Kleid niedergelegt hatte, um sich das rote anzuhalten, wurde die Tür zu ihrer Kammer aufgerissen und Maria, ihre Zofe, kam hereingeeilt. „Beeilt Euch, Signorina, der Herr hat mir befohlen, Euch wissen zu lassen, dass wir in weniger als zwei Stunden aufbrechen!“ Elissa schrak zusammen und das Kleid glitt ihr aus der Hand. „Dio mio, Maria!“, rief sie aus. „Ich habe mich zu Tode erschreckt!“ Ihr Herz hämmerte heftig gegen ihre Rippen und die Aufregung schlug wie eine Welle über ihr zusammen. Zwei Stunden! Warum hatte sie nicht früher angefangen zu packen?! Ihre Mutter hatte sie immer wieder ermahnt, aber sie hatte noch so viel Zeit gehabt bis zu ihrer Abreise. Und jetzt, ganz plötzlich, war der Tag gekommen und sie hatte noch kaum etwas verstaut. „Ich werde Euch zur Hand gehen.“ Maria, die schon Elissas Amme gewesen war, trat zu ihr und hob das rote Gewand auf. „Zieht dieses an“, empfahl sie. „Darin seht Ihr frisch und jung aus.“ Elissa nahm ihr gehorsam das Kleid aus der Hand und kämpfte sich hinein. Als sie es schließlich zurechtgezupft hatte, wandte sie Maria den Rücken zu, damit diese sie zuschnüren konnte. „Nicht so eng“, keuchte sie. „Das tut weh!“ Maria legte, so wie die meisten der älteren Frauen, die Erbarmungslosigkeit eines Soldaten an den Tag, wenn es darum ging, gut auszusehen. „Beklagt Euch nicht. Ihr werdet dankbar sein, wenn Ihr heute Eurem zukünftigen Gemahl begegnet.“ Elissa verdrehte die Augen. Warum waren nur alle so scharf darauf, sie zu verheiraten? Sie war schließlich erst dreizehn Jahre alt, und die meisten Mädchen verlobten sich nicht, bevor sie fünfzehn waren. Während Maria ihr Haar flocht und sie mit Schmuck behängte, breitete sich ein Schwarm Schmetterlinge in ihrem Bauch aus, und sie malte sich aus, was sie in Rom alles erleben würde.
*******
Venedig, Arsenal, Dezember 1570
Francesco di Lamones Erschöpfung war beinahe greifbar. Nicht nur seine Augen und Muskeln brannten wie Feuer, auch sein Rücken schien von einer unsichtbaren Last gebeugt. Erst vor Kurzem war die venezianische Flotte von ihrem fruchtlosen Ausflug nach Kreta zurückgekehrt, und noch immer schien sich der Boden unter seinen Füßen im Rhythmus der Wellen zu bewegen. Der Allianz war es nicht gelungen, zu einer Übereinstimmung über die weitere Vorgehensweise zu gelangen, um den Einwohnern von Famagusta, der letzten befestigten Stadt auf Zypern, die dem Feind Widerstand leistete, zur Hilfe zu kommen. Nikosia war gefallen, und die schrecklichen Verluste hatten Kyrenia dazu veranlasst, sich dem furchterregenden osmanischen General Lala Mustafa Pascha zu ergeben. Seit Oktober dieses Jahres war Famagusta vom Feind umzingelt, wobei die lächerlich kleine Streitmacht der Venezianer im Inneren der Stadt den Türken um ein Vielfaches unterlegen war. Die Stimmung an Bord seines Schiffes war während der Überfahrt zurück nach Venedig gedrückt gewesen, da die meisten der Männer ob der Tatenlosigkeit der Allianz frustriert waren. Obgleich ihr General, Christoforo Moro, sich als ein fähiger Verhandlungsführer erwiesen hatte, war es ihm nicht gelungen, ein Wunder zu bewirken.
Trotz der bleiernen Müdigkeit und des sehnlichen Wunsches, sich einige Stunden auszuruhen, war Francesco tief beeindruckt von der riesigen Werft im Herzen der Lagunenmetropole und der Arbeit, die seine fähigen Mitbürger dort verrichteten. Das Arsenal war eine Stadt innerhalb der Stadt. Über 16 000 Schiffsbauer und 36 000 Seeleute waren dort beschäftigt, und er hatte gehört, dass die gewaltige Werft alle einhundert Tage eine neue Galeere fertigstellte. Zudem konnten die meisten venezianischen Handelsschiffe in Kriegsschiffe umgewandelt werden, da auf Befehl der Stadtregierung jede Karavelle dazu verpflichtet war, eine bestimmte Anzahl von Armbrüsten, Speeren und Rüstungen mit sich zu führen. Zurzeit wurde eine Reserve von einhundert Kriegsgaleeren im Arsenal instand gehalten, das von drei Magistraten überwacht wurde. Diese bewohnten drei offizielle Gebäude mit den Namen Paradiso, Purgatorio und Inferno. Francesco, der als Knabe die Divina Comedia verschlungen hatte, hatte sich ein Grinsen verkneifen müssen, als ihm gesagt worden war, er solle sich beim Magistrat im Inferno melden.
Der Major Jago, sein vorgesetzter Offizier, hatte ihn ausgesandt, um in Erfahrung zu bringen, wie hoch die genaue Anzahl der Schiffe war, die zum Auslaufen bereitlagen. Er war nicht über den Grund für diesen Auftrag informiert worden, allerdings glaubte er zu wissen, dass Venedig versuchen würde, den Eingeschlossenen im Alleingang zu Hilfe zu kommen. Neben den Erkundigungen über segelfertige Schiffe sollte er außerdem das wieder aufgebaute Pulvermagazin des Arsenals inspizieren, um seinen Vorgesetzten darüber in Kenntnis zu setzen, wie viele Kanonen und Munition verfügbar waren. Das Magazin war im vergangenen Jahr durch eine Unachtsamkeit in die Luft gejagt worden, und eine Menge Menschen waren dabei zu Tode gekommen. Kurz nach dem schrecklichen Unglück hatte der Doge befohlen, es sicherer und moderner wieder aufzubauen und inzwischen waren die Arbeiten beendet. War die Schiffswerft mit den riesigen hölzernen Skeletten, aus denen einmal Kriegsschiffe werden würden, und den hektischen Menschenknäueln, die geschäftig an ihm vorbeigeeilt waren, schon beeindruckend gewesen, so übertraf das Magazin Francescos kühnste Träume. Ordentlich aufgereihte Kanonen in unterschiedlichen Größen und Kalibern flankierten die westliche Wand. Neben den Kanonen türmten sich pyramidenförmig gusseiserne Kanonenkugeln, die jedes Schiff, das sie trafen, auf den Grund des Meeres schicken würden. Es gab Musketen in hölzernen Ständern und Kisten voller Pistolen. Säcke mit Pistolenkugeln waren in einer Ecke bis beinahe unter das gewölbte Dach aufgestapelt. Pulverfässer balancierten gefährlich übereinander, und Francesco versuchte, sich vorzustellen, welche Auswirkungen wohl eine brennende Zündschnur in diesem riesigen Raum haben würde.
Kapitel 3
Konstantinopel, Topkapi Palast, Dezember 1570
Selim II. amüsierte sich großartig. Er lag zurückgelehnt auf seinem Diwan, einen Kelch seines besten süßen Rotweines in der einen, das pechschwarze Haar Hülyas, seiner neuesten Errungenschaft, zwischen den Fingern der anderen Hand. „Mach weiter“, befahl er und zwang ihren Kopf zurück an die richtige Stelle, als sie begann, sich aufzurichten. Er hatte zwar bereits einen Höhepunkt erreicht, aber er wollte nicht, dass sie aufhörte – es war einfach zu gut. Er fühlte erneut, wie sich ihre warmen Lippen um ihn schlossen, und stöhnte vor Lust. Während er sich den göttlichen Fähigkeiten seiner neuen Sklavin hingab, grübelte er über den Feldzug nach, zu dem er sich schon vorher hätte durchringen sollen. Wenn alles so lief, wie er es plante, dann würde er seine Feinde schon bald zerquetschen wie lästige Insekten. Sie waren schwach, dekadent – wie all die anderen, die diesem lächerlichen Propheten huldigten. Dem Sohn Gottes! Was für eine aberwitzige Idee! Es kümmerte ihn nicht im Geringsten, an was die Menschen glaubten, ihm selbst war Allah vollkommen gleichgültig, aber ganz offensichtlich verwandelte ihre Religion die Christen in Feiglinge. Sein Vater war viel zu tolerant gewesen; er war vieles gewesen, was er selbst niemals sein würde. Er wusste genau, dass die meisten seiner Untertanen ihn insgeheim für seine unstillbare Lust nach gutem Essen, Wein und wilden Liebesspielen verachteten, aber das focht ihn nicht an. Ebenso unberührt ließ ihn die altmodische Vorstellung der Pflichten eines Sultans, über die sein Großwesir Mohammed Sokolli pausenlos ermüdende Vorträge hielt. Er hatte kein Interesse daran, die Gesetze und deren Ausübung in seinem Reich durch die Regierungsbeamten zu überwachen. Sollten sie doch so korrupt sein, wie sie wollten, und ihre Macht missbrauchen, was scherte es ihn?! Alles, was ihn im Moment interessierte, war Hülya zwischen seinen Beinen.
*******
Venedig, Piazza San Marco, Dezember 1570
Christoforo Moro war von Bord des sich leise im Wasser der Lagune auf und ab bewegenden Kriegsschiffes gegangen und hatte, nachdem er sich in seinem ungeheizten Haus umgezogen hatte, umgehend Signor Brabantios Casa aufgesucht. Von dem Diener, der ihm die hohe Eichentür geöffnet hatte, war er davon in Kenntnis gesetzt worden, dass sich die ganze Familie beim Gottesdienst befand, und so hatte er dem prächtigen Palazzo den Rücken gekehrt und war in Richtung San Marco davongeeilt. Er mochte den alten Senator. Brabantio hatte seine Bewerbung für den Senatsposten unterstützt, während ihm viele der anderen Mitglieder der altehrwürdigen Kammer wegen seiner Herkunft feindlich gesinnt gewesen waren. Es war Brabantios feurige Rede gewesen, welche die allgemeine Meinung über ihn hatte umschlagen lassen. Wie alle Söhne aus adeligem Hause hatte Christoforo im Alter von fünfundzwanzig Jahren die Zulassung zum Großen Rat beantragt, um später in den kleineren, wesentlich exklusiveren Kreis des Senates aufsteigen zu können. Der Oligarchie der Serenissima, der „Modellrepublik“, wie sie sich selbst so gerne nannte, lagen außerordentlich strenge Regeln und Gesetze zugrunde. Sein Vater, Sohn einer angesehenen Familie, hatte diese Regeln verletzt, indem er eine Fremde zur Gemahlin genommen hatte. Und die Republik vergab Fehler nur äußerst selten.
Als er sich dem Hauptportal der prächtigen Kirche näherte, fiel sein Blick bewundernd auf das Gespann der Bronzepferde, das über dem Eingang prangte. Für Christoforo waren sie der Inbegriff venezianischer Arroganz. Denn sie zeugten von dem Talent der Inselbewohner, andere Länder und Machthaber zu provozieren. Im Jahre 1201 aus Konstantinopel geraubt, waren sie ein Dorn im Auge so mancher ausländischer Delegation. Er durchmaß den langen Schatten des hoch über ihm aufragenden Campanile und zügelte seine Schritte vor der Westfassade des Domes. Er würde lieber draußen warten, da der Gottesdienst inzwischen beinahe zu Ende sein musste. Selbst im dämmerigen Licht des wolkenverhangenen Dezembertages war das Bauwerk beeindruckend. Drei der fünf Kuppeln, die wie er fand, eine nicht zu verleugnende Ähnlichkeit mit einer weiblichen Brust hatten, waren von seinem Standpunkt aus sichtbar. Über den Porte waren die byzantinischen Rundbögen mit Freschi in leuchtenden Farben dekoriert. All die Bögen und Säulen und Türmchen gaben dem massigen Gebäude den Anschein von Leichtigkeit und Verspieltheit, als wäre sich der Baumeister nicht über die Schwere seiner Materialien im Klaren gewesen. Als er gerade über die Frage nachgrübelte, wie lange es wohl noch dauern würde, bis er die schöne Desdemona wiedersah, wurde sein Blick von einem Sonnenstrahl angezogen, der durch die dicke Wolkendecke brach und von einem geflügelten Löwen zurückgeworfen wurde. Ihm war dieser Teil der Kirche immer ein wenig pompös erschienen, doch nun, im Licht des grauen Dezembertages, war der Effekt atemberaubend. Bevor er sich jedoch in dem Anblick verlieren konnte, verkündeten die Kirchenglocken dröhnend das Ende der Messe. Er schlenderte auf die Portale zu und erreichte sie gerade, als zwei livrierte Bedienstete im Begriff waren, sie zu öffnen. Im dunklen Inneren des Gebäudes war es ihm nicht möglich, mehr als eine verschwommene Menge sich bewegender Gestalten auszumachen, und er blinzelte, um besser sehen zu können. Obgleich in dem riesigen Innenraum Kerzen brannten, wurde ein Großteil des warmen Lichtes, das sie verströmten, von der hohen Gewölbedecke des Hauptschiffes verschluckt. Einer der Diener warf ihm einen misstrauischen Blick zu, doch als Sohn einer dunkelhäutigen Mutter war er an diese Art Taktlosigkeit gewöhnt und ignorierte sie.
Desdemona hatte sich bei Vater und Schwester untergehakt, und sobald er sie erblickte, fühlte er, wie sein Herz zu rasen begann. Er hatte sich gleich bei ihrer ersten Begegnung in sie verliebt, hatte jedoch niemals zu hoffen gewagt, dass sie diese Liebe erwidern könnte. Auch jetzt war er sich immer noch nicht sicher, allerdings hatte er geglaubt, etwas wie Schmerz in ihren wunderbar sanften Augen entdeckt zu haben, als er sich von ihr verabschiedet hatte, um nach Kreta zu segeln. Sie trug ein fließendes Gewand von der Farbe reifen Weizens, das perfekt mit ihren blonden Locken korrespondierte, die sie kunstvoll aufgetürmt und unter einem dünnen Schleier versteckt hatte. Um ihre schmalen Schultern lag ein pelzverbrämter Mantel, der sie vor der feuchten Kälte schützen sollte, und den sie enger um ihren Körper schlang, als sie die Piazza betraten. Sobald Signor Brabantio ihn erspähte, machte er sich von seinen beiden Töchtern los und eilte auf ihn zu. „Mein lieber Christoforo!“ Der alte Mann reichte ihm die Hände. „Ich bin froh, dass Ihr zurück seid.“ Als die beiden jungen Frauen sie erreichten, verbeugte Christoforo sich ein wenig steif, da er sich mit einem Mal beklommen fühlte. Desdemona errötete heftig und senkte den Kopf, wohingegen ihre Schwester Angelina ihm lediglich geistesabwesend zulächelte und kurz nickte. „Würdet ihr uns ein paar Minuten allein lassen?“, bat ihr Vater die beiden jungen Frauen, die daraufhin gehorsam nickten. „Wie Ihr wünscht, Papa“, gab Desdemona pflichtbewusst zurück und führte Angelina zurück in Richtung Dom.
Da ein scheußlicher Wind aus Richtung des Canal Grande aufgekommen war, zogen sich die beiden Mädchen in die Nische einer der Porte zurück, um sich vor der schneidenden Kälte zu schützen. „Autsch!“ Angelina wirbelte herum und öffnete den Mund, um Desdemona für den schmerzhaften Rippenstoß, den diese ihr versetzt hatte, zu schelten. Doch als sie den Gesichtsausdruck ihrer Schwester bemerkte, schluckte sie die ärgerlichen Worte und folgte ihrem entsetzten Blick. Was sie sah, vertrieb alles Blut aus ihren Wangen. Verborgen vor den Augen der davoneilenden Kirchgänger, war Cesare in einer Ecke des Gebäudes damit beschäftigt, ausgiebig an den Lippen einer jungen Frau zu saugen, wobei seine Linke auf ihrem ausladenden Hinterteil ruhte, während die andere Hand den weichen Flaum in ihrem Nacken liebkoste. Das Mädchen schien die Aufmerksamkeiten sichtlich zu genießen, da sie ihre Hüften energisch gegen seinen Körper presste. Cesare war dem Anschein nach nicht im Geringsten befremdet über ihr schamloses Verhalten. Das konnte nur eines bedeuten. Wutentbrannt schüttelte Angelina Desdemonas Hand ab, die versuchte, sie zurückzuhalten, und stürmte wie eine Furie auf das eng umschlungene Paar zu, das unbeirrt ekelhafte Knoten mit seinen Zungen flocht. Als Cesare sie aus dem Augenwinkel auf sich zustürzen sah, befreite er sich rasch aus der Umarmung des Mädchens und trat hastig einen Schritt zurück. „Angelina“, stammelte er, das bartlose Gesicht vor Schreck verzerrt. Doch bevor er anheben konnte, die Situation zu erklären, holte Angelina aus und ohrfeigte ihn mit solcher Wucht, dass der Schlag klatschend von den Wänden widerhallte. „Ich will dich nie wiedersehen“, zischte sie durch zusammengebissene Zähne. „Niemals!“ Mit diesen Worten hastete sie an Desdemona vorbei, die ihr gefolgt war, um das Schlimmste zu verhindern, und ließ Cesare vollkommen verblüfft, mit offenem Mund vor seiner neuesten Eroberung stehen, die erschrocken mehrere Schritte zurückgewichen war.
„Warte!“, keuchte Desdemona. Sie setzte ihrer Schwester nach, die auf die Mole zueilte, wo Dutzende kleiner Boote und Gondole fröhlich auf den Wellen tanzten, als ob die Welt um sie herum mit nicht vernehmbarer Musik erfüllt wäre. „Angelina“, rief sie, als ihre Schwester weiter auf die Ponte della Paglia zustürmte, vorbei an den beiden Säulen, auf denen die Markuslöwen thronten und über den Eingang zur Stadt wachten.“Angelina!“, wiederholte sie, als sie die Schwester schließlich erreicht hatte, und griff nach ihrem Arm, um sie aufzuhalten. „Lass mich in Ruhe!“, fauchte die Angesprochene und riss den Arm los. Sie hatte allerdings ihr Tempo verlangsamt, und es war nun einfacher für Desdemona, mit ihr Schritt zu halten. Als sie die östliche Ecke des Dogenpalastes erreicht hatten, hielt Angelina abrupt an und wirbelte herum. Ihre Augen waren gerötet und schwammen in Tränen, während ihr Mund vor Zorn und Traurigkeit zitterte. „Du hattest recht“, presste sie durch zusammengebissene Zähne hervor. Desdemona wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Sie hatte befürchtet, dass so etwas früher oder später passieren würde, allerdings hatte sie nicht erwartet, dass es so offensichtlich sein würde. Angelinas Augen wanderten melancholisch über den Horizont. „Er war nur hinter meiner Mitgift her.“ Sie seufzte und schloss die Augen, zwischen deren Lidern heiße Tränen ihre Wangen hinabströmten. „Nicht.“ Desdemona legte sanft den Arm um die Schultern ihrer Schwester und drückte sie fest an sich. „Er ist es nicht wert.“ Sie streichelte Angelina, die von verzweifeltem Schluchzen geschüttelt wurde, über den Rücken. Während sie versuchte, sie zu beruhigen, ließ sie die Augen über die Fassade des Dogenpalastes wandern. Jedes Mal wenn sie sich auf dem Markusplatz aufhielt, war sie von Neuem überwältigt von seiner Schönheit und Eleganz. Sie hatte das prächtige weiße Gebäude mit den vielen Arkaden, Bogenfenstern und kunstvollen Kapitellen noch niemals betreten dürfen, aber es war ihr größter Wunsch, es eines Tages von innen zu sehen – auch wenn sie wusste, dass das für eine Frau kaum möglich war.
Allmählich ließ Angelinas verzweifeltes Schluchzen nach, und sie begann, ihre Fassung wiederzugewinnen. Desdemona löste sich aus der Umarmung und trat zurück, um eine Strähne des schwarzen Haares, das sich aus der kunstvollen Frisur gelöst hatte, von Angelinas feuchter Wange zu streichen. „Hier, putz dir die Nase.“ Sie reichte ihr das bestickte Taschentuch, welches Christoforo ihr bei seinem letzten Besuch im Haus ihres Vaters geschenkt hatte. Da es ihr das Gefühl gab, in seiner Nähe zu sein, trug sie es immer nahe am Körper. „Danke.“ Angelina gab ihr das Tüchlein zurück und tat einen tiefen Atemzug. „Bastardo“, sagte sie ruhig. „Ich werde keine einzige Träne mehr um dich vergießen!“ Mit diesen Worten hakte sie sich energisch bei ihrer Schwester unter und gemeinsam schlenderten sie zur Piazza zurück.
Sie bogen gerade um die Ecke des Dogenpalastes, als ein Bediensteter in der Livree ihres Vaters auf sie zugeeilt kam. „Signorine, der Herr hat mir aufgetragen, Euch nach Hause zu begleiten“, schnaufte der alte Mann. „Der General und er sind zu einer Senatsversammlung gerufen worden.“ Desdemona war verwundert. „Heute?“, fragte sie ungläubig. Es war Samstag. Der Senat trat zweimal in der Woche zusammen und niemals an Samstagen, soweit sie unterrichtet war. Die Händler und Handwerker arbeiteten alle, wohingegen die Adeligen für gewöhnlich am Wochenende keinerlei Geschäften nachgingen. Es musste etwas Ernstes sein, und sie war besorgt. Was, wenn Christoforo Venedig wieder verlassen musste? Würde sie ihn wiedersehen? Sie grub die Zähne in die Unterlippe und nagte heftig daran, ehe sie dem Diener mit einem hilflosen Achselzucken folgte. Jedenfalls gab es nichts, was sie oder Angelina unternehmen konnten; sie waren dazu verdammt, den Ereignissen um sie herum tatenlos zuzusehen, ohne dazu in der Lage zu sein, irgendwie verändernd einzugreifen.
*******
Venedig, Sala del Senato, Dezember 1570
„Warum?“ Christoforo Moro war von seinem Sitz aufgesprungen und beherrschte nur mit Mühe seine Ungeduld. Wie die anderen Senatoren hatte auch er an der Längsseite des Sala del Senato Platz genommen, aber der Ärger trieb ihn auf die Beine. Der Doge saß wie immer auf der erhöhten Tribüne am Kopfende des Saales. Er war in Scharlachrot gekleidet und eine eng anliegende, zum Hinterkopf hin geschwungene Kappe umschloss seinen Kopf. Rechts und links neben ihm hatten sich die beiden Inquisitori, deren gebeugte Körper von schwarzen Roben bedeckt waren, niedergelassen. Im Moment war sein von Falten durchzogenes Gesicht ernst, und die kleinen, schwarzen Augen verrieten Wachsamkeit und einen scharfen Verstand. Er hob die Hand, um die murmelnde Menge zum Schweigen zu bringen. Beinahe alle der einhundert Mitglieder des Senates waren zugegen – das Thema schien zu schwerwiegend zu sein, um das Treffen versäumen zu können.
„Wir müssen abwarten, was geschieht“, verkündete der alte Mann mit ruhiger Stimme. „Wir haben immer noch keine Nachricht von unseren Spionen.“ Christoforo hätte sich am liebsten die Haare gerauft. „Mit allem nötigen Respekt, Doge“, unterbrach er das Staatsoberhaupt. „Die türkische Flotte hat sich aus Zypern zurückgezogen, um den Winter in der Türkei zu verbringen.“ Er wusste, dass diese Information der Wahrheit entsprach. „Es liegen genug auslaufbereite Galeeren in unseren Hafenbecken und wir haben genügend Soldaten, die mit Freuden gegen die Osmanen ziehen würden.“ Ein junger Mann, der von Jago geschickt worden war, hatte ihn über den Zustand der Flotte informiert. „Wenn wir nicht sofort handeln, könnte es zu spät sein!“ Seine Stimme war eindringlich, und er bemühte sich, die Wichtigkeit seiner Worte mit einer theatralischen Handbewegung zu unterstreichen. Einen Augenblick lang dachte er, er habe sie überzeugt. Der Doge unterhielt sich flüsternd mit seinen beiden Beratern, wobei sich ihre Köpfe bejahend auf und nieder bewegten. Er ließ die Augen von dem Triumvirat auf der Tribüne zu den angespannten Mienen der anderen Senatoren schweifen. Die Versammlung war geteilt. Ungefähr die Hälfte stimmte Christoforos Vorschlag, eine Flotte auszurüsten und den Belagerten unverzüglich zur Hilfe zu eilen, zu. Der andere Teil war der Annahme, es sei weiser, noch einmal mit den Mitgliedern der päpstlichen Liga zu verhandeln und auf deren Unterstützung zu bauen. Christoforo hatte versucht, sie von der Fruchtlosigkeit dieses Unterfangens zu überzeugen, da der letzte Feldzug deutlich gemacht hatte, dass sich die Venezianer nicht auf diesen wankelmütigen Verbündeten verlassen konnten. Hätten sie nicht dem Kommandanten der spanischen Flotte nachgeben müssen, der sich geweigert hatte, Famagusta zur Hilfe zu kommen, hätte die Belagerung verhindert werden können. Da dieser jedoch wegen des nahenden Winters darauf bestanden hatte, um der Sicherheit seiner Schiffe willen in den Hafen zurückzukehren, hatten sie nach Kreta zurücksegeln müssen, ohne etwas zur Erleichterung der Lage Zyperns erreicht zu haben. Es war frustrierend! Und nun musste er auf eine Entscheidung warten, die von Männern gefällt wurde, von denen viele zu alt waren, um wie Soldaten zu denken. Fette, feiste Eber – das war es, was aus den meisten von ihnen geworden war.
Schließlich beendeten die drei Männer am Kopfende des Saales ihre Debatte, und der Doge
Kapitel 4
Konstantinopel, Topkapi Palast, Dezember 1570
Wie lächerlich pompös der Mann war! Mohammed Sokolli, Selims Großwesir, kniete vor seinem Thron, die Stirn auf die blau-weißen Fliesen gepresst. Was, wenn er ihm nicht erlaubte aufzustehen?, dachte Selim einen Moment lang boshaft. Dann müsste er für immer in dieser unbequemen Stellung verharren. Glaubte er denn, Selim würde sein kriecherisches Benehmen nicht durchschauen? Er wusste ganz genau, dass ihn der Großwesir für seine Schwäche und sein Desinteresse an Staatsangelegenheiten verachtete. Allerdings war es ihm vollkommen gleichgültig. „Steh auf“, sagte er schließlich widerwillig und drehte den verzierten Goldpokal in seiner Hand hin und her, wobei sein Inhalt beinahe überschwappte.
Mohammed kämpfte sich auf die Beine. Von Tag zu Tag wurde es schwerer für den alten Mann, sich vor diesem unwürdigen Sprössling Süleymans des Prächtigen, seinem früheren Herrn und Gebieter, zu Boden zu werfen. „Der Rat ist versammelt, Sonne des Ostens“, sagte er gezwungen respektvoll und starrte auf den Saum seines Gewandes. Selim winkte wegwerfend ab. „Ich bin sicher, du kannst das ohne mich regeln, Mohammed.“ Er blickte den kleinen Mann mit zusammengekniffenen Augen an und wartete auf eine verräterische Reaktion. Wenn er nicht so nützlich wäre, hätte er ihn schon längst hinrichten lassen, da seine Anwesenheit ihn stets an seinen Vater erinnerte. Aber das wäre nicht klug gewesen. Immerhin konnte Selim sich durch ihn völlig von seinen offiziellen Aufgaben zurückziehen und seine wertvolle Zeit vielversprechenderen und lohnenderen Aktivitäten widmen. Er schürzte die Lippen und sagte kühl: „Du kannst gehen.“ Mohammed verneigte sich ehrerbietig – die Handflächen vor der Brust aneinandergepresst – und zog sich rückwärtsgehend zur Tür zurück, die von zwei ehrfurchtgebietenden Mitgliedern des Janitscharen Korps, der Leibgarde des Sultans, bewacht wurde. Als er aus Selims Blickfeld verschwunden war, seufzte dieser und setzte den Kelch an die Lippen. Er nahm einen tiefen Zug und genoss das Aroma des schweren zypriotischen Weines, der wie Öl seine Kehle hinabrann. Die Eroberung der Insel war eine gute Entscheidung gewesen.
Als er den Pokal geleert hatte, stellte er ihn achtlos neben seinem Diwan ab und erhob sich. Mit einem mächtigen Rülpser zog er die Schärpe, die sein mitternachtsblaues Gewand zusammenhielt, fest und klopfte sich den Bauch. Er wurde fett. Allerdings gab es nichts, was er dagegen unternehmen konnte. Sich des Essens und Trinkens zu enthalten stand außer Frage. Er hatte dieses Jahr nicht einmal den Ramadan eingehalten. Obgleich er außer dem Amt des Sultans auch den Titel des Kalifen, des obersten Führers des Islam, geerbt hatte, war er außerstande gewesen, von der Morgendämmerung bis zum Einbruch der Nacht zu fasten. Und das auch noch dreißig Tage lang! Das tägliche Beten des Korans war schon ermüdend genug gewesen, wer konnte da noch von ihm erwarten, zudem auch noch nichts zu essen und zu trinken? Er war froh gewesen, als vor drei Tagen schließlich mit dem Ramazan Bayrami, dem Ramadan Fest, das Ende des Fastenmonats begangen worden war. Ohne schlechtes Gewissen hatte er vorgegeben, ebenso erschöpft zu sein wie die anderen Mitglieder seines Haushaltes und Essen in sich hineingestopft, bis er schließlich befürchtet hatte, sein Magen würde platzen. Während er satt und zufrieden an seiner Wasserpfeife gepafft hatte, war ihm der vorwurfsvolle Blick seiner Mutter aufgefallen, den er respektlos grinsend erwidert hatte. Die Zeiten, als er noch Angst vor ihr hatte, waren längst vorbei. Er trat ans Fenster und schaute auf die kobaltblaue See hinunter. Kleine weiße Segel tanzten den Bosporus hinauf auf ihrem Weg vom Schwarzen Meer. Er lehnte sich ein wenig hinaus, um sein heißes Gesicht in der angenehmen Brise, welche die Zypressen sanft wiegte, kühlen zu lassen. Zwar war es nicht besonders warm an diesem Tag, aber der Wein hatte sein Blut erhitzt. Nachdem er einige Zeit lang so verharrt hatte, trat er von dem Fenster zurück und beschloss, sich ein wenig Zerstreuung zu verschaffen.
*******
Venedig, Lido di Venezia, Dezember 1570
Langsam, aber dennoch unaufhaltsam näherte sich ihre Gondel der voll betakelten Karavelle, die vor der Küste Anker geworfen hatte. Mit jedem Eintauchen der Ruderblätter wurde Elissa unruhiger und ihre Wangen vor Aufregung geröteter. Obwohl sie in der Perle der Meere – wie Venedig liebevoll von seinen Einwohnern genannt wurde – aufgewachsen war, hatte sie noch niemals zuvor ein derart großes Schiff betreten. Ihr Vater, ihre Mutter und einige der Bediensteten waren in der Gondel direkt vor ihr, und auch sie schien die Aussicht auf eine Seereise mehr aufgewühlt zu haben, als Elissa gedacht hatte. Zumindest ihre Mutter. Diese schlug unentwegt die Hand vor den Mund, nur um sie kurz darauf wieder sinken zu lassen und nervös ein Tüchlein zwischen den Fingern zu kneten. Als ein Ruf über das Wasser scholl, kehrte Elissas Blick zurück zu der gewaltigen Karavelle vor ihnen. Salzige Seeluft stieg ihr in die Nase, und sie konnte winzige Seeleute an Deck des schnellen Schiffes hin und her eilen sehen. „Oh, Maria.“ Sie drehte sich auf der harten Bank um und blickte ihrer Zofe in die Augen, deren graues Haar sich im starken Wind langsam, aber sicher aus der kleinen Haube, die sie trug, befreite. „Sieh nur, wie groß es ist!“ Sie konnte kaum still sitzen. Als sie sich dem hölzernen Riesen näherten, entdeckte sie Luken in der Bordwand des Schiffes, durch die schwarze Mäuler von Kanonenmündungen glotzten. „Es sieht überhaupt nicht wie eine von unseren Galeeren aus!“, rief sie aus. Anders als die venezianischen Kriegsgaleeren, die sie kannte, war das Schiff wesentlich größer und wirkte nicht so schlank und wendig. Als ihre Gondola nach einer scheinbaren Ewigkeit endlich die Backbordseite der Karavelle erreichte, streckte ihr einer der männlichen Bediensteten hilfreich die Hand entgegen. Ihr Vater und ihre Mutter waren bereits an Bord, und Elissa holte tief Atem, bevor sie die unterste Sprosse der Strickleiter ergriff, die sie hinauftragen würde in das erste Abenteuer ihres Lebens. Der Aufstieg war allerdings verzwickter, als sie es sich vorgestellt hatte. Zwar schwankte das Schiff nur leicht in der ruhigen See, aber auf halbem Wege fühlte sie, wie die Kraft sie verließ und ihre Beine anfingen zu zittern. Sie hielt einen Moment lang inne und wartete, bis sich ihr Herzschlag ein wenig beruhigt hatte, ehe sie den Anstieg wieder aufnahm. Als sie die Reling schon beinahe erreicht hatte, glitt ihr Fuß jedoch auf einer der schlüpfrigen Sprossen aus. Mit einem Schreckensschrei umklammerte sie mit beiden Händen die Strickleiter und verhinderte so um Haaresbreite einen Sturz in die grünen Wassermassen tief unter ihrem hin und her schwingenden Körper. Während sie noch hilflos hin und her baumelte, alle Glieder vor Angst wie gelähmt, griffen starke Hände nach ihren Armen und sie wurde an Bord gehievt. „Elissa!“, keuchte ihre Mutter erleichtert und riss sie dem jungen Seemann, der sie gerettet hatte, aus den Händen. Mit bebendem Busen presste sie ihr Kind an sich, strich ihr über die Locken und flüsterte beruhigende Worte in das Ohr ihrer immer noch zitternden Tochter. Während um sie herum Kisten und Säcke verstaut wurden, verflog Elissas Schrecken allmählich, und schließlich machte sie sich von ihrer Mutter los, um sich umzublicken und all die neuen Eindrücke in sich aufzunehmen.
*******
Venedig, Signor Brabantios Casa, Dezember 1570
Angelina beobachtete ihre Schwester voller Neugier. Sie waren im Speisezimmer ihres Palazzos versammelt, der lange Tisch, an dem sie saßen, überladen mit köstlich duftenden Speisen in goldenen und silbernen Schüsseln. Direkt vor ihr verbreitete eine Platte mit dampfendem Hasen in Rosmarin ein verführerisches Aroma. Weitere verzierte Silberschalen waren mit Fasan, Ente und Hühnchen gefüllt, das Letztere in einer dicken, goldbraunen Teigkruste. Die Diener kümmerten sich zuerst um die Männer, die sich den ganzen Nachmittag im Arbeitszimmer ihres Vaters eingeschlossen hatten, und so hatte sie Zeit, Desdemona genau zu betrachten. Sie saß Christoforo Moro gegenüber, und ihr Gesicht wurde vom Licht des Murano Kronleuchters erhellt. Dieses prunkvolle Stück Glasbläserkunst brach das Licht seiner Kerzen auf so raffinierte Art und Weise, dass der Effekt atemberaubend war. Kleine blaue, grüne und orangefarbene Lichtflecken tanzten über die Züge ihrer Schwester, wodurch sie überirdisch schön wirkte. Dem Gast des Hauses waren diese Lichteffekte ebenfalls aufgefallen, und er starrte Desdemona auf gänzlich unvornehme Art und Weise an, bis sie den Kopf hob. Ertappt wollte er zuerst den Blick abwenden, schien dann aber einzusehen, wie töricht dies gewirkt hätte, und öffnete die Lippen zu einem verlegenen Lächeln, das ihn mit einem Mal jungenhaft wirken ließ.
Desdemona, deren Gesicht vor Scham eine tiefrote Farbe angenommen hatte, war offenbar froh, von einem der Bediensteten abgelenkt zu werden, der süßen Wein in ihren Kelch goss. Nachdem ihr Teller mit allerlei Köstlichkeiten gefüllt worden war, stocherte sie lustlos in ihrem Essen herum und wagte lange nicht, in Christoforos Richtung zu blicken. Sie hat ihn wirklich gern!, schoss es Angelina durch den Kopf. Und sein Verhalten war auch mehr als eindeutig. Sah denn ihr Vater nicht, was sich da direkt unter seiner Nase abspielte? Sie unterdrückte ein Seufzen und schob sich eine Gabel voll Hasenbraten in den Mund. Wenigstens schien Christoforo Moro zu wissen, was Ehre war. Nicht wie Cesare, dieser Bastardo! Der Gedanke an ihn brachte ihr Blut erneut in Wallung, und sie spürte heiße Wut in sich aufsteigen. Denk nicht an ihn!, befahl sie sich. Vergiss ihn genauso schnell, wie er dich vergessen hat! Lange hatte sie über ihre Gefühle für ihn nachgegrübelt und war, wenn auch widerwillig, zu dem Schluss gekommen, dass ihre Schwester recht gehabt hatte. Es schien tatsächlich so, als ob sie einfach nur ins Verliebtsein vernarrt gewesen war. In einer Zeit, als ihr Leben sie gelangweilt und sie sich nach einer Abwechslung oder einem Abenteuer gesehnt hatte, waren ihr Cesares Schmeicheleien gerade recht gekommen. Sie hatte sich der Illusion hingeben können, der Mittelpunkt der Welt zu sein. Sie verkniff sich ein Seufzen und senkte die Lider, um ihre Schwester und Christoforo unauffälliger beobachten zu können. Desdemonas Gesicht hatte inzwischen die Farbe reifer Kirschen angenommen, und auch Christoforos sonnengebräunte Haut zierte ein deutlicher Rotton. Offensichtlich taten die beiden sich schwer damit, sich auf das Essen und Signor Brabantio zu konzentrieren, der ahnungslos Konversation mit seinem Gast betrieb. Als Christoforo nach einem kurzen peinlichen Moment eine Antwort auf eine Frage stotterte, hätte Angelina sich um ein Haar vor Lachen verschluckt, wurde jedoch sofort wieder ernst.
Was, wenn ihre Schwester tatsächlich in Erwägung zog, einen Mann von solch zweifelhafter Herkunft zu heiraten? Immerhin sollte sie sich der Unschicklichkeit einer solchen Tat bewusst sein. Während Angelina gedankenverloren an einem wunderbar gewürzten Stückchen Fleisch herumkaute, verwarf sie den Verdacht jedoch wieder und schalt sich eine einfältige Gans. Vermutlich schmeichelte es ihrer Schwester einfach nur, wie der General sie behandelte. Er tat dasselbe, was Cesare getan hatte. Er gab Desdemona das Gefühl, geschätzt zu werden, die wichtigste Person in seinem Leben zu sein; und dieses Gefühl zog eine Frau zu einem Mann hin, ganz egal, wie alt er war. Sicherlich würde diese Schwärmerei genauso schnell verpuffen, wie sie gekommen war. Angelina biss die Zähne aufeinander. Oder Christoforo würde es Desdemona genauso leicht machen, wie Cesare es ihr gemacht hatte. Die Diener hatten damit begonnen, den Hauptgang abzutragen und den Nachtisch zu servieren. Obschon Angelinas Magen bis zum Bersten gefüllt war, konnte sie der Schokoladentorte, die einer der Bediensteten mit einem schelmischen Augenzwinkern direkt vor ihr auf den Tisch gestellt hatte, nicht widerstehen. Er war seit über zwanzig Jahren im Haushalt ihres Vaters und kannte ihre Vorlieben, seit sie ein kleines Mädchen war. Ehe der Gedanke an Cesare ihr den Appetit rauben konnte, stach sie in das Naschwerk und stopfte sich einen riesigen Bissen in den Mund.
*******
Desdemona hatte direkt am Marmorkamin Platz genommen, in dem ein fröhliches Feuer tanzte, da der Abend kühl und feucht geworden war. Das Blumenmuster des Fußbodens schien in dem unruhigen Licht zum Leben zu erwachen, und sie fühlte sich wunderbar sicher in der wohligen Hitze, die vom Feuer ausging. Ihr Vater hatte die hohen Butzenscheibenfenster geschlossen, und unter dem Vorwand zu frösteln hatte Christoforo Moro seinen Stuhl näher an den ihren gerückt. Auf Bitten ihres Vaters hatte er von seiner Jugend erzählt, und Desdemona war zugleich fasziniert und entsetzt. Sie hatte nicht ruhig auf ihrem Stuhl sitzen bleiben können, als er von seiner Gefangennahme durch Piraten berichtet hatte und all den furchtbaren Dingen, die er hatte erleiden müssen, bis es ihm schließlich gelungen war, zu fliehen. Es lag nun beinahe zwanzig Jahre zurück, aber er trug immer noch die Narben der Misshandlungen von damals. Sie hatte aufgeschrien und nach seinem Arm gegriffen, als er von den rostigen Ketten berichtete, die ihm die Handgelenke und Knöchel wundgescheuert hatten, bis die Wunden schließlich vereitert waren, und er ins Wundfieber gefallen war. Er hatte sie beruhigt, und es war ihr töricht vorgekommen, da er derjenige war, der sie tröstete; hatte doch er all die Grausamkeiten erdulden müssen.
Mit zunehmend fortgeschrittener Stunde hatten sich die Mitglieder ihres Haushaltes nach und nach zurückgezogen, bis nur noch ihr Vater, ihre Schwester, Christoforo und sie selbst im Raum zurückblieben. Der hell- und dunkelbraun karierte Parkettboden begann, vor ihren Augen zu verschwimmen, aber Desdemona wollte um nichts in der Welt den Mann verlassen, dessen Anwesenheit sie schwindelig machte. Sie war sich seines warmen, starken Körpers neben ihr intensiv bewusst, und es schockierte sie, dass sie – trotz der schrecklichen Geschichte, die er beinahe beendet hatte – begonnen hatte, ihn vor ihrem inneren Auge auszuziehen. Nur, um die furchtbaren Narben auf seinem Rücken und seinen Armen zu sehen! – Nein, das war nicht wahr. Sie wollte ihn berühren, wollte seine Haut unter ihren Fingerspitzen fühlen und herausfinden, ob er überall gleichermaßen sonnengebräunt war.
„Entschuldigung.“ Ihr Vater hatte sich mühsam aus seinem Sessel erhoben und etwas gesagt, doch sie hatte es nicht gehört. „Ich gehe jetzt zu Bett“, wiederholte der alte Mann, dessen Augen gerötet waren, und auf dessen Gesichtszügen sich die Müdigkeit deutlich abzeichnete. Angelina stand ebenfalls auf und täuschte ein Gähnen vor. „Ich bin auch müde“, verkündete sie mit einem spitzbübischen Blick in Desdemonas Richtung, die aufgesprungen war, als hätte man sie bei etwas Ungehörigem ertappt. „Dann werde ich mich verabschieden“, bot Christoforo Moro an. „Es tut mir leid, Euch so lange aufgehalten zu haben.“ Er hob seine Zimarra, das typisch venezianische, mantelähnliche Übergewand, das er über die Rückenlehne eines Stuhls geworfen hatte, auf und befestigte sie an seinem Wams. „Nein, nein.“ Signor Brabantio hob abwehrend die Hand. „Wenn Desdemona noch nicht müde ist, könnt Ihr mit Eurer Geschichte gerne noch fortfahren.“ Er sah seine Tochter fragend an, die bemüht war, eine ernste und unschuldige Miene zur Schau zu tragen. „Ja“, ermunterte sie den Gast. „Ich würde sehr gerne das Ende erfahren.“ Er hatte die Erzählung nicht zu Ende geführt, da ihn Desdemonas entsetzte Reaktion abgelenkt hatte. Christoforo sah von ihr zu ihrem Vater und wieder zurück, und als der alte Mann zustimmend nickte, löste er den Verschluss der Zimarra wieder und neigte den Kopf. „Ich wünsche Euch eine gute Nacht, Signore. Wir werden uns morgen weiter über die andere Angelegenheit unterhalten.“ Signor Brabantio nickte erschöpft und wandte sich der Tür zu, um den Raum zu verlassen. Angelina wünschte Christoforo mit einem spöttischen Knicks gute Nacht und feixte ihre Schwester an. „Gute Nacht. Ich wünsche euch angenehme Unterhaltung.“ Mit einem erstickten Kichern eilte sie ihrem Vater hinterher, der bereits die Treppe ins Obergeschoss erklomm. Sie bedeutete dem Diener mit dem Finger auf den Lippen, ihr leise zu folgen, wodurch die beiden Turteltauben allein im warmen Schein des Feuers zurückblieben. Sie gönnte Desdemona diese Gelegenheit. Sollte ihre vorbildliche Schwester nur einmal sehen, wie es war, den Kopf zu verlieren.