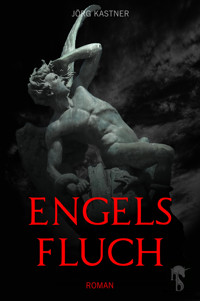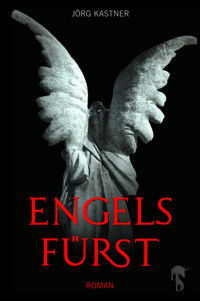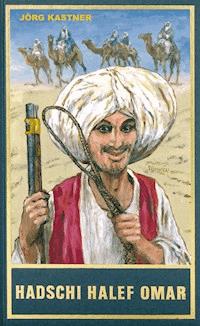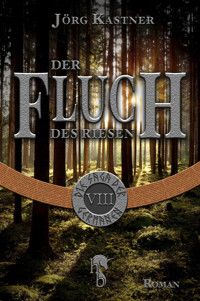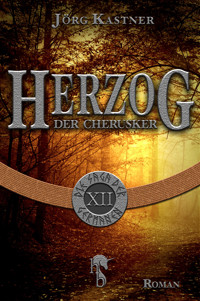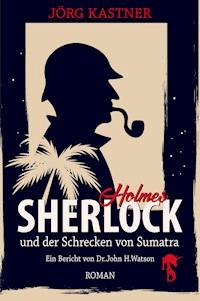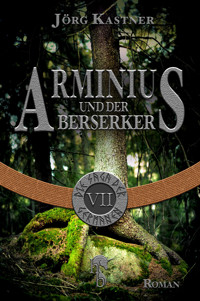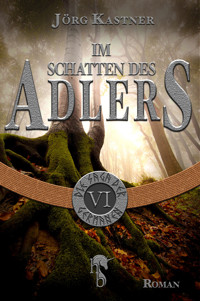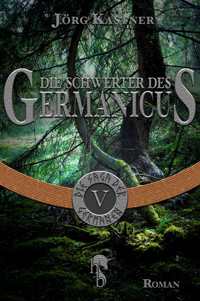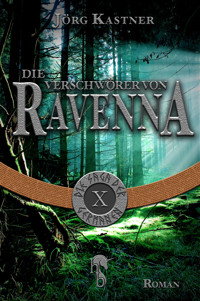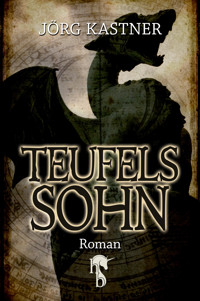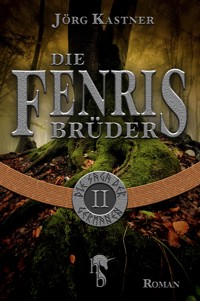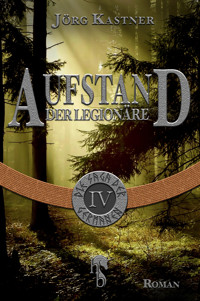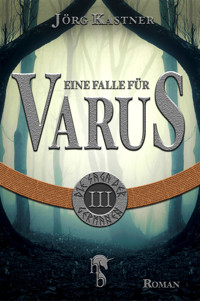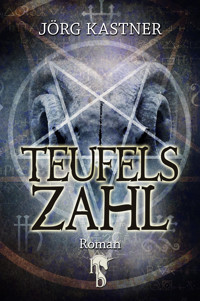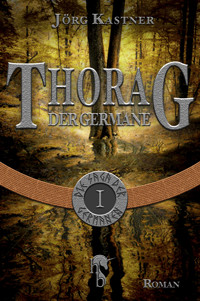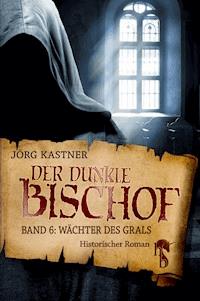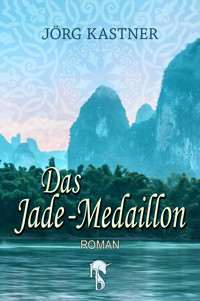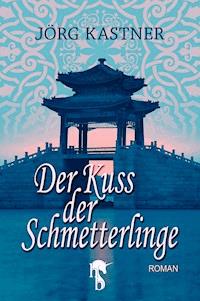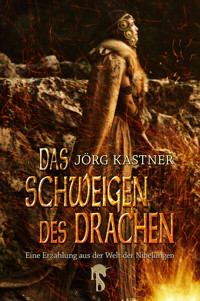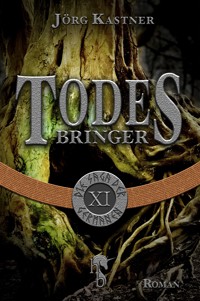
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Saga der Germanen
- Sprache: Deutsch
Arminius ist in tödlicher Gefahr. In Ravenna hat Thorag zwar seine geliebte Auja aus den Händen der Römer befreit, doch hier musste er auch erfahren, dass seinem Blutsbruder Arminius eine tödliche Gefahr droht: Der machtgierige Prätorianerpräfekt Sejanus will nicht nur ihn ermorden lassen, auch auf den römischen Thronfolger Germanicus wird im fernen Antiochia ein Anschlag verübt. Während das römische Reich in Aufruhr ist, durcheilt Thorag, von Sejanus‘ Verfolgern gnadenlos gejagt, die germanischen Wälder, um Arminius zu retten. Doch auch in den Wäldern haben die Todesbringer ihre Falle bereits gestellt … Der elfte Band der zwölfteiligen Romanserie »Die Saga der Germanen« von Jörg Kastner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jörg Kastner
Todesbringer
Folge 11 der 12-teiligen Romanserie Die Saga der Germanen
Historischer Roman
Kapitel 1 – Der Spruch des Apollon
Sie waren weit geritten, fast bis zur Küste. Zwar verbargen schroff aufragende Felskegel den Blick aufs Meer, aber die feuchte, salzige Luft, in der kreischende Möwen nach Beute jagten, war ein deutliches Zeichen. Der Anführer des Reitertrupps hoffte, der Spruch des Gottes Apollon würde ebenso deutlich – und dazu erfreulich – ausfallen. Die Orakelstätte von Klaros, die irgendwo vor ihm zwischen den Felsen lag, war im ganzen Römischen Reich berühmt. Apollons Weissagungen sollten sich stets erfüllt haben, und kaum jemandem wurden so enge Verbindungen zu den Göttern nachgesagt wie den Priestern von Klaros.
Bald werde ich es wissen!, schoss es dem Anführer durch den Kopf, und er trieb den gefleckten Schimmel an.
Hinunter ins Tal folgte ihm seine zahlenmäßig schwache Begleitung, nur ein paar Diener und Sekretäre sowie eine halbe Turme seiner prätorianischen Reiter. Der riesige Tross, der den Imperator der östlichen Provinzen auf seiner Inspektionsreise durch die ihm unterstellten Landstriche begleitete, war in der nahen Stadt Kolophon zurückgeblieben, zusammen mit seiner Gemahlin Agrippina und den Kindern des römischen Thronfolgers.
Der felsige Boden bröckelte immer wieder unter den Hufen weg, weshalb Germanicus die langsamste Gangart befahl. Er hatte nicht in unzähligen Schlachten gefochten, um sich hier den Hals zu brechen. Schatten griffen mehr und mehr nach dem Trupp, als er in das Tal eintauchte, und angenehme Kühle vertrieb das leichte Brennen der hoch am Himmel stehenden Sonne. Kaum merklich verwandelten sich Felsen in Gebäude, dorische Baukunst mischte sich mit ionischer, mächtige Säulen trugen Dächer von Tempeln und Unterkünften. Zerlumptes Pack kroch aus den Schatten ans Tageslicht, und knochige Hände reckten sich den Reitern entgegen. Die Prätorianer preschten vor und trieben das Gesindel mit Hieben und Tritten auseinander, bevor es den Imperator belästigen konnte.
Wie aus dem Boden gewachsen erschien ein graubärtiger Mann im weißen Gewand vor dem Apfelschimmel des Imperators und hob gebieterisch die Hände. Germanicus wusste sofort, dass ein Priester des Heiligtums vor ihm stand. Er zügelte sein Pferd, und hinter ihm hielten schnaubend die Rosse seiner Begleiter an.
„Ich grüße dich, weiser Mann von Klaros“, sagte Germanicus in griechischer Sprache und nickte ihm zu. „Wie ist dein Name?“
„Der ist ebenso bedeutungslos wie der deine, Römer. Apollon erteilt seinen Ratschlag ohne Ansehen der Person. Sollte der Lichtgott dich nach deinem Namen fragen, dann nicht, um dich zu ehren. Apollon allein ist es, dem an diesem Ort Ehre zuteilwird.“
Ein Sekretär des Imperators ließ seinen Rappen vortänzeln und wollte den Priester zurechtweisen, wollte ihn darüber aufklären, mit wem er es zu tun hatte. Eine knappe, aber unmissverständliche Handbewegung des Imperators brachte den Mann zum Schweigen, ehe er noch ein Wort sagen konnte.
Germanicus wandte sich wieder dem Graubärtigen zu. „Du hast recht erkannt, weiser Mann, ich bin ein Römer und suche den Ratschlag des Gottes Apollon.“
„Den suchen die meisten, die nach Klaros kommen.“ Ein kaum merkliches Lächeln umspielte die Lippen des Priesters, bevor sein Gesicht wieder ernst wurde und einen vorwurfsvollen Ausdruck annahm. Mit einem Blick auf die zur Seite gedrängten Bettler sagte er: „Das Schicksal eines jeden Menschen hängt nicht nur von den Göttern ab, sondern in nicht minder wichtigem Maße auch von ihm selbst und seinen Taten. Zu dem Guten kommt das Gute, zu dem Tüchtigen der Verdienst, den Verdammenswerten aber straft der Pfeil des Silberbogners. Was erwartet einer, der goldene Ringe trägt, aber den Ärmsten nichts geben will?“
Die Anspielung war mehr als deutlich gewesen. Mit dem Silberbogner war niemand anderer als Apollon selbst gemeint, der, wenn er als strafender und verderbender Gott auftrat, seine Urteile mit Pfeil und Bogen vollstreckte. Germanicus wandte sich im Sattel um und rief seinen Begleitern einen knappen Befehl zu. Murrend öffneten zwei Sekretäre ihre Geldbeutel und streuten klingende Münzen unter die Bettler, die sich gierig auf das üppige Almosen stürzten. Als der Blick des Priesters noch immer finster auf Germanicus ruhte, zog der Imperator einen Goldring mit eingefasstem Rubin vom Finger und warf ihn ebenfalls in den Staub. Schneller als das menschliche Auge zu sehen vermochte, war der Ring in der schlangenartig zustoßenden Hand eines Bettlers verschwunden.
„Apollon der Heilbringende, Abwehrer allen Übels, heißt dich an seiner heiligen Stätte willkommen, Römer.“
„Danke, Priester.“ Germanicus drehte sich im Sattel um und zeigte auf die schwer beladenen Packpferde. „Nicht nur den Ärmsten bringe ich Gaben, auch der Sohn des Zeus und der Leto soll bedacht sein.“
Ganz bewusst gebrauchte Germanicus die griechischen Namen für die Götter, sprach er von Apollon, Zeus und Leto statt, wie die meisten Römer, von Apollo, Jupiter und Latona. Er hatte die griechischen Schriftsteller gelesen und verehrte die griechische Kultur, die älter und reifer war als die römische. Die Römer waren Kinder im Vergleich zu den Griechen, nicht nur, was Wissenschaft und Künste betraf. Auch in der Geschichte hatten die Griechen eine entscheidende Rolle gespielt, als an ein römisches Weltreich noch nicht zu denken war. Germanicus übte sich sogar darin, in griechischer Sprache Komödien zu verfassen. Und er hielt es für geziemend, den Gott, von dem er sich weisen Ratschluss erhoffte, und seine göttlichen Eltern in der Sprache anzusprechen, in denen sie schon seit Jahrhunderten verehrt wurden.
Der Priester führte die Römer zu einem verlassenen Platz am Rande des Talkessels, der von Gebäuden gleicher Bauart umstanden wurde, den Schatzhäusern. Hier luden die Begleiter des Imperators mit Goldzierrat und Edelsteinen geschmückte Waffen und Schilde, Kelche und Vasen sowie die kostbarsten Stoffe ab, die den Sekretären des Germanicus auf ihrer Reise durch die Ostprovinzen unter die Augen gekommen waren. Das wertvollste Geschenk trug Germanicus selbst in eines der offenstehenden Häuser: einen mannshohen, aus Silber geformten und in der ganzen Länge von Rubinen und Smaragden besetzten Bogen, dessen mit Goldfarbe überzogene Sehne vom Wolf stammte, einem Apollon geweihten Tier. Dazu gehörte ein silberner, ebenfalls mit Rubinen und Smaragden besetzter Köcher mit silbernen Pfeilen, deren Spitzen und Befiederung golden glänzten.
Nachdem Germanicus die teure Gabe, die nach seinen Wünschen angefertigt worden war, zu Füßen einer lorbeergekränzten Apollonstatue niedergelegt und leise seine Gebete gesprochen hatte, kehrte er auf den Vorplatz zurück und fragte den Priester: „Wieso stehen die Schatzhäuser offen wie eine Festung, die dem Feind übergeben wird? Selten erblickte ich so viele Kostbarkeiten auf so engem Raum. Fürchtet ihr nicht Diebesgesindel?“
Der Imperator verschwieg, dass er dabei an die armseligen Kreaturen dachte, die vorhin ihre schmutzigen, schwärenden Klauen bettelnd nach ihm ausgestreckt hatten.
Der Priester wirkte überrascht. „Du meinst, der Sohn des Zeus könnte inmitten seines Heiligtums bestohlen werden?“
„Ein unvergleichlicher Frevel, gewiss, aber der Menschen Gier ist größer als jede Scham und jede Furcht.“
Wieder hatte er ein bestimmtes Bild vor Augen, aber diesmal nicht das eines gemeinen Lumpen, sondern das seines Onkels und Adoptivvaters Tiberius. Der Kaiser war immer neidisch auf seinen beim Volk beliebten Neffen gewesen. Nur zu gut wusste Germanicus, dass die angebliche Ehrung, ihm den Oberbefehl über die östlichen Provinzen zu übertragen, in Wahrheit eine Strafversetzung gewesen war. Dadurch hatte Tiberius eine endgültige Unterwerfung der germanischen Stämme durch Germanicus verhindert und auch die Gefahr gebannt, dass siegestrunkene Legionen ihren erfolgreichen Feldherrn Germanicus zum neuen Kaiser ausriefen.
„Menschen brauchen nicht zu schützen, was des göttlichen Apollon ist, des großen Strafenden und Verderbenden, des fernhintreffenden Silberbogners.“
Während der Priester diese Worte inbrünstig hervorstieß, drehte er sich halb um die eigene Achse und zeigte auf eine dreifach mannshohe Götterstatue in der Mitte des Tals. Da das marmorne Monument auf einem mannshohen Sockel stand, überragte es sämtliche Dächer und wirkte noch größer. Wie die nicht einmal halb so große Statue, vor der Germanicus gebetet hatte, zeigte auch diese Figur einen stattlichen Mann, dessen länglich-ovales Gesicht glatt war, ohne jungenhaft zu wirken. Erhabenheit und Weisheit, aber auch Strenge und Härte sprachen aus den ebenmäßigen, von lockigem Haar umspielten Zügen. Beide Figuren waren nur mit Sandalen und einem losen Umhang bekleidet, der einen freien Blick auf den schlanken, nicht übermäßig muskulösen Leib gestattete. Doch während die Statue im Schatzhaus einen Hirtenstab hielt, Apollons Wahrzeichen als Weidegott, trug die große, alles überragende Figur Bogen und Köcher. Der Bogen war schräg nach unten gerichtet, ins Tal, auf die Menschen, als Warnung vor Apollons Zorn, und ein Pfeil schickte sich an, von der Sehne zu schnellen.
„Apollon straft jeglichen Übermut“, fuhr der Priester mit starrem Blick auf den marmornen Bogner fort. „Er hat die große Drachin Python erlegt, den Riesen Tityos und ebenso die Söhne der prahlerischen Niobe. Und als die Griechen das von ihm beschützte Troja bedrohten, sandte er Tod und Verderben in ihr Lager. Welch kleiner Mensch könnte es wagen, sich an seinen Schätzen zu vergreifen?“
„Heißt das, noch niemand hat es versucht?“, fragte Germanicus ungläubig und dachte daran, dass Troja letztlich doch von den Griechen verheert worden war. Apollons Macht war also nicht unbegrenzt.
Der Priester wandte sich wieder ihm zu und setzte ein verschmitztes Lächeln auf. „Lange nicht mehr. Vor meiner Zeit sollen sich ein paar Gottlose nächtens an den Schätzen vergriffen haben. Doch keinem gelang die Flucht aus dem Tal. Am Morgen fand man sie tot auf, durchbohrt von Apollons Pfeilen.“ Ein langer, forschender Blick traf den Imperator. „Willst du es wirklich wagen, vor den Weisen zu treten, der zugleich der Strafende ist, Römer? Bedenke, ein Gott schaut in dein Herz. Noch kannst du dieses Tal verlassen, ohne den Zorn des Apollon geweckt zu haben.“
„Ich trete voller Ehrfurcht vor Apollon, aber nicht erfüllt von Angst. Denn nicht Übermut führt mich zu ihm, sondern die Sorge um das, was die Zukunft bringt.“
„Wessen Zukunft?“
„Die meine.“
„Und die ist so wichtig, dass du Apollon befragen musst?“
„Das ist sie“, bestätigte Germanicus.
„Für wen? Für dich?“
„Für mich nicht zuletzt. Aber auch für andere. Du kannst dir denken, dass ich kein unwichtiger Mann bin.“
Wieder lächelte der Priester in einer Weise, die seine Gedanken mehr verhüllte als offenbarte. „So folge mir ins Badhaus, wichtiger Römer. Körper und Geist sollen gereinigt sein, wenn du vor deinen Gott trittst.“
In den Thermen verbrachte Germanicus eine lange Zeit, erst im Schwitzbad, dann im Warmwasserbad und, nach einiger Zeit im Abkühlraum, im Kaltwasserbad, immer begleitet von einem Jüngling, der auf der Kithara spielte und das Lied vom Lorbeerbaum sang. Seine reine Stimme erzählte, wie Apollon, von Amors Pfeil getroffen, in blinder, brennender Liebe der Nymphe Daphne nachstellte. Die Bedrängte flehte schließlich ihren Vater, den Flussgott Peneios, um Hilfe an. Der ließ die Glieder seiner Tochter schwer werden und erstarren, verwandelte Daphnes Haar in Laub, die Arme in Äste, die Finger in Zweige und die Füße in Wurzeln, kraft derer die Verzauberte mit dem Boden verwuchs. Zum Lorbeerbaum geworden, verblieb ihr doch Schönheit und Glanz, und Apollon, der Daphne nicht länger zu seiner Gemahlin machen konnte, erkor den Lorbeer zu seinem Lieblingsbaum.
Der Rauch verbrannten Lorbeers wehte durch die Bäder, während Germanicus der jungen Stimme lauschte, die ihm nicht minder verzaubernd erschien als das Wirken des Peneios. Eine eigenartige Stimmung ergriff von ihm Besitz, je länger er dem Lied zuhörte und den Lorbeerrauch einatmete. Die Säulen verzerrten sich zu Lorbeerbäumen, und in dem Kitharaspieler glaubte er Apollon selbst zu erkennen, der als Gott des Gesangs und des Saitenspiels verehrt wurde. Germanicus meinte, auf den volltönenden Klängen der Kithara in die Welt der Götter hinüberzuschweben. Waren es Menschen, Jünglinge, oder waren es überirdische Geschöpfe, die seinen Leib abtrockneten und mit der Essenz des Ölbaums – auch er ein Apollon geweihtes Gewächs – salbten? Sie legten ihm ein griechisches Gewand um, ein Himation und führten ihn zu einem menschenähnlichen Wesen, das mit seinem grauen Bart ehrfurchtsgebietend wirkte. Es mochte der Flussgott Peneios sein oder vielleicht der Göttervater Zeus.
„Wasser und Öl haben deinen Leib gereinigt, Lorbeerrauch und Lied deinen Geist. Du bist jetzt bereit, von Apollon eine Antwort zu erbitten.“
Germanicus kannte die Stimme und erkannte sie, wobei der Nebel zerriss, der seine Gedanken umhüllte. Kein Gott sprach zu ihm, sondern der Priester, der ihn begrüßt und hierhergeführt hatte. In die Thermen des Orakels von Klaros. Fast war er enttäuscht, nicht im Reich der Götter zu weilen, nicht über die Hügel des Olymps zu wandern.
Barfüßig folgte der Imperator dem Priester auf einem hügeligen Weg zu einer abgeschiedenen Höhle. Ein scharfer Wind pfiff an den Felsen entlang, und der dürftig bekleidete Römer zuckte fröstelnd zusammen. Er versuchte, das traditionelle Gewand der Griechen enger um seinen Leib zu wickeln, verhedderte sich aber in den ungewohnten Faltenwürfen. Oder konnte es sein, dass seine Finger zitterten? War es am Ende gar nicht der Wind, der ihn frösteln ließ, sondern der Gedanke an das, was vor ihm lag?
Als er nach Klaros geritten war, hatte er sich Ermunterung für die Zukunft erhofft. Auf einmal spürte er, dass es auch ganz anders kommen konnte. Vielleicht war diese finstere Höhle das Ende seines Weges. Gab es noch eine Möglichkeit zur Umkehr? Unsicher blickte er über die Schulter und sah das große Standbild des Silberbogners. Es konnte nur eine Täuschung der Sinne sein, doch Apollon sah aus, als ziele sein Pfeil geradewegs auf Germanicus.
„Zauderst du?“, fragte der Priester.
„Nein.“ Germanicus straffte sich, war wieder ganz der Imperator. „Führe mich zu deinem Gott, Priester!“
„Den zu schauen, ist dir so wenig bestimmt wie jedem anderen Ratsuchenden. Nur der Prophetes spricht zum Sohn des Zeus.“
Der Prophetes war von hoher, dürrer, ja fast ausgemergelter Gestalt. Wo das Himation nicht seinen Leib bedeckte, traten die einzelnen Knochen deutlich hervor. Schlohweißes Haupthaar ging in einen langen Bart gleicher Farbe über. Übergroße und etwas zu weit hervortretende Augen beherrschten das Gesicht und ruhten jetzt auf Germanicus. So saß der Prophetes starr auf einer steinernen Bank in einer von wenigen Öllampen nur spärlich erleuchteten Höhle. Der Rauch, der aus den Lampen aufstieg, roch ähnlich betörend wie der Lorbeerrauch in den Thermen.
Der graubärtige Priester blieb mit Germanicus wenige Schritte vor dem Prophetes stehen und sagte: „Dieser Mann ist an Leib und Geist gereinigt. Er ist gekommen, den Rat des Apollon zu erbitten.“
„Ist er allein?“, fragte der Prophetes mit knarrender Stimme.
„Er kam in großer Begleitung, aber nur er bittet Apollon um Rat“, antwortete der Priester.
„Apollon weiß, welche Fragen die Menschen an ihn haben. Wer ist es, dessen Gesuch ich überbringen soll?“
Der Priester wandte sich an Germanicus, dem der berauschende Rauch das Denken erschwerte. „Nenne dem Prophetes deinen Namen, Römer!“
„Gaius Julius Caesar Germanicus“, sagte der Imperator langsam und schleppend. Er musste sich auf jede Silbe des eigenen Namens konzentrieren.
Der Prophetes erhob sich. „Ich werde Apollon bitten, deine Frage zu erhören, Gaius Julius Caesar Germanicus.“ Mit diesen Worten verschwand er in den finsteren Tiefen der Höhle.
„Aber ... ich habe noch keine Frage gestellt“, meinte der Imperator leiernd.
„Du hast es doch gehört“, belehrte ihn der Priester. „Apollon weiß, welche Fragen die Menschen an ihn haben. Auf die Frage, die dir am meisten auf der Seele brennt, wirst du eine Antwort erhalten. Sei über sie froh oder zu Tode betrübt, das liegt ganz bei dir.“
Langsam hob Germanicus den Arm und zeigte zum hinteren Teil der Höhle. „Was geschieht da?“
„Der Prophetes trinkt aus der Quelle des Wissens, und die Antwort des Apollon wird ihm teilhaftig.“
Die Höhle verschwamm im Rauch, und die Zeit zerdehnte sich zur Unendlichkeit, um sich im nächsten Augenblick wie im rasenden Galopp zusammenzuziehen. Germanicus sah sich als junger Mann gegen die aufständischen Pannonier kämpfen; an seiner Seite ritten sein Onkel Tiberius und zwei germanische Fürstensöhne vom Stamm der Cherusker, Arminius und Thorag. Das blutige Schlachtgetümmel wollte kein Ende nehmen, aber die beiden Germanen waren nicht länger seine Kameraden. Feindselig standen sie ihm gegenüber, der er gekommen war, die Niederlage des Varus zu rächen. Unbeugsam verharrte Germanicus bis zu den Knöcheln in Schlamm und Blut und hielt in jeder Hand einen zurückeroberten Legionsadler. Und vor ihm saß Tiberius als Nachfolger des vergöttlichten Augustus auf dem Kaiserthron. Die krallenartigen Hände des Kaisers schossen auf ihn zu, entrissen ihm die Adler, und mit verzerrter Fratze lachte sein Onkel ihn aus. Germanicus griff nach einem der Adler, wollte ihn festhalten. Doch das Tier packte ihn, schlug die Klauen in seine Schultern und hob ihn hoch in die Lüfte, um ihn über das Meer zu tragen, der aufsteigenden Sonne entgegen. Hier fand Germanicus sich auf einem Thron wieder, der zugleich sein Kerker war. Ketten hielten ihn fest, und wieder lachte ein Mann ihn höhnisch aus. Erst hatte er das Antlitz des Tiberius, dann das des nicht minder verhassten Kaiserfreundes Gnaeus Calpurnius Piso, den der Princeps zum Aufpasser und ewigen Widersacher des Germanicus bestimmt hatte. Calpurnius Piso, der ihn verlachte und zugleich zu ihm sprach ...
„Apollon hat dein Bitten erhört, Gaius Julius Caesar Germanicus. Bist du bereit, seine Antwort zu vernehmen?“
Nicht Piso stand vor ihm, auch nicht Tiberius. Weißes Haar und ein weißer Bart umrahmten das Gesicht mit den unnatürlich großen Augen, und Germanicus erkannte den Prophetes. Der Zeitkreisel hörte zu tanzen auf, die Schleier fiebriger Träume lichteten sich, und der Imperator wusste wieder, dass er sich in der Höhle des Apollon befand. Sein Hals war ausgedörrt wie nach einem Marsch durch die Wüste, und seine Lippen fühlten sich spröde und fremdartig an. Er musste dreimal ansetzen, um die Frage des Prophetes zu bejahen.
„Dann höre den Spruch des Weisen“, sagte der Prophetes, und seine Augen schienen den Römer verschlingen zu wollen.
„Die Wölfin nährt zwei Junge,
nicht sind ihr eigen Blut.
Zwei Männer einer Zunge
nicht tun dem andern gut.
Rot fließt über dem Graben
des Adlers Lebenssaft.
Einer wird sich laben
an des andern Kraft.“
„Das war schon alles?“, krächzte Germanicus, als der Prophetes geendet hatte und ihn schweigend anstarrte. „Das ist nichts anderes als die Geschichte der Brüder Romulus und Remus. Sie wurden von der Wölfin gesäugt, verübten als Männer Heldentaten und gründeten die Stadt Rom, bis Romulus den Remus erschlug, weil der über die geringe Höhe der von Romulus erbauten Stadtmauer gespottet hatte.“
„Wenn dir die Geschichte so gut bekannt ist, sollte es dir leichtfallen, ihre Bedeutung für dich zu erkennen“, sagte der Prophetes in einem gleichmütigen Tonfall.
„Ihre Bedeutung für mich?“, wiederholte Germanicus. „Welche Bedeutung?“
„Ich höre die Worte Apollons, aber ich kenne nicht ihren Sinn. Den zu erfassen, liegt an dir, Ratsuchender. Vermagst du es nicht, so ist der göttliche Atem an dir verschwendet. Und nun verlass diesen heiligen Ort, deine Zeit ist um!“
Germanicus wollte aufbegehren, wollte dem Prophetes klarmachen, dass er in diesem Tonfall nicht mit seinem obersten Herrscher sprechen konnte. Was bildete dieser bärtige Greis sich ein? Ein Wort des Imperators genügte, um ihn und seine ganze Sippschaft ins Reich der Toten zu befördern!
Dann aber fiel der Blick des Römers auf sein ungewohntes Gewand und auf die nackten Füße. Es erinnerte ihn daran, dass er nicht als Imperator gekommen war, sondern als Bittender, so wie alle anderen, die Apollon um Rat fragten. Wer die Diener der Götter erzürnte, erzürnte die Götter selbst, und darin konnte nichts Gutes liegen. Er dachte an die bedrohliche Statue des Silberbogners und wandte sich wortlos um.
Draußen dämmerte es schon. Die Sonne war eine rot glühende Sichel, die mit den Felsen verschmolz. Frische Abendluft half Germanicus, seine Gedanken zu ordnen. Der Orakelspruch nahm ihn so sehr gefangen, dass er den graubärtigen Priester kaum beachtete.
Die Wölfin stand für Rom, soviel schien sicher. Und Rom, das war Tiberius, der Kaiser. Wen aber hatte der Kaiser genährt? Zwei Brüder waren gemeint, sonst ergab der Spruch, der Vergleich mit Romulus und Remus, keinen Sinn. Einer von ihnen musste Germanicus sein. Und der andere? Vielleicht war Tiberius’ leiblicher Sohn Drusus Caesar gemeint. Oder Calpurnius Piso, der treu wie ein Sohn zum Princeps stand. Germanicus fühlte, dass er dem Sinn der Weissagung auf der Spur war, aber er kam nicht ganz dahinter.
Verzweifelt blieb er am Rande der Siedlung stehen und stieß ein unzufriedenes Knurren aus. „Was nutzt der Ratspruch des Apollon, wenn er so dunkel ist wie die sich herabsenkende Nacht?“
Der Priester sah ihn mitleidig an. „Nur eine Erkenntnis, die im schweren Ringen gewonnen wird, wiegt auch schwer.“
„Aber was nutzt eine Weissagung, die zu verschwommen ist, um jemals zur Erkenntnis zu werden?“
„Sie kann vor erschreckendem Wissen bewahren.“
„Hätte ich Angst vor Apollons Spruch, wäre ich nicht hierhergekommen.“
„Willst du es wahrhaftig wissen, Römer?“
„So wahrhaftig, wie ich zwei auf ewig verloren geglaubte Legionsadler heimgeholt habe!“
„Dann gibt es einen Weg für dich, selbst mit Apollon zu sprechen.“
Germanicus trat vor und krallte seine Rechte in das Gewand des Priesters. „Welchen?“
„Die Inkubation.“
Die Inkubation – das Niederlegen an heiliger Stätte, um mit den Göttern zu sprechen – erfolgte noch in dieser Nacht. Lange hatte Germanicus im großen dorischen Tempel direkt gegenüber der Statue des Silberbogners gebetet und Apollon Weihrauchopfer dargebracht. Als längst tiefe Finsternis das Tal beherrschte, ging er mit dem graubärtigen Priester zurück zu den Felsen.
Sie waren allein, und der Imperator war noch immer barfüßig, trug weiterhin das einfache Himation. Sie nahmen diesmal einen anderen Höhleneingang und drangen tiefer ins Innere des Berges ein. Das flackernde Leuchten der Fackel in der Hand des Priesters beleuchtete ihren Weg. Plötzlich auftauchende Schattenwesen, die dicht an ihnen vorüberflatterten, waren keine Nachtgespenster, sondern aufgescheuchte Fledermäuse, sagte sich der Imperator. Längst war der Eingang hinter ihnen verschwunden. Sie waren an mehreren Abzweigungen vorbeigekommen, und Germanicus war sicher, dass er den Rückweg allein niemals finden würde.
Irgendwann sagte der Priester: „Wir sind Apollon nah genug. Leg dich hier nieder, Römer.“
„Hier, wo nur nackter Fels ist?“
„Glaubst du, der Silberbogner erwartet dich voller Sehnsucht und bereitet dir ein weiches Lager?“, entgegnete der Priester mit einem deutlichen Anflug von Spott.
Er zog den Korken aus einem kleinen Lederschlauch, der an seiner Seite gehangen hatte, und reichte den Schlauch Germanicus.
„Trink dies, und du wirst tiefer schlafen als in den weichsten Kissen!“
„Was ist das?“
„Ein Trunk aus den heiligen Gewächsen des Apollon: Früchte und Blätter des Lorbeerbaums, der Palme und der Tamariske, vermischt mit der Essenz des Ölbaums. Er wird dich in einen besonderen Schlaf versetzen, der dich für die Eingebungen Apollons empfänglich macht.“
Vorsichtig setzte Germanicus den Schlauch an die Lippen und kostete von dem Inhalt. Der Trunk war dickflüssig, fast so zäh wie Honig, aber nicht so süß. Mehr herb im Geschmack, aber nicht unangenehm. Je mehr er davon trank, desto leichter fiel es ihm. Seine Glieder wurden schwer und sein Geist leicht. Sie trennten sich, und während der Leib – wahrhaftig schlaftrunken – gänzlich zu Boden sackte, flog der Geist durch Zeit und Raum, flog zurück, zurück nach Rom ...
Von seinen langen Feldzügen gegen die Germanen seinem eigenen Wunsch zuwider durch Tiberius zurückgerufen, zog Germanicus im Triumph durch die Tiberstadt. Mit sich führte er Gefangene und Kriegsbeute, Triumphalgemälde und seine Legionäre, nicht im Waffenschmuck, sondern in weißen Seidengewändern und mit Lorbeer statt mit Helmen auf dem Haupt. Der Jubel der Menge konnte ihn nicht darüber hinwegtäuschen, dass sein Triumph in Wahrheit eine Niederlage war. Nur zwei der drei Varusadler brachte er heim, und noch immer beherrschte Arminius mit seinen Aufständischen das Land rechts des Rhenus, das einmal eine römische Provinz hatte werden sollen. Noch machte Germanicus sich Hoffnungen, dass Tiberius ihn zurück nach Germanien schicken würde. Er musste nur die richtigen Worte finden, musste den Kaiser von seiner Treue und vom nahen Sieg über Arminius überzeugen. Hatte Germanicus nicht immer zu seinem Adoptivvater gehalten, selbst als es ihm ein Leichtes gewesen wäre, die meuternden Legionen gegen den Princeps aufzuwiegeln? Diese bedingungslose Treue musste Tiberius ihm nun vergelten!
„Nur ein weiteres Jahr und ich bringe dir auch den dritten Adler!“, beschwor Germanicus ihn, als er die beiden zurückerbeuteten Adler im Jupitertempel auf dem Capitol niederlegte.
Lächelnd lehnte der Kaiser das Ansinnen ab, und zutiefst enttäuscht starrte Germanicus auf das Triumphzeichen in seiner linken Hand, das aus Elfenbein und Gold gefertigte Adlerszepter. Der Stab aus Elfenbein stand plötzlich in Flammen. Erschrocken ließ er das Szepter fallen, und beim Aufprall zersprang der goldene Adler in tausend Stücke. Ein roter Strom ergoss sich aus dem Inneren und befleckte Germanicus von Kopf bis Fuß.
Er wusste auf einmal, wen Apollon mit dem sterbenden Adler gemeint hatte, doch er wollte es nicht wahrhaben. Er bäumte sich auf und schrie aus Leibeskräften, immer und immer wieder.
Die Hand auf seinem Mund erstickte die Schreie. Er riss die Augen auf und sah eine dunkle Gestalt über sich. Schwaches Lampenlicht enthüllte nur schemenhafte Umrisse.
Neue Panik stieg in ihm hoch, ließ sein Herz pochen, als wollte es im nächsten Augenblick zerspringen – wie der goldene Adler. Er wollte die Gestalt, die sich über ihn beugte, wegstoßen. Das Wesen aus dem Totenreich war gekommen, ihn zu holen. Aber er wollte ihm nicht folgen, war nicht bereit, kampflos aufzugeben. Er, der vom Volk geliebte Enkel des Marcus Antonius, ein siegreicher Feldherr von nicht mehr als fünfunddreißig Jahren, der Herrscher über die östlichen Provinzen – er wollte leben, kämpfen!
Schon hatte er die dünnen Arme gepackt, um den Todesengel von seinem Nachtlager zu drängen, da hörte er den eindringlichen Ruf einer wohlbekannten Stimme: „Lass das, Gaius, du tust mir weh! Hörst du nicht, lass mich los!“
„Agrippina!“, stieß er keuchend hervor, und sein fester Griff löste sich von den Armen seiner Gemahlin.
Sie taumelte zurück und hätte das Gleichgewicht verloren, hätte sie sich nicht an dem Tisch festgehalten, an dem ihr Mann bis spät in die Nacht saß, um seine griechischen Komödien zu verfassen. Das Dichten sollte ihm Ablenkung und Aufheiterung bieten. Und er hoffte, die bösen Träume würden ihn fliehen, wenn er arbeitete, bis ihm die Augen zufielen.
Agrippina ging ans andere Ende des Cubiculums und zog die schweren Vorhänge beiseite, die vor den Glasfenstern hingen. Blasses Morgenlicht drang durch die Scheiben, schon stark genug, um den Gegenständen feste Konturen zu verleihen. Den Gegenständen und der Frau, die langsam zurück zum Bett ging.
Sie war ungefähr so alt wie ihr Gemahl und hatte neun Kinder zur Welt gebracht, von denen jedoch nicht alle überlebt hatten. Manche Frau in ihrem Alter hätte verbraucht ausgesehen, alles andere als begehrenswert. Nicht so Agrippina. Ihr Leib war nicht mehr so schlank wie noch vor einigen Jahren, aber ihre Üppigkeit war nicht von der Formlosigkeit manch anderer Mutter. Die großen Brüste und das pralle Gesäß, die sich im Gegenlicht deutlich durch das dünne Nachtgewand abzeichneten, empfand Germanicus als sehr verlockende Reize. Hätte ihn nicht der furchtbare Traum gequält, hätte er Agrippina in seine Arme gezogen und für ein zehntes Kind gesorgt.
Sie setzte sich auf die Bettkante und streichelte sanft seine Wangen. Die Berührungen hatten etwas Beruhigendes an sich. Germanicus wusste, dass er nicht allein stand. Agrippina hatte immer hinter ihm gestanden, manchmal zu sehr. Manch böse Zunge behauptete, sie sei sein ganzer Ehrgeiz.
Zuweilen wünschte er sich, mehr auf Agrippina gehört zu haben, besonders damals in Germanien, als sie ihn anstachelte, nach dem Kaiserthron zu greifen. Er aber hatte Tiberius die Treue gehalten, so wie Tiberius dem älteren Drusus, Germanicus’ Vater, bis in den Tod beigestanden hatte. Doch der Kaiser hatte es Germanicus schlecht gelohnt.
Die östlichen Provinzen! Hier gab es keinen Ruhm zu ernten. In kleinlicher Verwaltungsarbeit und endlosen Reisen erstickte sein Leben.
Eine dieser Reisen hatte ihn zur Orakelstätte von Klaros geführt. Mehr als ein Jahr war seitdem vergangen, aber für Germanicus war es erst gestern gewesen, so oft träumte er davon, so sehr beschäftigten seine Gedanken sich mit dem Spruch des Apollon. Jene Nacht der Inkubation hatte ihm die Weissagung entschlüsselt. Er wusste jetzt, dass er selbst der Adler war. Der Adler war das Zeichen der Könige, und Germanicus war von hochherrschaftlichem Blut. Er hatte zwei Legionsadler heimgebracht und war im Triumph mit dem Adlerszepter in der Hand durch Rom gezogen.
Der Graben musste das Meer meinen, das ihn vom fernen Rom trennte. Falls er gegen sein Schicksal aufbegehrte und versuchte, gegen den Willen des Tiberius nach Rom zurückzukehren, würde er sein Leben beenden. Er war verdammt dazu, hier im Osten zu leben – und zu sterben, irgendwann, vielleicht schon bald. Die bösen Träume kamen immer öfter.
„Das ist nicht wahr, Gaius! Das ist nicht wahr, und du weißt es. Du darfst es dir nicht immer wieder einreden!“
Er hatte laut gedacht, und Agrippina antwortete in dem ihr eigenen energischen Ton. So oder ähnlich sprach sie stets, wenn sie ihn zu trösten versuchte.
„Willst du an den Worten Apollons zweifeln?“, fragte er matt.
„Nicht an Apollon, wohl aber an diesem Prophetes. Vielleicht ist er ein falscher Prophet.“
„Aber mein Traum in jener Höhle!“
„Das Gebräu, das der Priester dir gab, hat deine Sinne verwirrt. Jeder würde schlecht davon träumen.“
„Nur zu gern glaubte ich das“, seufzte er. „Aber vergiss nicht die andere Weissagung, damals am Rhenus!“
„Sprichst du von dieser Vettel, der germanischen Seherin?“
„Dein abfälliger Ton verwundert mich, Agrippina. Ich wollte sie auspeitschen lassen, du aber hast ihr einen Ring aus Elektron geschenkt, besetzt mit einem Saphir!“
„Heute denke ich anders darüber, Gaius. Ich hätte dich gewähren lassen sollen.“
„Vergossene Milch!“, schnaubte er. „Außerdem dachte ich, du klammerst dich noch immer an ihre Voraussage, dass unsere Tochter Julia Agrippina dereinst die mächtigste Frau der Welt sein wird.“
Agrippinas Züge verhärteten sich. „Die Kleine ist vier. Wer weiß, ob wir das noch erleben. Wir müssen bald handeln, wollen wir die Macht noch erringen, Gaius, sehr bald!“
„Wie denn? Soll ich Krieg führen gegen meinen Adoptivvater? Soll ich wieder Legionen in die Schlacht führen, die ihrem Feldzeichen folgen, dem Adler? Du weißt doch, was die Seherin damals prophezeite: ‚Der Adler hilft dem Imperator, aber er weist ihm auch den Weg ins Verderben.‘ Apollon hat ihren Spruch bestätigt.“
Weitaus bedrückender als jener Teil war ein anderer aus der Prophezeiung der Seherin: ‚Wodan hat mir das Schicksal dreier Männer gezeigt, das die Nornen miteinander verwoben haben. Der Imperator ist einer von ihnen, aber ich weiß nicht, welcher. Drei Männer, die fast zur selben Zeit Väter werden, doch einer davon wird es nicht. Den anderen beiden ist ein gleicher Tod bestimmt, und sie sterben zur gleichen Zeit.‘
Lange hatte Germanicus über den Sinn dieses Spruches gegrübelt. Und immer wieder fielen ihm die beiden Cheruskerfürsten ein, die einst mit ihm, dann gegen ihn gekämpft hatten: Arminius und Thorag. Germanicus hatte ihre Weiber als Geiseln nach Rom gebracht. In der Gefangenschaft gebar Thusnelda ihren Sohn Thumelicus, den Sprössling des Aufrührers Arminius. Auja aber, die Gemahlin Thorags, hatte ihre Tochter tot zur Welt gebracht. Schuld war die schwere Misshandlung durch den mit Germanicus verbündeten Germanenfürsten Gerolf. Das war in der Ubierstadt geschehen, in jener Nacht, als Germanicus die Geburt seiner Tochter Julia Agrippina feierte. Doch hatte er erst später davon erfahren.
Alles stand mit der Prophezeiung der Seherin im Einklang. Drei Männer waren fast zur gleichen Zeit Väter geworden, aber Thorags Kind war tot, also war einer es nicht geworden. Falls Germanicus an die richtigen Männer dachte, stand fest, wer den gleich Tod zur gleichen Zeit sterben würde: er selbst und der Cheruskerherzog Arminius.
Kapitel 2 – Die wilde Jagd
Die Baumriesen huschten an ihm vorüber wie die Geister flüchtiger Träume. Um nicht von den starken Armen der Äste aus dem Sattel gerissen zu werden, hing er tief über dem Hals des Falben gebeugt. Immer wieder presste er dem Tier die Fersen in die Flanken und rief abgehackte Befehle in seine spitzen Ohren, um es zur Höchstleistung anzuspornen. Es war ein gutes, ausdauerndes Ross, aber beileibe nicht das schnellste. Was hätte er jetzt dafür gegeben, auf Sleipnir, dem Dahingleitenden, zu sitzen!
Der achtbeinige Grauschimmel des Göttervaters Wodan sollte das schnellste aller Pferde sein. Kein Hindernis war Sleipnir zu hoch, kein Weg zu weit, kein anderes Ross, und mochte es auch göttlichen Ursprungs sein, zu schnell. Aber er war nicht Wodan, und er ritt nicht den Dahingleitenden. Das wurde ihm schmerzlich bewusst, als er mitten in der wilden Jagd über die Schulter sah. Bei jedem Blick, den er wagte, waren ihm die Verfolger näher gekommen.
Nicht alle Römerpferde waren schneller als sein Falbe. Der Pulk von ursprünglich fünfzig oder sechzig Reitern war weit auseinandergefallen. Knapp zwanzig von ihnen hatten sich ein gutes Stück vor ihre Kameraden gesetzt und waren dabei, die Entfernung zu dem einzelnen Germanen vom Stamm der Cherusker mehr und mehr zu verringern. Fast schien ihm, als könne er trotz des lauten, raschen Trommelns der Pferdehufe das Knarren ihres Lederzeugs und das Klirren ihrer Waffen vernehmen.
Vor fünf Tagen hatte er die Verfolger bemerkt. Erst waren sie nur eine Staubwolke am Horizont gewesen. Eine Wolke, die, so hatte er gehofft, vorüberziehen würde. Aber wie sagten doch die Cherusker: Auf Hoffnung zu bauen statt auf Weisheit und Kraft ist wie ein Kriegszug ohne Waffen. Am nächsten Tag war die Staubwolke ein Stück größer – näher – gewesen. Und bald wurde ihm klar, dass die fremden Reiter nicht zufällig in seiner Richtung, nach Norden, unterwegs waren.
Der von ihm eingeschlagene Weg, oft nur ein schmaler Pfad zwischen den unendlichen Baumreihen, brachte für einen größeren Trupp gehörige Schwierigkeiten mit sich. Römer, die es eilig hatten und keine dunklen Absichten hegten, hätten die gut ausgebaute Handelsstraße gewählt, die etwa zwei römische Meilen weiter westlich in Nordsüdrichtung verlief. Der Cherusker hatte den schwierig passierbaren Waldpfad genommen, um unentdeckt zu bleiben. Die Reiter hinter ihm waren der Beweis dafür, dass sein Vorhaben missglückt war.