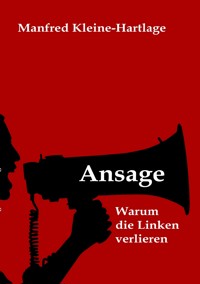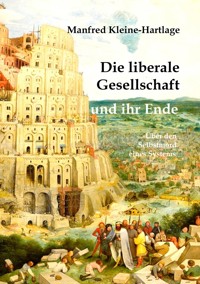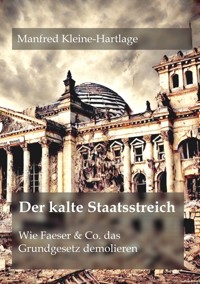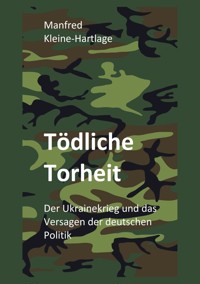
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Politik der Bundesregierung im Ukrainekrieg ist symptomatisch für das Versagen der politischen Klasse der BRD, die sich auf nahezu allen Politikfeldern in Teufelskreise begeben hat, aus denen sie nicht mehr herausfindet, und die immer gefährlichere Dimensionen annehmen. Manfred Kleine-Hartlage analysiert die selbstzerstörerische Dynamik dieser Politik am Beispiel der Außenpolitik, aber unter Einbeziehung der seit spätestens 2010 kumulierten Großkrisen, also der Kombination aus Währungs-, Wirtschafts-, Energie-, Migrations-, Sicherheits- und Verfassungskrise. Die Außenpolitik im Ukrainekrieg ist ein weiteres Glied in einer Kette von Fehlentscheidungen, deren Wirkungen sich wechselseitig potenzieren, zugleich aber denkbare Lösungswege verbauen. Die pathologische Lernunfähigkeit der politischen Klasse führt dazu, dass ihr Mangel an Problemlösungskompetenz mit jeder Krise deutlicher hervortritt, sie diesen Sachverhalt aber nicht wahrhaben will und darf und ihr daher Heil in autoritärem Auftrumpfen und der Diffamierung ihrer Kritiker sucht. Dieses Buch wurde im Frühjahr 2022 verfasst, wird aber über den Ukrainekrieg hinaus als Lehrbeispiel für Politikversagen seine Gültigkeit behalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch: Die Politik der Bundesregierung im Ukrainekrieg ist symptomatisch für das Versagen der gesamten politischen Klasse der BRD, die sich auf nahezu allen Politikfeldern in Teufelskreise begeben hat, aus denen sie nicht mehr herausfindet. Es handelt sich um ein weiteres Glied in einer Kette von Fehlentscheidungen, deren Wirkungen sich wechselseitig potenzieren, zugleich aber denkbare Lösungswege verbauen. Dieses Buch wurde im Frühjahr 2022 verfasst, wird aber über den Ukrainekrieg hinaus als Lehrbeispiel für Politikversagen seine Gültigkeit behalten.
Über den Autor: Manfred Kleine-Hartlage, geboren 1966 in München, ist Diplom-Sozialwissenschaftler in der Fachrichtung Politikwissenschaft und für seine aufsehenerregenden zeitkritischen Sachbücher und Kolumnen bekannt, in denen er die selbstzerstörerischen Tendenzen unserer Gesellschaft analysiert. Darüber hinaus ist er Romancier. Kleine-Hartlage hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau in Berlin.
Manfred Kleine-Hartlage
Tödliche Torheit
Der Ukrainekrieg und das Versagen der deutschen Politik
© 2023 Manfred Kleine-Hartlage
Website: http://korrektheiten.com
Verlagslabel: Kolkraven
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Manfred Kleine-Hartlage, Havelstr. 17a, 13597 Berlin, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Einleitung
Worum es im Ukrainekrieg geht
Zwischenfrage: Was ist ein Aggressor?
Die Strategie des Westens und der Ukraine
Die Fortschreibung des Merkel-Syndroms
Demokratie, Autokratie, Oligarchie
Die mentale Disposition
Die multiple Krise
Bisherige Bücher des Verfassers
Tödliche Torheit
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Einleitung
Bisherige Bücher des Verfassers
Tödliche Torheit
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Einleitung
Wenn man den Charakter und den Zustand eines politischen Systems kennenlernen will, dann sollte man sie nicht im alltäglichen Normalzustand, sondern unter dem Druck des Ausnahmezustands beobachten. So gesehen, gab es wohl seit dem Ende des Kalten Krieges keine Periode, in der sowohl der Zustand des Volkes als auch der Charakter des politischen Systems der Bundesrepublik so klar zutage getreten sind wie in den Krisen der letzten fünfzehn Jahre:
Die Eurokrise, die Fukushimakrise samt Atomausstieg, die Flüchtlingskrise, die andauernde Verschärfung der Klimapolitik, die Verfassungskrise durch den Kalten Bürgerkrieg gegen die Opposition („Kampf gegen Rechts“) und die Coronakrise zeigen eine deutliche Klimax: Jede Krise wird im Zeitverlauf bedrohlicher beziehungsweise ist ernster als die vorangegangenen, da die Ergebnisse ständigen Missmanagements sich kumulieren. So entsteht eine Instabilität, die jede neue Krise noch schwerer handhabbar macht, als sie es per se schon wäre.
Zwar verfügt eine Demokratie, den Lehrbüchern der Politikwissenschaft zufolge, über Selbstheilungsmechanismen, die dauerhaftes Missmanagement unmöglich machen sollen. Diese Mechanismen aber beruhen allesamt auf wechselseitiger Konkurrenz beziehungsweise Kontrolle zentral platzierter Akteure aus Politik, Medien, Justiz, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft und können daher durch kartellartige Verflechtung dieser Akteure ausgehebelt werden. Dies ist leider geschehen: Instanzen, die einander die Waage halten und in die Schranken weisen sollen, sind zu einem Kartell zusammengewachsen, dessen Beteiligte einander Rückendeckung geben.
Die pathologische Lernunfähigkeit dieses herrschenden Kartells führt dazu, dass dessen Mangel an Problemlösungskompetenz mit jeder Krise deutlicher hervortritt, seine Protagonisten diesen Sachverhalt aber nicht wahrhaben wollen und dürfen und ihr Heil in autoritärem Auftrumpfen, der Diffamierung von Sündenböcken und dem erwähnten Kalten Bürgerkrieg gegen ihre Kritiker suchen – ohne Rücksicht auf die verfassungsmäßige Rechtsordnung.
Diese inkompetente und destruktive Politik des Kartells hat zu einer Spaltung des Volkes geführt, das sich nunmehr grob in drei Teile gliedern lässt: Während eine Minderheit das Vertrauen zu den Politikern und Medien des Kartells restlos verloren hat, hält eine passive Mehrheit ihm aus tradierter Staatsloyalität noch die Stange. Am anderen Ende der Skala finden wir eine dritte Fraktion von ideologischen Eiferern: aufs ganze Volk gerechnet wiederum eine Minderheit, aber eine, deren Anteil mit zunehmender Kartellnähe zunimmt. In den Zentren der gesellschaftlichen Ideologieproduktion und politischen Macht ist sie sogar tonangebend. In dieser Fraktion erweist sich eine über lange Zeit gewachsene und in zwei Diktaturen gefestigte totalitäre Disposition als lediglich verdrängt und eben nicht als überwunden – entgegen dem gerade in diesen Kreisen verbreiteten schmeichelhaften Selbstbild als liberal, tolerant und friedfertig. Verhaltensmuster, die insbesondere für die Mentalität der Deutschen im Dritten Reich als charakteristisch und besonders verwerflich galten, kommen dabei auf bestürzende Weise wieder zum Vorschein.
Da alle Korrekturmechanismen systematisch sabotiert wurden, befindet sich unser Land in einem dauerhaften und sich beschleunigenden Sinkflug, der bei gleichbleibenden politischen Zuständen unabwendbar in einem katastrophalen Aufprall enden wird.
Dies war das Ergebnis der Analyse, die ich 2021 in meinem Buch „Systemfrage“1 vorgelegt habe. Dass schon nach so kurzer Zeit mit dem Ukrainekrieg die nächste Großkrise eine Fortschreibung meiner Untersuchung erfordert und ermöglicht, bestätigt die Richtigkeit dieser Diagnose.
Bevor wir uns allerdings daran machen können, aus dem Umgang mit der Ukrainekrise Rückschlüsse auf den Charakter der deutschen (und gesamtwestlichen) Politik und Öffentlichkeit zu ziehen, gilt es diese Krise selbst zu analysieren. Dabei möchte ich von vornherein einem denkbaren Missverständnis vorbeugen: Ich verfolge nicht das Ziel, meinen Leser zur Parteinahme für die eine oder andere Seite zu bewegen. Zwar hat George Orwell einmal sinngemäß geschrieben, Kriegspropaganda sei so dumm, dass man als denkender Mensch gar nicht umhinkönne, mit dem Feind zu sympathisieren, und wahrscheinlich unterliege auch ich dieser paradoxen Wirkung. Die Maßlosigkeit, die verlogene Selbstgerechtigkeit und der blindwütige Hass gegen Russland, die sich in der westlichen Propaganda austoben, schreien nach Hinterfragung – und dies nicht erst wegen ihrer Gefährlichkeit, sondern bereits wegen ihrer Dummheit.
Dennoch ist mein Thema nicht der Krieg an sich, sondern die westliche, speziell die deutsche Politik und Gesellschaft, ihre ideologischen und psychologischen Dispositionen und die in ihnen wirkenden Machtstrukturen, die im Spiegel dieses Krieges mit karikaturhafter Deutlichkeit hervortreten.
Der Ukrainekrieg hat die selbstzerstörerische Dynamik der deutschen Politik weder gebremst, noch haben deren zentrale Akteure ihn zum Anlass genommen, die eigenen ideologischen Annahmen kritisch zu hinterfragen. Eine gewisse Selbstkritik fand zwar statt, galt aber just den wenigen Positionen, in denen die politische Klasse bis dahin noch Reste an gesundem Menschenverstand gezeigt hatte (und die gerade deswegen in der ideologisch durchgestylten, autistisch geschlossenen Weltsicht deutscher Politiker und Journalisten immer stärker, wie Fremdkörper gewirkt hatten). Diese Reste werden nun ebenfalls entsorgt.
Ich werde zeigen, dass die deutsche Politik in ihrer Reaktion auf den Ukrainekrieg just die bekannten Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster zeigt, die systematisch Fehlentscheidungen erzeugen. Durch solche Fehlentscheidungen hat sie schon in den vergangenen beiden Jahrzehnten, insbesondere aber seit 2010, das gesamte gesellschaftliche System in existenzbedrohender Weise destabilisiert und an den Rand seiner Leistungsfähigkeit getrieben. Der Ukrainekrieg gibt ihr nun Anlass, das für sie charakteristische „Krisenmanagement“ nach dem Motto „More of the same“ zu praktizieren, das System also noch weiter zu belasten und die verschiedenen Krisen zu einer Großkrise verschmelzen zu lassen, an deren Ende durchaus der oben genannte Aufprall stehen kann.
Wenn ich im ersten Abschnitt dieses Buches den Krieg selbst einer Analyse unterziehe, so ist dies ein notwendiger Zwischenschritt. Es geht mir darum, zu zeigen, dass die Zustimmung zur Krisendefinition des Kartells sich keineswegs von selbst versteht, sondern Folge einer Entscheidung ist. Erklärungsbedürftig ist daher, warum diese Entscheidung vom politischen Establishment, aber auch vom breiten Publikum im Westen so undifferenziert getroffen wurde, wie es in den ersten Monaten des Ukrainekrieges geschehen ist.
Für die Gültigkeit dieser Diagnose kommt es übrigens nicht darauf an, wie dieser Krieg weiter verlaufen und enden mag.
1 Manfred Kleine-Hartlage, Systemfrage, Verlag Antaios, Schnellroda 2021
Worum es im Ukrainekrieg geht
Mit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine am 24. Februar 2022 kulminierte eine Krise, die schon seit Jahrzehnten vor sich hin geschwelt hatte. Im Kern, darüber sind sich die meisten Geostrategen unabhängig von Nationalität und ideologischer Ausrichtung einig, geht es in diesem Konflikt um die Blockzugehörigkeit der Ukraine, in einem höheren Sinne um die Großmachtposition Russlands, in geringerem (aber auch nicht zu vernachlässigendem) Maße um umstrittene Gebiete mit russischer, russischsprachiger oder prorussischer Bevölkerung auf der Krim und in der Ostukraine und deren Unabhängigkeit beziehungsweise Zugehörigkeit zur Ukraine oder zu Russland.
Seit dem Ende der Sowjetunion hat die NATO alle Mitgliedstaaten des früheren Warschauer Pakts, einige jugoslawische Republiken und mit den baltischen Staaten auch drei ehemalige Sowjetrepubliken aufgenommen. Mit diesem Vorgehen setzte sie sich über – wenn auch informelle – Zusagen hinweg, die der Westen der russischen Seite in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre gemacht hatte.
Dass diese Zusagen informeller Natur waren, schmälert zwar ihre rechtliche Verbindlichkeit, nicht aber ihre politische Bedeutung. Tatsächlich sind die weitaus meisten zwischenstaatlichen Vereinbarungen informeller Art, ja, die internationale Politik könnte ohne sie überhaupt nicht funktionieren und ist daher nur auf der Basis eines gewissen wechselseitigen Grundvertrauens möglich, das man nicht unnötig strapazieren sollte und nicht ungestraft missbraucht.
Aus russischer Sicht handelte es sich um eine strategische Einkreisung, und auch amerikanische Strategen machen kein Hehl daraus, dass es ihnen darum geht, Russland auf den Status einer zweitklassigen Macht zurückzustufen und insbesondere eine immerhin denkbare deutsch-russische Allianz für alle Zeiten auszuschließen – also eine Konstellation, die den USA zwar immer noch den Status einer Weltmacht, aber nicht mehr den einer praktisch weltbeherrschenden Supermacht ließe.
Lange Zeit hatte die NATO von einer Aufnahme der Ukraine abgesehen, weil nicht nur die russische Seite, sondern auch zahlreiche hochkarätige westliche Experten vor ihr gewarnt hatten. Die Ukraine ist nämlich ein strategisch so wichtiges Land, dass ihre Aufnahme in die NATO deren Truppen und Raketen tief in ein Gebiet vorgeschoben hätte, das für die Sicherheit Russlands von entscheidender Bedeutung ist, und dies nicht nur aus russischer Sicht, sondern ganz objektiv.