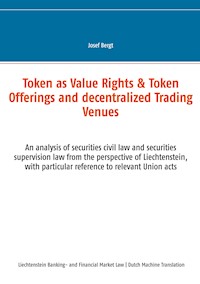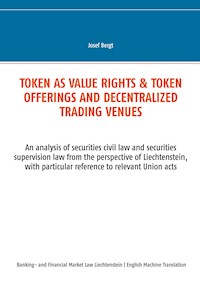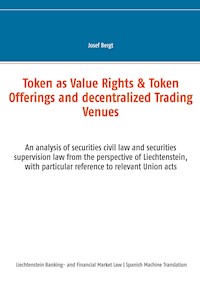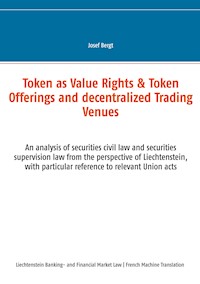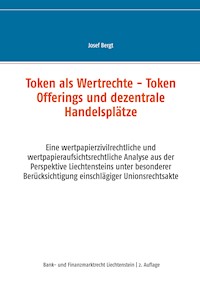
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Bank- und Finanzmarktrecht Liechtenstein
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Werk behandelt (wertpapier-)zivilrechtliche wie (wertpapier-)aufsichtsrechtliche Aspekte von Token gemäss liechtensteinischem Recht unter Berücksichtigung von relevanten Unionsrechtsakten. Ferner wird auf entmaterialisierte Wertpapiere eingegangen, welche der liechtensteinischen Rechtsordnung annähernd 100 Jahre bekannt sind. Es wird dabei die Rechtslage betreffend Wertpapiere und Wertrechte vor Inkrafttreten des "Blockchain-Gesetzes" (TVTG) skizziert und werden in der Folge Wertrechte nach TVTG (Abstraktionsprinzip) und Wertrechte nach PGR idF LGBl 2019/304 (Kausalprinzip) im Detail behandelt. Der zivil-, wie gesellschaftsrechtliche Fokus liegt auf Liechtenstein, während auch die gesellschaftsrechtliche Rezeptionsgrundlage der Schweiz und die allgemeine zivilrechtliche Rezeption des österreichischen Rechtes Berücksichtigung finden. Der aufsichtsrechtliche Teil der Arbeit steht klar im Fokus des Unionsrechtes, berücksichtigt neben den europäischen Rechtsakten aber auch nationale Besonderheiten Liechtensteins, Österreichs und Deutschlands. Token und tokenbasierte Geschäftsmodelle werden auch unter Berücksichtigung von Unionsrechtsakten wie MiFIR, MiFID II, CRR, CRD IV, CSDR, EMIR, AIFMD, UCITSD, E-Geld-RL II, PSD II, MAD/MAR, Prospekt-VO, 5. GW-RL und weiteren Verordnungen, Richtlinien, sowie Durchführungsverordnungen und delegierten Rechtsakten beleuchtet. Ein besonderer Fokus wird hierbei auf Krypto-Börsen sowie dezentrale Handelsplätze (DEX) gelegt. Zudem wird ein Fokus auf Verbraucherrecht iZm Token und Fernabsatzverträgen unter Berücksichtigung der VRRL und der Klausel-RL gelegt. In diesem Zusammenhang wird auch auf Token als Daten bzw Software und sohin als digitale Inhalte und folglich Handelswaren näher eingegangen und werden die Parallelen zu Token als Wertmarke mit intrinsischem Wert bzw virtuellen Währungen in Abgrenzung zu Fiatgeld aufgezeigt. Weiters werden Einlagengeschäft, E-Geldgeschäft und Finanzinstrumente als kommunizierende Gefässe in Abgrenzung zu virtuellen Währungen verständlich erklärt. Dabei erfolgt zwar vorrangig eine juristische Auseinandersetzung, jedoch werden auch technische Aspekte der Distributed Ledger Technologies, wie der Blockchain als dezentrale Datenbank, Token & Coins, Smart Contracts, Agoric Computing, Self-Sovereign-Identity, etc - soweit dies für die rechtliche Beurteilung erforderlich ist - näher gebracht. Zielgruppen: Juristen, Behörden & Gerichte, Wissenschafter, sonstige Interessenten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
“Imagination will often carry us to worlds that never were.
But without it we go nowhere.”1
1Carl Sagan (1934 - 1996), Astronom, Kosmologe, Astrophysiker, Astrobiologe, Fernsehmoderator, Sachbuchautor, Schriftsteller.
Vorwort / Danksagung
« Keine Schuld ist dringender als die, Dank zu sagen »2
Daher gilt mein erster Dank meinen Betreuern, Kommilitonen, Kollegen und Mitarbeitern, die mich in den vergangenen Jahren mit bereichernden Tipps und Diskussionsbeiträgen wiederholt in neue wissenschaftlich fruchtbringende thematische Bahnen gelenkt haben.
Meinen fleissigen und geduldigen Korrekturlesern und allen Personen, die hier nicht explizit angeführt wurden, sei an dieser Stelle ebenfalls gedankt.
Eine herausragende Stellung in jeglicher Hinsicht nehmen meine Eltern, Geschwister und meine Kollegen ein. Ihnen gilt mein besonderer Dank.
Gams / Vaduz / Ranggen, im November 2019
Josef Bergt
PS: Doch mit etwas Stolz blicke ich auf die vorliegende Arbeit und hoffe einerseits, dass ich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung nie überdrüssig werde und fordere weiters jeden dazu auf bzw lade herzlich dazu ein, die hierin vertretenen Thesen empirisch zu falsifizieren oder verifizieren; nur so kann eine Validation im Sinne der wissenschaftlichen Methode erreicht werden und freue ich mich auf jeden weiteren wissenschaftlichen Diskurs.
2 Dieses Zitat wird zwar teilweise dem römischen Redner und Staatsmann Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v Chr) zugeschrieben, dürfte dabei aber mangels nachvollziehbarer Quellenangabe unbekannten Ursprungs sein.
Redaktionelle Hinweise
Es wird darauf hingewiesen, dass in vorliegender Arbeit aus Gründen der Leserlichkeit das generische Maskulinum genutzt wird. Die Verwendung der männlichen Form eines Wortes schliesst aber immer auch die weibliche Form mit ein.
Zudem wird in gegenständlicher Abhandlung auf die Verwendung des Eszett (nach der Fraktur-Schriftart - „sz“; „ß“) gänzlich verzichtet und wird dieses jeweils durch ein „Doppel-s“ ersetzt. Hievon unberührt bleiben jedoch Zitate, da eine Verfälschung jeglicher Art vermieden werden soll.
Soweit eine Umsetzung in den jeweiligen Jurisdiktionen bereits erfolgt ist, wird für die Zitierung von Gerichtsentscheidungen der European Case Law Identifier (ECLI) herangezogen. Gleicher-massen wird unionsrechtliches Sekundärrecht mithilfe des European Legislation Identifier (ELI) zitiert.
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass bezüglich Zitationsweise überwiegend den Abkürzungs- und Zitierregeln (AZR), 8. Auflage, Wien, 2019, von Peter Dax und Gerhard Hopf, gefolgt wird.
Weiters ist noch darauf hinzuweisen, dass sich zeitliche Angaben ohne weitere Präzisierung, wie insbesondere bei Temporaladverbia (bspw: aktuell/derzeit/gegenwärtig wird eine Novellierung eines bestimmten Gesetzesbereichs angestrebt) im Zweifel auf das Publikationsdatum gegenständlicher wissenschaftlicher Abhandlung beziehen.
Letztlich ist noch darauf hinzuweisen, dass Angaben von Gesetzesstellen ohne Länderzusatz sich im Zweifel auf die liechtensteinischen Gesetze beziehen, sofern eine Zuordnung nicht ohnehin eindeutig ist, wie dies bspw beim deutschen KWG oder dem schweizerischen OR der Fall ist. Wird das ABGB zitiert, so ist das liechtensteinische ABGB gemeint; die österreichische Rezeptionsgrundlage wird mit öABGB angeführt, sofern sich aus dem Kontext nicht ergibt, welches Gesetz gemeint ist.
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass sich vorliegende Arbeit in zwei Titel untergliedert. Dies deshalb, da die einzelnen Arbeiten der Universität Liechtenstein als Masterthesen im Rahmen des LL.M. im Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht („Token als Wertrechte“), sowie im LL.M. Banking und Finance („Token Offerings und dezentrale Handelsplätze“) vorgelegt wurden. Verweise (Kapitelangaben, Randziffern, Fussnoten) sind grundsätzlich eigenständig zu sehen und beziehen sich auf die jeweilige Arbeit (den jeweiligen Titel), sofern nicht eine übergreifende Verweisung vermerkt ist. Das vorliegende Werk ist ein Abdruck der der Universität Liechtenstein vorgelegten Masterthesen.
Nachtrag zur 2. Auflage – Mai 2020
In dieser leicht überarbeiteten 2. Auflage meines Werkes wurden geringfügige inhaltliche Konkretisierungen vorgenommen, sowie diverse orthographische Fehler ausgebessert. Der Wesensgehalt des Werkes bleibt dabei unverändert und ist weiterhin aus Sichtweise per Stand November/Dezember 2019 abgefasst. Formulierungen, die auf Gesetze „de lege lata“ verweisen, beziehen sich sohin auf den Stand per Ende 2019. Die Änderungen, die das zwischenzeitlich in Kraft getretene liechtensteinische Blockchaingesetz (TVTG) mit sich bringt, wurden in diesem Werk aber ohnehin (mit dem Vermerk „de lege ferenda“) berücksichtigt.
Eine weitergreifende Auseinandersetzung und Aktualisierung wird in Zukunft sicherlich notwendig sein. Da sich das vorliegende Werk als Teil einer (zukünftigen) Reihe zum liechtensteinischen Bank- und Finanzmarktrecht verstehen soll, sind auch andere Autoren herzlich dazu eingeladen mit mir den Kontakt aufzunehmen und allenfalls (Gast-)Beiträge zum angeführten Thema zu verfassen, ihre Gedanken auf sonstige Art und Weise einzubringen, oder bei der Übersetzung in anderen Sprachen unterstützend tätig zu werden, um dieses Kühne unterfangen langfristig auch tatsächlich zu realisieren und das Werkgleichzeitig einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Ganz besonders danken möchte ich an dieser Stelle Kollegen Wolfgang Fürnschuss sowie der Advocatur Seeger, Frick & Partner AG, Schaan, welche die vermeintlichen Immaterialgüterrechtsansprüche meiner Gegner an vorliegendem Werk erfolgreich vor den liechtensteinischen Gerichten abwehrten (rechtskräftiges Sicherungsverfahren zu 04 CG.2019.409 vom 12.05.2020), was massgeblich dazu beigetragen hat, dass mein Werk wieder veröffentlicht werden kann.
„Die Zensur ist die jüngere von zwei schändlichen Schwestern, die ältere heißt Inquisition.“3
„Ein Censor ist ein Menschgewordener Bleysteften oder ein Bleistiftgewordener Mensch; ein fleischgewordener Strich über die Erzeugnisse des Geistes, ein Krokodil was an den Ufern des Ideenstromes lagert, und den darin schwimmenden Dichtern die Köpf' abbeißt.“4
Wissen ist frei! Der fleischgewordene Bleistift und der bleistiftgewordene Mensch bzw die am Ideenstrom auflauernden Krokodile wurden durch das Richtschwert Justitias erschlagen!
Gams, Mai 2020
Josef Bergt
PS: Dieses Werk ist auch in anderen Sprachen erschienen. Übersetzungen aus dem Original, welches in deutscher Sprache verfasst wurde, erfolgten mittels Deep-Learning- bzw Machine-Learning-Methoden basierend auf künstlichen neuronalen Netzwerken (künstliche Intelligenz).
3Johann Nepomuk Nestroy, Freiheit in Krähwinkel I, 14.
4Nestroy, Freiheit in Krähwinkel, Stücke 26/I, 26 f.
Inhaltsübersicht
Vorwort / Danksagung
Redaktionelle Hinweise
Nachtrag zur 2. Auflage – Mai 2020
Abkürzungsverzeichnis
I. Token als Wertrechte
II. Token Offerings und dezentrale Handelsplätze
Literaturverzeichnis
Judikaturverzeichnis
Digitale Quellen
Abstract
Lebenslauf
Inhaltsverzeichnis
Vorwort / Danksagung
Redaktionelle Hinweise
Nachtrag zur 2. Auflage – Mai 2020
Abkürzungsverzeichnis
Token als Wertrechte
Einleitung, Forschungsfrage & sachenrechtliche Grundfragen zu Token
1.1 Blockchain & Smart Contracts
1.2 Token, Coins und Standardisierung trotz depositum regulare
1.3 Fazit tokenisiertes Eigentumsrecht
Wertpapiere gem PGR und deren Funktionen
2.1 Indiz- und Beweisfunktion
2.2 Liberations- und Legitimationsfunktion
2.3 Präsentations- bzw Verkehrsschutzfunktion
2.4 Transportfunktion
2.5 Fazit wertpapierrechtliche Funktionen und deren Anwendung auf Wertrechte gemäss TVTG und PGR neu
Token als entmaterialisierte Wertpapiere de lege lata?
3.1 Übertragung von Wertrechten
3.2 Führung des Aktienbuches bzw -registers auf einer Blockchain
3.3 Fazit Aktienbuch auf der Blockchain
3.4 Wertpapiere vs übertragbare Wertpapiere gem MiFID-Kanon
3.5 Indossament und reine Namenpapiere in Form von Token
Zivilrechtliche Einordnung von Token unter dem liechtensteinischen "Blockchain-Gesetz" (TVTG)
4.1 Wertrechte nach TVTG (Abstraktionsprinzip) und PGR (Kausalitätsprinzip)
4.2 Fazit Abstraktions- und Kausalitätsprinzip nach Einführung des TVTG
Tokenisierung iZm individuellen und kollektiven Veranlagungen
5.1 Abgrenzungsfragen der kollektiven Anlage (Fondsstrukturen)
5.2 Tokenisierte Anteile an SPVs und Fondsanteilsscheine
5.3 Segmentierte Verbandspersonen (PCC) in Abgrenzung zum Fonds
5.4 Fazit Tokenisierung von Finanzinstrumenten und Collective Investment Schemes
Token und Verbraucherrecht
Wesentliche Ergebnisse
7.1 Die Abbildung des Vollrechtes Eigentum in einem Token
7.2 Wertrechte nach TVTG und Wertrechte nach PGR idF BuA 2019/93 (LGBl 2019.304)
7.3 Tokenisierung iZm kollektiven Veranlagungsstrukturen und segmentierten Verbandspersonen
7.4 Verbrauchergeschäfte iZm Token
Token Offerings und dezentrale Handelsplätze
Einleitung und Untersuchungsgegenstand
1.1 Finanzmarktrechtliche Würdigung von DLT-basierten Geschäftsmodellen
1.2 Amtspraxis der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Finanzmarktrechtliche Analyse von Token
2.1 Charakteristika und Anwendungsbereich des BankG
2.2 Token Offerings und Bankgeschäfte
2.2.1 Bankgeschäfte (Passivgeschäft)
2.2.2 Abgrenzungsfragen zum Einlagen- und E-Geldgeschäft und Finanzinstrumentenbegriff
2.2.3 Fazit Abgrenzung Einlagen- und E-Geldgeschäft
2.2.4 Bankgeschäfte (Aktivgeschäft)
2.2.5 Fazit Akitv- und Factoringgeschäft
2.3 Token als Finanzinstrumente
2.3.1 Übertragbare Wertpapiere
Standardisierung
Handelbarkeit am Kapitalmarkt
Übertragbarkeit
2.3.2 Equity, equity-like und non-equity transferable securities
2.3.3 Derivatgeschäfte
Warenderivate
Unterschied zu Traditions- bzw Warenpapieren (Zivilrecht)
2.3.4 Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen
2.3.5 Fazit aufsichtsrechtliche Perspektive der Tokenisierung
2.4 Geregelte Märkte, MTF & OTF, SI
2.4.1 Multilaterale Handelssysteme (MTF)
2.4.2 Fazit MTF
2.4.3 Organisierte Handelssysteme (OTF)
2.4.4 Systematische Internalisierer (SI)
2.4.5 Organisierte Handelsplätze im Überblick
2.4.6 Fazit organisierte Handelsplätze
2.4.7 Nachbildung einer CCP für Utility Token und Vorteile der Blockchain
2.5 DEX als Handelsplatz und weitere Wertpapierdienstleistungen
2.5.1 Abschlussvermittlung
2.5.2 Portfolioverwaltung, Anlageberatung und Finanzanalyse
2.5.3 Fazit Frontend und Backend einer DEX, Market Making und SI
2.5.4 TVTG und DEX
2.5.5 Fazit Bulletin Board und DEX als VT-Preisdienstleister?
2.5.6 Datenbereitstellungsdienste und Bulletin Boards
2.6 Prospektrechtliche Erwägungen
2.6.1 Wertpapierbegriff und öffentliches Angebot
2.6.2 Ausnahmen der Prospektpflicht
2.6.3 Fazit Akteure an einer DEX und Prospektpflicht
2.7 Stablecoins und E-Geld
2.7.1 E-Geld-Gesetz - Anwendungsbereich
2.7.2 Fazit örtlicher Geltungsbereich des E-Geld-Regimes
2.7.3 Token als E-Geld, Wallets und bestimmte Zahlungskonten für E-Geld
2.7.4 Fazit monetärer Wert und Führung von E-Geld auf Wallets
2.7.5 E-Geld und Ausnahmetatbestände
2.7.6 Trading von Stablecoins und E-Geld am Beispiel Tether
2.7.7 Fazit bilaterales und multilaterales Handeln von E-Geld
2.7.8 Monetärer Wert - Revival der Klingeltonklausel?
2.8 Zahlungsdienste und tokenbasierte Geschäftsmodelle
2.8.1 Starke Kundenauthentifizierung
2.8.2 Ausnahmen von der Bewilligung gemäss ZDG
2.8.3 Fazit Ausnahmen gemäss ZDG unter PSD II
2.9 Wechselstuben gem SPG idF LGBl 2009.047 und 2019.302
2.10 Fazit Bereich Geldwäschereiprävention und andere Finanzintermediäre
Aufsichtsrechtliche Aspekte des TVTG im Überblick
Zentrale Ergebnisse
4.1 Bankgeschäfte, E-Geld, Finanzinstrumente und virtuelle Währungen
4.2 Zentrale und dezentrale Handelsplätze
Literaturverzeichnis
Judikaturverzeichnis
Digitale Quellen
Abstract
Lebenslauf
Abkürzungsverzeichnis
aA
anderer Ansicht
aaO
am angeführten/angegebenen Ort
ABl C
Amtsblatt der Europäischen Union (Mitteilungen und Bekanntmachungen)
ABl L
Amtsblatt der Europäischen Union (Rechtsvorschriften)
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
aF
alte Fassung
AIFMD
Alternative Investment Fund Manager Directive 2011/61/EU
Anm
Anmerkung
API
Application Programming Interface; Programmierschnittstelle
ATS
Alternative Trading System
BankG
Bankengesetz (Liechtenstein)
BTC
Bitcoin
BuA
Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein
BWG
Bankwesengesetz (Österreich)
CCP
Central Counterparty / zentrale Gegenpartei (Clearingstelle)
CFD
Contract for Difference
CRD
Capital Requirements Directive (CRD IV, 2013/36/EU; CRD III, 2006/48/EG)
CRR
Capital Requirements Regulation EU/ 575/2013
CSDR
Central Securities Depositories Regulation EU/909/2014
DAO
Dezentralisierte autonome Organisation
Del-VO
Delegierte Verordnung
DEX
Decentralized Exchange
DGSD
Deposit Guarantee Schemes Directive 2014/49/EU
DLT
Distributed Ledger Technology
DVO
Durchführungsverordnung
DvP
Delivery versus Payment
EAG
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (Liechtenstein)
EBA
European Banking Authority
eg
exempli gratia
EGG
E-Geld-Gesetz (Liechtenstein)
ELI
European Legislation Identifier
EMD / E-Geld-RL
E-Money-Directive / E-Geld-Richtlinie (E-Geld-RL II, 2009/110/EG; E-Geld-RL I, 2000/46/EG)
EMIR
European Market Infrastructure Regulation EU/648/2012
ESMA
European Securities and Markets Authority
etc pp
et cetera perge, perge
ETH
Ether
EZB
Europäische Zentralbank
FAGG
Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Liechtenstein)
FCA
Financial Conduct Authority (UK)
FernFinG
Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (Liechtenstein)
ff / et seqq
Fortfolgend / et sequentes
FINMA
Eidgenössische Finanzmarktauf
BaFin
sicht (CH)
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
FMA
Finanzmarktaufsicht (Liechtenstein oder Österreich)
FMAG
Finanzmarktaufsichtsgesetz (Liechtenstein; idF BuA 2019/93 bzw LGBl 2019.303)
FN
Fussnote
GewG
Gewerbegesetz (Liechtenstein; idF BuA 2019/93 bzw LGBl 2019.305)
GRC
Grundrechtecharta
GW-RL
Geldwäscherei-Richtlinie (5. GWRL, 2018/843; 4. GW-RL, 2015/849)
Ibid / ebd
Ibidem / ebenda
IDD
Insurance Distribution Directive EU/2016/97
Idem / ders
derselbe
idF
in der Fassung
idS
in dem/diesem Sinne
ie
id est
iSd
im Sinne der/des
ITS
Implementing Technical Standards
IUG
Investmentunternehmensgesetz (Liechtenstein)
iVm
in Verbindung mit
JCD (EEA)
Joint Committee Decision (Beschluss des gemeinsamen EWR-Ausschusses)
Klausel-RL
Klausel-Richtlinie 93/13/EWG
KMG
Kapitalmarktgesetz (Österreich)
KSchG
Konsumentenschutzgesetz (Liechtenstein)
KWG
Kreditwesengesetz (Deutschland)
leg cit
legis citatae
LES
Liechtensteinische Entscheidungssammlung
LGBl
Landesgesetzblatt (Liechtenstein)
LJZ
Liechtensteinische Juristen-Zeitung
MAD
Market Abuse Directive 2014/57/EU
MAR / MMVO
Market Abuse Regulation EU/596/2014
MiFID
Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II, 2014/65/EU; MiFID I, 2004/39/EG)
MiFIR
Markets in Financial Instruments Regulation EU/600/2014
MTF
Multilateral Trading Facility (Multilaterales Handelssystem)
mwN
mit weiteren Nachweisen
NCA / NSA
National Competent Authority / National Supervisory Authority
nF
neue Fassung
NFC
Non-financial counterparty
OR
Obligationenrecht (CH)
OSI
Open Systems Interconnection Model
OTC
Over the counter (ausserbörslich)
OTF
Organised Trading Facility (Organisiertes Handelssystem)
PERG
The Perimeter Guidance manual
PGR
Personen- und Gesellschaftsrecht (Liechtenstein; (idF BuA 2019/93 bzw LGBl 2019.304)
PoS/PoW
Proof-of-Work / Proof-of-Stake
Prospekt-VO
Prospekt-Verordnung EU/2017/1129
PSD
Payment Service Directive (PSD II, EU/2015/2366; PSD I, 2007/64/EG)
RTS
Regulatory Technical Standards
Rz
Randzahl/Randziffer
s
siehe
sa
siehe auch
SI
Systematischer Internalisierer
sl
sine loco (ohne Ort)
Solvency II
Solvabilität II Richtlinie 2009/138/EG
SPG
Sorgfaltspflichtgesetz (Liechtenstein; (idF BuA 2019/93 bzw LGBl 2019.302)
SPV / SSPV
Special Purpose Vehicle Securitization Special Purpose Vehicle
SR
Sachenrecht (Liechtenstein)
SSI
Self-Sovereign-Identity
SSM-VO
Single Supervisory Mechanism Verordnung EU/1024/2013
SteG
Steuergesetz (Liechtenstein)
StGH
Staatsgerichtshof (Liechtenstein)
STSR
Simple, Transparent and Standardized Regulation bzw Securitisation Regulation bzw Verbriefungs-VO EEU/2017/2402
TVTG
Gesetz über Token und Vertrauenswürdige-Technologie-Dienstleister (Liechtenstein; idF BuA 2019/93 bzw LGBl 2019.301, sofern nicht anders vermerkt)
u dgl
und dergleichen
UCITSD
Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities Directive 2014/91/EU
USDT
US-Dollar Tether
UVS
Unabhängiger Verwaltungssenat (Österreich)
VersAG
Versicherungsaufsichtsgesetz (Liechtenstein)
VersVertG
Versicherungsvertriebsgesetz (Liechtenstein)
VnB
Vernehmlassungsbericht (Liechtenstein)
VRRL
Verbraucherrechtrichtlinie 2011/83/EU
WAG
Wertpapieraufsichtsgesetz (Österreich)
ZDG
Zahlungsdienstegesetz (Liechtenstein)
I. Token als Wertrechte
Da sich vorliegende Thesen insbesondere mit dem liechtensteinischen Recht beschäftigen, soll dieses Werk mit nachfolgendem Zitat über das „Crypto Country“ Liechtenstein eingeleitet werden: „In the past, transaction banking, and especially the field of fintech, has grown more important for the Liechtenstein market.“5
1. Einleitung, Forschungsfrage & sachenrechtliche Grundfragen zu Token
In diesem I. Teil der Arbeit – „Token als Wertrechte“ – soll anders als im II. Teil – „Token Offerings und dezentrale Handelsplätze“ – der Fokus auf die zivilrechtliche Einordnung und Übertragungsordnung von Kryptowährungen bzw Token nach liechtensteinischem Recht gesetzt werden. Ziel der Arbeit des I. Teils ist es zu untersuchen, ob Token analog zu Wertpapieren oder generell als entmaterialisierte Wertpapiere – sohin Wertrechte – behandelt werden können, oder zumindest als solche ausgestaltet werden können. Es ist diesbezüglich die Möglichkeit der Repräsentation von Rechten – am Vermögen und an der Person6 – zu untersuchen.
Ziel soll es sein, die Repräsentation von Rechten in Token sowohl de lege lata, im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Arbeit und sohin vor Inkrafttreten des TVTG7, als auch de lege ferenda, nach Umsetzung und Inkrafttreten des TVTG mit 01.01.2020 zu untersuchen. Mangels eines Elements der Körperlichkeit8 von Token scheint es dabei unzutreffend zu sein, von der Verbriefung von Rechten zu sprechen, wie dies bei Wertpapieren9 der Fall ist. Vielmehr scheint der Begriff der Vermögensrechte oder Wertrechte zutreffender. Es soll untersucht werden, wie das PGR10 vor Abänderung der wertpapierzivilrechtlichen Bestimmungen im Schlussteil zum PGR im Rahmen der Umsetzung des TVTG solche entmaterialisierten bzw dematerialisierten Wertpapiere behandelt und mit Sachverhalten, welche solche entmaterialisierten Wertpapiere im Geschäftsmodell vorsehen, umgeht; gleichwohl sollen auch die diesbezüglichen positivierten Bestimmungen de lege ferenda, welche das TVTG selbst, aber insbesondere auch die Abänderung der Schlussabteilung zum PGR mit sich bringen, untersucht werden.
In der Folge ist es auch erforderlich, den zivilrechtlichen Wertpapierbegriff von den aufsichtsrechtlichen übertragbaren Wertpapieren bzw Finanzinstrumenten abzugrenzen. Es soll diesbezüglich nicht nur untersucht werden, ob Token Wertrechte darstellen können, sondern auch, ob Token im Effektengiro geführte Finanzinstrumente11, sohin buchmässig geführte Finanzinstrumente, darstellen können. In diesem Zusammenhang soll von der Repräsentation von Wertrechten mittels Token über die Abbildung von Finanzinstrumenten durch einen Token hin zu kollektiven Veranlagungen in Zusammenhang mit Token der Bogen von der zivilrechtlichen hin zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Token gespannt werden, deren Auseinandersetzung vertieft im II. Teil dieser Arbeit erfolgt.
So sollen in Einklang mit dem vorher Gesagten auch die Unterschiede der individuellen und der kollektiven Vermögensveranlagung in Zusammenhang mit der Tokenisierung von Finanzinstrumenten und Portfolios differenzierend herausgearbeitet werden und soll in der Folge auf die gesellschaftsrechtlichen Aspekte von Fonds in Zusammenhang mit einer Investmentgesellschaft12 in Abgrenzung zu einer Aktiengesellschaft in der Gestaltungsform einer segmentierten Verbandsperson13, welche Segmentaktien14 ausgibt, wiederum in Abgrenzung zu sogenannten Verbriefungszweckgesellschaften15, eingegangen werden.
Die konkrete Forschungsfrage der vorliegenden Arbeitet lautet sohin: Können Token entmaterialisierte Wertpapiere – sohin Wertrechte – nach liechtensteinischem Recht darstellen und welche Unterschiede ergeben sich in der Beurteilung vor und nach Inkrafttreten des TVTG? Die Unterforschungsfrage lautet dabei: Können Token neben zivilrechtlichen Wertrechten aus Perspektive des Aufsichtsrechtes auch im Effektengiro geführte Finanzinstrumente repräsentieren und wie verhalten sich neue technische Möglichkeiten zu klassisch regulierten Institutionen wie Fondsstrukturen?
Während sich die Arbeit unter Titel I. auf das liechtensteinische Recht fokussiert, müssen gerade für die Sub-Forschungsfrage neben nationalen Bestimmungen auch europäische Rechtsakte in Zusammenhang mit der Fondsregulierung herangezogen werden.
Bevor eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit den angeführten Thematiken erfolgt, soll nachfolgend noch ein Überblick über die Blockchaintechnologie, Smart Contracts, Token und Coins gegeben werden. Dabei ist zu beachten, dass technische Aspekte vereinfacht dargestellt werden, um einen groben Überblick über die genannten Technologien zu schaffen und in der Folge die durchwegs juristische Argumentation bei Behandlung von juristischen Fragestellungen, welche sich in Zusammenschau mit technischen Aspekten dieser Technologien ergeben, nachvollziehbar zu machen. Weiters zu beachten ist dabei, dass die Bezeichnung „Blockchain“ oder „Blockchaintechnologie“ in den vorliegenden Arbeiten als pars pro toto für die sogenannten distributed ledger technologies und verwandte Technologien verwendet wird, deren prominentester Anwendungsfall schliesslich die Blockchaintechnologie ist.
1.1 Blockchain & Smart Contracts
Eine Blockchain stellt eine technische Ausgestaltung der Distributed-Ledger-Technologie (Technologie der verteilten Bücher) dar und zeichnet sich als ein öffentliches und dezentrales Register bzw Datenhaltungssystem aus, welches Transaktionsdaten permanent aufzeichnet. Die Öffentlichkeit16 hat zur Folge, dass jede Transaktion auf einer Blockchain, welche gespeichert wurde, öffentlich eingesehen werden kann.17 Die Permanenz ergibt sich dabei aus den kryptographischen Streuwert- bzw Hashfunktionen (eine Streuwertfunktion, welche kollisionsresistent ist, was bedeutet, dass es nicht möglich ist, unterschiedliche Eingabewerte, welche denselben Hashwert ergeben, zu finden), auf welchen die Technologie aufbaut, welche gewährleisten, dass die Transaktionshistorie mit heutiger herkömmlicher Technologie nicht korrumpiert oder kompromittiert werden kann und steht diese Stabilität bzw technische Redundanz in engem Zusammenhang mit der Dezentralität. Dezentralität bedeutet, dass es keine zentrale Instanz gibt, die für die Datenbank zuständig ist. Stattdessen synchronisieren18 eine Vielzahl von „Nodes“ (Netzwerkteilnehmer) in einem Peer-To-Peer-Netzwerk (dezentrales Netzwerk; dezentrale autonome Organisation) ständig die Transaktionsdaten. Fällt ein Netzwerkteilnehmer weg, gefährdet dies dabei nicht die Stabilität bzw Funktionalität des Netzwerkes an sich.19
Auch Torrent-Netzwerke sind dezentral ausgestaltet. Diese unterscheiden sich dadurch zur Blockchain, dass Zustände nicht einmalig transferiert werden (Verhinderung von Double Spending auf der Blockchain), sondern Inhalte vervielfacht werden können – bspw in Zusammenhang mit Filesharing-Protokollen.
Eine Transaktion auf einer Blockchain zeigt in ihrer grundlegendsten Form die Quelle, die Destination bzw Destinationen und einen spezifischen Wert20, der übertragen werden soll, an. Die Quelle und Destination bzw das Ziel bezeichnet man auf einer Blockchain auch als Adressen21, wobei es jedem frei steht, neue Adressen anzulegen. Wird eine solche Adresse bzw ein Public Key angelegt, wird automatisch eine zusätzliche einzigartige („unique“) alphanumerische Zeichenkette generiert und dem Public Key zugeordnet (der "Private Key"; „privater Schlüssel“).22 Jedem Public Key ist in der Regel nur ein Private Key zugeordnet, wobei es auch sogenannte „Multi-Sig-Verfahren“ („Multi-Signature“) gibt, bei denen einem öffentlichen Schlüssel mehrere private Schlüssel zugeordnet sind und zur Durchführung einer Transaktion auch mehrere Private Keys benötigt werden.23
Abseits der auf Dauer ausgelegten Speicherung von Transaktionsdaten gewährleistet eine Blockchain, dass jede Transaktionsanforderung mit dem Inhalt einer Anweisung, einen Wert von einer Adresse zu einer anderen Adresse zu übertragen, verifiziert und bestätigt wird. Bestätigte Transaktionsanforderungen werden in der Folge auf der Blockchain gespeichert und erzeugen hierdurch die namensgebende und sinnbildliche Datenkette einer Blockchain. Jeder Block einer Blockchain verfügt über eine Hash- bzw Streuwertfunktion (Algorithmus oder mathematische Funktion), welcher aus dem vorhergehenden bereits verifizierten Datensatz generiert wird und derart eine Datenhierarchie erzeugt. Durch diesen als „Mining“ oder „Minting“ bezeichneten Prozess24 wird die Transaktionshistorie fortlaufend erweitert.25
Die Bestätigung von Transaktionen erfolgt dabei nicht einzelfallsbezogen, sondern werden mehrere Transaktionen gleichzeitig en bloc bestätigt und in einem neuen Block auf der Blockchain gespeichert. Im Durchschnitt wird im Zeitpunkt der Verfassung vorliegender Arbeit ca alle 13 Sekunden ein Block auf der Ethereum-Blockchain erstellt.26 Neben den angeführten Grundfunktionen ermöglichen Blockchains wie Ethereum auch die Ausführung dezentraler Programme bzw Anwendungen (decentralized apps; dapps; Smart Contracts). Smart Contracts führen bestimmte Aufgaben gemäss ihrem Programmiercode aus und basieren zumeist auf if-then-else-Anweisungen (Wenn Bedingung A eintritt, dann wird Aktion B ausgeführt, ansonsten erfolgt C).27 Der Begriff „Smart Contract“ wurde dabei im Jahr 1994 von Szabo geprägt: „A smart contract is a computerized transaction protocol that executes the terms of a contract. The general objectives of smart contract design are to satisfy common contractual conditions (such as payment terms, liens, confidentiality, and even enforcement), minimize exceptions both malicious and accidental, and minimize the need for trusted intermediaries. Related economic goals include lowering fraud loss, arbitration and enforcement costs, and other transaction costs. Some technologies that exist today can be considered as crude smart contracts, for example POS terminals and cards, EDI, and agoric allocation of public network bandwidth.“28
Dabei deutet Szabo in seinem Manifest zu Smart Contracts an, dass die Überlegungen hierzu noch weiter zurückreichen und zwar auf das sogenannte Agoric Computing29, welches seinen Ursprung in den 1970er und 1980er Jahren nimmt.30
Weiterführend zur „LegalTech-Debatte“, Ricardian Contracts, Turingvollständigen Programmiersprachen, Oracles und der technischen, wie rechtlichen Auseinandersetzung Hönl in Die liechtensteinische Anstalt als Decentralized Autonomous Organization.31
1.2 Token, Coins und Standardisierung trotz depositum regulare
Das TVTG idF BuA 2019/54 definiert dabei einen Token als eine Information auf einer dezentralen Datenbank (VT-System, welches die sichere Verfügung von Token gewährleistet), welche Rechte repräsentieren kann und der VT-Identifikatoren bzw Kennungen zugeordnet werden.32 Gemäss dieser rechtlichen Diktion könnte dabei der Schluss gezogen werden, dass Token Informationen auf einer dezentralen Datenbank sind, die Rechte repräsentieren, während ein Coin als Unterart eines Token zu sehen ist, der keine Rechte abbildet und für das ordnungsgemässe Funktionieren einer Blockchain notwendig ist (Protokoll-Token bzw Protokoll-Coin) und dessen Wert sich aus Angebot und Nachfrage am Markt bemisst, weshalb er selbst bei Akzeptanz als Tauschmittel kein Objekt ohne inneren Wert darstellt und sohin nicht als Fiatgeld33, sondern als virtuelle Währung zu behandeln ist. Technisch gesehen ist es jedenfalls umgekehrt zu sehen und stellt ein Coin die native Einheit einer Blockchain dar, während Token denselben technischen Standard wie der native Coin verwenden.34
Doch auch aus der Gesetzesformulierung ergibt sich lediglich, dass es sowohl Token gibt, welche Rechte repräsentieren, als auch solche, die keine Rechte repräsentieren (arg „eine Information, die Rechte repräsentieren kann.“).35 Rein technisch gesehen ist ein Token Software36 und als solche Teil einer Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Sicherheitsvorkehrung, welche verwendet wird, um die Nutzung von softwarebasierte Dienstleistungen zu autorisieren.37 Den Gesetzesmaterialien kann dabei weder entnommen noch unterstellt werden, dass Coins als Unterart von Token zu sehen sind und keine Rechte repräsentieren. Denkbar wäre dabei auch, dass ein Protokoll-Token bzw nativer Token, mit welchem Transaktionen auf einer Blockchain durchgeführt werden können, das Eigentumsrecht an Waren wie bspw Edelmetallen repräsentiert.38 Essentiell wäre dabei, dass das dingliche Recht an solchen Handelswaren im Token abgebildet wird und der Verfügungsberechtigte39 über den Token sohin auch das Vollrecht an der spezifisch repräsentierten Sache hat. Als Folge des Vollrechtes Eigentum an der repräsentierten Sache hat der Verfügungsberechtigte über einen solchen Token auch den Herausgabeanspruch über diese Sache. Um dabei effektiv ein Warengeld bzw einen Goldstandard zu schaffen, müsste die Sache, an welcher das Eigentumsrecht im Token repräsentiert wird, regelmässig verwahrt werden (depositum regulare). Der Verwahrer würde dabei die Sache über entsprechenden Auftrag des Eigentümers (Verfügungsberechtigter über den Token) als Fremdbesitzer (Besitzmittler) für den Eigentümer in Verwahrung nehmen.40
Ein Verfügungsberechtigter über einen solchen Token, der das Eigentumsrecht an einer Handelsware abbildet, könnte auch nach seinem Ermessen als Eigentümer über die Sache , deren Recht repräsentiert wird, schalten und walten (erga-omnes-Wirkung dinglicher Rechte im Gegensatz zur schuldrechtlichen inter partes Wirkung zwischen den Vertragsparteien). Wenn der Verfügungsberechtigte den Token über die Blockchain transferiert, geht gleichzeitig das Eigentum an der spezifizierten Sache über (im konkreten Fall mittels Besitzanweisung an den Verwahrer, welcher die Sache fortan mittelbar für den neuen Verfügungsberechtigten über den Token besitzt).41 Da ein dinglicher Anspruch auf die Sache besteht, an welcher das Eigentumsrecht im Token repräsentiert wird, kann diese vom Verfügungsberechtigten des Token auch jederzeit herausverlangt bzw vindiziert werden.42
Dabei ist zu beachten, dass ein Verwahrer nach den Vorschriften über den Verwahrungsvertrag dieselben Sachen zurückzustellen hat43, die in Verwahrung gegeben wurden.44 Auch wenn ein Verwahrer lediglich Sachen derselben Art und Güte45 zurückzugeben hat, kann weiterhin eine regelmässige Verwahrung vorliegen. Es kommt nämlich darauf an, was hinsichtlich des Eigentumsverhältnisses ausbedungen wird. Soll der Verwahrer Eigentümer werden, liegt eine unregelmässige Verwahrung vor (depositum irregulare); verbleibt hingegen der Hinterleger als Eigentümer, so kommt es zur regelmässigen Verwahrung. Für die regelmässige Verwahrung ist sohin entscheidend, dass ein Hinterleger Eigentümer bleibt.46 Die Vermengung bzw der Austausch seitens des Verwahrers von Sachen mit Sachen derselben Art und Güte und desselben Umfangs hat keine Auswirkung auf einen ausbedungenen regelmässigen Verwahrungsvertrag, solange dem Verwahrer kein Verfügungsrecht über die Sache zum eigenen Nutzen zukommt und der Hinterleger folglich jederzeit vindizieren kann.47
Sohin ist bei entsprechender Verwahrungsabrede ein Verfügungsberechtigter eines Token, welcher das Eigentumsrecht an einer Sache repräsentiert, als Eigentümer einer – bspw über Besitzanweisung in Verwahrung gegebenen Sache – zu sehen. Es besteht nicht nur ein schuldrechtlicher Anspruch, vorausgesetzt der Verwahrer hat kein Verfügungsrecht zu eigenen Gunsten über die hinterlegte Sache und der Hinterleger hegt weiterhin die Absicht Eigentümer zu bleiben. Dies ist mitunter essentiell, um das Vorliegen eines tokenisierten Finanzinstrumentes auszuschliessen, da es hierbei zu keiner Standardisierung48 kommt, sondern ein individualisierter sachenrechtlicher Anspruch besteht.49 In der Folge ist auch – bei Annahme, dass ein solcher Token ein (entmaterialisiertes) Traditionspapier50 darstellt – die funktionale Äquivalenz zu Finanzinstrumenten zu verneinen, da keine austauschbaren Anteile gegeben sind.51 Mittels Parteienabrede ist es dabei dennoch möglich zu vereinbaren, dass ein Verwahrer schuldbefreiend an den Verfügungsberechtigten eines Token leisten kann, wenn er ihm Waren derselben Art und Güte und im selben Umfang herausgibt, was nichts am Vorliegen einer regelmässigen Verwahrung ändert. Effektiv könnte also eine Standardisierung auf Ebene des Verwahrvertrages durch entsprechende Vereinbarung stattfinden, ohne dass hierdurch ein Finanzinstrument begründet wird.
5Frick/Vogt in Barnes (Hrsg), Banking Regulation Review, S 318.
6 Vgl diesbezüglich die vermeintliche Trias an Vermögensrechten aus dem Schadenersatzrecht in § 1293 ABGB, welcher einen Schaden als einen Nachteil am Vermögen, Rechten oder der Person definiert. Rechte am Vermögen und an der Person stellen jedoch bereits auf alle erdenklichen Rechte ab, vgl Reischauer in Rummel, ABGB, 3. Auflage, § 1293 ABGB, Rz 1.
7 Bericht und Antrag 2019/54 (bzw BuA 2019/93) der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend die Schaffung eines Gesetzes über Token und VT-Dienstleister (Token- und VT-Dienstleister-Gesetz; TVTG) und die Abänderung weiterer Gesetze; in der Praxis wird das TVTG auch häufig als „Blockchain-Gesetz“ bezeichnet, vgl Nägele/Bergt, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie im liechtensteinischen Aufsichtsrecht, Regulatorische Grauzone?, LJZ 2/18, S 63 (64); Nägele/Xander, Token Offerings, insbesondere Initial Coin Offerings (ICO) und Security Token Offerings (STO) sowie Token im liechtensteinischen Recht: Regulatorisches Umfeld und Ausblick, Rz 18.53 in Piska/Völkel (Hrsg), Blockchain Rules; auch die Regierung bezeichnete mit ihrem Vernehmlassungsbericht betreffend die Schaffung eines Gesetzes über auf vertrauenswürdigen Technologien (VT) beruhende Transaktionssysteme (Blockchain-Gesetz; VT-Gesetz; VTG) und die Abänderung weiterer Gesetze, welcher am 28.08.2018 von der Regierung verabschiedet wurde, das dazumal in Vernehmlassung befindliche VTG als „Blockchain-Gesetz“.
8 BuA 2019/54, S 62; das Sachenrecht definiert dabei den Begriff der Sache nicht, verweist jedoch auf das Grund- und das Fahrniseigentum in Art 20 SR iVm Art 34 und Art 171 SR – vgl Arnet in CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art 641 ZGB, N 6; idem, N 10: „Nur materielle Gegenstände mit räumlicher Ausdehnung können Sachqualität aufweisen. Rechte und Energien sind keine Sachen, werden aber in einigen Fällen wie Sachen behandelt“ – demnach sind Token, als digitale Repräsentation elektronisch oder magnetisch gespeicherter Daten und sohin letztlich als elektromagnetische Energie, keine Sachen nach diesem engen Sachenrechtsbegriff. Gleichwohl können Token als Software digitale Inhalte bzw Handelsware darstellen, vgl hierfür Titel II. Kapitel II.2.2.2, FN 398.
9 An Forderung kann kein Eigentumsanspruch begründet werden. Wird eine solche jedoch in einer Urkunde verbrieft, können an dieser Urkunde, welche eine Körperlichkeit in Form von Papier aufweist, dingliche Rechte bestellt werden, Arnet in CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art 641 ZGB, N 10; der liechtensteinische Sachenrechtsbegriff wurde von der Schweiz rezipiert und stellt ähnlich dem deutschen BGB (§ 90 BGB) auf unpersönliche, körperliche und räumlich abgegrenzte Gegenstände, welche der menschlichen Herrschaft unterworfen werden können, ab. Der naturrechtlich geprägte Sachenbegriff des österreichischen ABGB ist hingegen viel umfassender und unterscheidet zwischen körperlichen und unkörperlichen Sachen (§ 285 iVm § 292 öABGB), Opilio, Arbeitskommentar zum liechtensteinischen Sachenrecht, Band I, Art 20 SR, Rz 7 (S 32). Im österreichischen Strafrecht wurde Energie ursprünglich mittels authentischer Interpretation als Sache behandelt. Später wurde dieser Ansatz wieder verworfen und der Sachbegriff wiederum auf körperliche Dinge eingeschränkt, Wach in Triffterer/Rosbaud/Hinterhofer (Hrsg), Salzburger Kommentar zum StGB, § 132 StGB, Rz 1 (S 1) mwN. Während elektrische Energie in Österreich nach herrschender zivilrechtlicher Lehre als körperliche Sache behandelt wird, ist auch hier weiterhin umstritten, ob Software eine körperliche Sache darstellt, oder nur wenn diese auf einem physischen Datenträger gespeichert wird. Daten können jedoch unkörperliche Sachen darstellen, Hofmann in Schwimann/Kodek, ABGB Praxiskommentar, § 292 ABGB, Rz 3 und 5 (S 15 f). Dieser weite Sachenrechtsbegriff des österreichischen ABGB ist dabei lediglich programmatischer Natur und wird auch nicht konsequent durchgezogen. So ist auch der Gutglaubenserwerb (§ 367 öABGB) lediglich an körperlichen Sachen viabel, Kodek in Schwimann/Neumayr (Hrsg), ABGB Taschenkommentar, § 285 ABGB, Rz 3 (S 448).
10 LGBl-Nr 2019.118.
11 Nicht zu verwechseln mit im Effektengiro übertragbaren Wertpapieren nach Art 392 ff SR, welche Finanzsicherheiten darstellen.
12 AGmvK gemäss Art 361 PGR (Aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital als Pendant zur in Luxemburg vorherrschenden SICAV – Société d'Investissement à Capital Variable; nicht zu verwechseln mit den ähnlich lautenden Gegenpart SICAF – Société d’Investissement à Capital Fixe).
13 Protected Cell Company (PCC) nach Art 243 PGR.
14 Vgl BuA 2014/69, S 49 (Art 243e Abs 5 PGR).
15 Auch Special Purpose Vehicle (SPV) genannt.
16 Nicht alle Blockchains sind per se öffentlich. Es wird unterschieden zwischen „permissioned“ bzw „private“ und „unpermissioned“ bzw „permissionless“ oder „public blockchains“. „Public“ und „private“ beziehen sich dabei auf die „write permission“, während „open“ und „closed“ auf die „read permission“ abstellen. Bitcoin und Ethereum sind hiernach „public“ und „open“ Blockchains – es hat sohin jeder Schreib- und Lesezugriff. Eine public closed Blockchain könnte hingegen für die Ausübung des anonymen Wahlrechtes genutzt werden. Ist Transparenz von bestimmten Entitäten gefragt, ergibt eine private open Blockchain Sinn. Für behördlichen Verkehr wäre hingegen eine private closed Blockchain am geeignetsten. Ein möglicher Use Case einer permissionless bzw public Blockchain liegt beispielsweise in der Realisierung der sogenannten Self-Sovereign-Identity (SSI) als Ergänzung und achte Ebene des Open Systems Interconnection Model (OSI), welches das Referenzmodell für Netzwerkprotokolle darstellt (Physical Layer, Data Link Layer, Network Layer, Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer und Application Layer). Dies kann insbesondere in Zusammenhang mit Datenportabilität von verifizierten Daten eine essentielle Rolle spielen (Identifizierung, Altersverifizierung, etc pp).
17 Lesefunktion bzw „read permission“; die Schreibfunktion („write permission“) – wie bspw durch Übermittlung eines Zustandes („state“) mittels Transaktion von Token – ist zwar im Regelfall auch öffentlich zugänglich, verursacht jedoch einen Aufwand, weshalb für eine „write permission“ Transaktionsgebühren anfallen. Auf dem Ethereum-Protokoll fallen Transaktionsgebühren in Form von Gas an. Gas entspricht dabei den benötigten Wei (Untereinheit von Ether) für die Ausführung der Codezeilen.
18 Auch „broadcasting of states“ genannt.
19 Vgl weiterführend Büch, Die Blockchain und das Recht, LJZ 2/18, S 55 (S 55 f); vgl auch Nägele/Xander, Token Offerings, insbesondere Initial Coin Offerings (ICO) und Security Token Offerings (STO) sowie Token im liechtensteinischen Recht: Regulatorisches Umfeld und Ausblick, Rz 18.4 in Piska/Völkel (Hrsg), Blockchain Rules; vgl ferner den Prospekt der Hydrominer IT-Services GmbH vom 26.11.2018, S 87 und 125 f, https://www.hydrominer.org/wp-content/uploads/2018/11/Hydrominer-H3O-Prospectus_2018-11-26_approved.pdf, aufgerufen am 04.08.2019, 00:58.
20 „Source“, „target“ und „value“.
21 Eine alphanumerische Zeichenkette („string“), die nach mathematischen Regeln erzeugt wird (die Adresse bzw „public key“; auch als öffentlicher Schlüssel in Art 5 Abs 1 Z 2 VTG in der Fassung des Vernehmlassungsberichtes bezeichnet – bzw später abgeändert zum technologieneutralen VT-Identifikator in Art 2 Abs 1 lit e TVTG idF BuA 2019/54). Ein VT-Identifikator ermöglicht dabei die eindeutige Zuordnung von Token und dient insofern als Kennung (BuA 2019/54, S 145). Unter einer „Kennung“ versteht sich gemäss Duden ein „charakteristisches Merkmal, Zeichen oder Gesamtheit charakteristischer Merkmale, Zeichen zur eindeutigen Identifizierung von etwas.“, vgl die Definition im Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Kennung, aufgerufen am 04.08.2019, 00:46.
22 Bei der asymmetrischen bzw Public-Key Verschlüsselung ist es nicht erforderlich, dass miteinander kommunizierende Parteien einen gemeinsamen geheimen Schlüssel kennen, da jeder Nutzer ein eigenständiges Schlüsselpaar generiert. Mit dem Public Key können Daten verschlüsselt werden, welche mit dem korrespondierenden Private Key wiederum entschlüsselt werden können.
23 Dies wird auch als „m-of-n transaction“ bezeichnet, da einem Public Key N Private Keys zugeordnet sind und für einen Transfer von Token von dieser Adresse mindestens M Private Keys benötigt werden (bspw 2 von 3; vergleichbar mit der Ausgestaltung von gesellschaftsrechtlichen Zeichnungsrechten); vgl Prospekt der Hydrominer IT-Services GmbH vom 26.11.2018, S 87 und 125 f, https://www.hydrominer.org/wp-content/uploads/2018/11/Hydrominer-H3O-Prospectus_2018-11-26_approved.pdf.
24 Im Falle von Bitcoin wurde hierfür ein Proof of Work (PoW) Mechanismus durch Zurverfügungstellung von Rechenleistung implementiert (Arbeitsnachweis durch Lösung einer mathematischen Aufgabe). Häufig anzutreffen ist unter anderem auch das sogenannte Proof of Stake System (PoS). Die Konsensbildung im Netzwerk erfolgt hierbei durch einen gewichteten Anteilsnachweis (bspw Teilnahmedauer und Anzahl der gehaltenen Token). Die Art des Konsensusmechanismus hängt teilweise auch von der Art der Blockchain ab – vgl FN 16.
25Büch, Die Blockchain und das Recht, LJZ 2/18, S 55 (S 55 f); Prospekt der Hydrominer IT-Services GmbH vom 26.11.2018, S 87 und 125 f, https://www.hydrominer.org/wp-content/uploads/2018/11/Hydrominer-H3O-Prospectus_2018-11-26_approved.pdf. Ein Transfer von Zuständen wird dabei nur vom Netzwerk bestätigt, wenn dieser den Protokollregeln entspricht (bspw muss sichergestellt werden, dass der Übertragende auch tatsächlich über die zu transferierende Anzahl an Token verfügt, ferner darf kein double-spending erfolgen, etc). Zur ordnungsgemässen Autorisierung muss jede Transaktion mit dem Private Key signiert werden.
26https://etherscan.io/chart/blocktime, aufgerufen am 19.10.2019, 13:20.
27 Prospekt der Hydrominer IT-Services GmbH vom 26.11.2018, S 126f, https://www.hydrominer.org/wp-content/uploads/2018/11/Hydrominer-H3O-Prospectus_2018-11-26_approved.pdf; der Name „Smart Contract“, welcher auf einen Vertrag abstellt, ist dabei eher irreführend, zumal ein Smart Contract ein manipulationssicheres, selbstüberprüfendes und selbstausführendes Skript darstellt. Ein solches Skript kann durchaus auch einen Vertrag im rechtlichen Kontext darstellen, zumal Verträge selbst mündlich oder konkludent geschlossen werden können. Vgl zur Begrifflichkeit „Smart Contract“ iZm der Blockchain auch Buterin, 13.10.2018, 10:21, https://twitter.com/VitalikButerin/status/1051160932699770882?ref_src=twsrc%5Etfw, aufgerufen am 30.09.2019: „To be clear, at this point I quite regret adopting the term ‘smart contracts’. I should have called them something more boring and technical, perhaps something like "persistent scripts."
28Szabo, Smart Contracts, 1994, https://web.archive.org/web/20011102030833/http://szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html(nur mehr Archivlink verfügbar).
29 Von griechisch ἀγορά für Sammelstelle bzw Marktplatz.
30 Vgl Miller/Drexler, The Agoric Papers in The Ecology of Computation in Huberman (Hrsg), Markets and Computation: Agoric Open Systems, Incentive Engineering: for Computational Resource Management, Comparative Ecology: A Computational Perspective 1988, https://e-drexler.com/d/09/00/AgoricsPapers/agoricpapers.html; vgl auch Wozke, Smart Contracts: Wenn Verträge zwischen Computern geschlossen werden, 11.07.2017, https://blockchain-hero.com/smart-contracts-vertraege-zwischen-computern/, aufgerufen am 01.10.2019, 21:14.
31Hönl, Die liechtensteinische Anstalt als Decentralized Autonomous Organization, Die Ausübung von Gründerrechten durch Teilnehmer einer Blockchain, Abschnitt 4.2.2. Struktur einer Transaktion.
32 Art 2 Abs 1 lit c TVTG idF BuA 2019/54.
33 Zur Definition von Fiatgeld, E-Geld als Fiatgeld und virtuellen Währungen vgl Titel II. Kapitel II.2.9.
34 So wäre rein technisch zum Beispiel Ether als Coin zu sehen während Token, welche ERC-20 compliant (Ethereum Request for Comment Standard 20) sind, eine Unterart dieses Coin-Standards und sohin Token darstellen würden. Zu beachten ist, dass es auch native Coins gibt, die Rechte repräsentieren. Dem TVTG folgend wären dies dann (native) Token (Protokoll-Token), welche Rechte repräsentieren; Nägele/Bergt, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie im liechtensteinischen Aufsichtsrecht, Regulatorische Grauzone?, LJZ 2/18, S 63 (64); vgl https://de.bitcoinwiki.org/wiki/Coin, aufgerufen am 08.08.2019, 20:10: „Coin is a cryptocurrency with its own blockchain, usually created by developers from scratch or by forking. You can also find the term “altcoin”, which implies an alternative coin, that is any coin that is not Bitcoin.“; vgl ferner https://de.bitcoinwiki.org/wiki/Token, aufgerufen am 08.08.2019, 20:10: „Tokens are different from bitcoins and altcoins in that they are not mined by their owners […] but [meant] to be sold for fiat or cryptocurrency in order to fund the start-up's tech project.“; Coins gelangen sohin zumeist – neben etwaigen anderen Funktionen – in Zusammenhang mit dem Konsensbildung durch einen Consensus-Algorithmus (bspw Proof-of-Work oder Proof-of-Stake) einer Blockchain zur Anwendung.
35 Art 2 Abs 1 lit c Z 1 TVTG idF BuA 2019/54.
36 Deshalb auch Software Token, während Hardware Token auf einem physischen Gerät gespeichert werden (Hardware Wallet); vgl bzgl Token als Daten bzw Software im Sinne von Handelsware und sohin einer Marke mit intrinsischem Wert (Wertmarke; Token) im Gegensatz zu Token als Repräsentation einer Forderung bzw Mitgliedschaftsrechten (E-Geld oder Einlagen bzw Mitgliedschafts- und Forderungsrechte im Sinne von Finanzinstrumenten) Titel II. Kapitel II.2.2.2II.2.3.
37Rosenblatt/Cipriani, Two-factor authentication: What you need to know (FAQ), 15 Juni 2015, https://www.cnet.com/news/two-factor-authentication-what-you-need-to-know-faq/, aufgerufen am 28.08.2019, 21:32; Petruș, How to extract data from a 2FA iCloud account, 12, August 2019, https://www.iphonebackupextractor.com/blog/extract-data-two-factor-authentication/, aufgerufen am 28.08.2019, 21:34; die Multi-.oder Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine Methode der Authentifizierung, bei welcher einem Computernutzer erst Zugriff gewährt wird, wenn er zwei oder mehr Beweise (Faktoren) für einen Authentifizierungsmechanismus nachweist. Die Faktoren beziehen sich dabei auf die Elemente Wissen, Besitz und Inhärenz. Diese Elemente stimmen dabei mit jenen der starken Kundenauthentifizierung nach PSD II überein, vgl hierzu Titel II. Kapitel II.2.8.1.
38 So könnte bspw eine Goldwährung bzw ein Goldstandard gebildet werden, wobei der wirtschaftswissenschaftlichen Geldtheorie folgend dies die Umlaufgeschwindigkeit (velocity) von tokenisiertem Gold erhöhen würde und als Konsequenz den Wertaufbewahrungscharakter von Gold zu einem gewissen Grad zunichte machen würde.
39 Die Umschreibung durch denjenigen, der rechtmässig über den Token verfügen kann, scheint die dogmatisch einzig gangbare Lösung, da eine Inhaberschaft auf das sachenrechtliche Corpus-Element (Verfügungsgewalt) abstellen würde, während ein Besitzer neben dem Corpus auch einen Animus (possidendi) benötigt (animus rem sibi habendi oder animus rem alteri habendi). Eigentum stellt hingegen nicht auf das tatsächliche, sondern auf das rechtliche Herrschaftsverhältnis ab. Ein Token stellt jedoch gemäss liechtensteinischer Rechtsanschauung keine Sache dar und sind die sachenrechtlichen Vorschriften lediglich im Zuge der Umsetzung des TVTG sinngemäss bzw funktionaladäquat (nicht funktional-äquivalent) anwendbar; vgl BuA 2019/54, S 126.
40 Die fremde Sache wird mit Besitzwillen für den Eigentümer verwahrt; Art 499 Abs 2 und Art 503 Abs 1 erster Fall iVm Art 510 SR; Vgl Besitzanweisung § 375 öABGB iVm § 428 3. Fall öABGB (von der ständigen österreichischen Rsp entwickelt – Besitzanweisung in Abgrenzung zur traditio brevi manu und dem Besitzkonstitut). Anders als gemäss Legaldefinition des öABGB sieht Liechtenstein aufgrund der eigenständigen Sachenrechtsbestimmungen positiviert vor, dass eine Sache auch erworben werden kann, wenn diese im Besitz eines Dritten bleibt. Dies ist dabei funktional vergleichbar zum § 931 deBGB, wonach Eigentum durch Abtretung des Herausgabeanspruches übertragen werden kann (Übergabe mittels Zession).
41 Causa bzw Titel für die Eigentumsübertragung ist eine schuldrechtliche Vereinbarung zwischen der Person, welche den Token transferiert und jener, die ihn annimmt, wobei sich der Modus durch die tatsächliche Übereignung des Token von der Wallet-Adresse derjenigen Person, welche aus der obligationenrechtlichen Abrede zum Transfer verpflichtet ist an die Wallet-Adresse derjenigen Person, die hieraus berechtigt ist, auszeichnet. Auch eine fiktive Übereignung mittels Besitzkonstitut ist nach liechtensteinischem Sachenrecht zulässig – vgl Opilio, Arbeitskommentar zum liechtensteinischen Sachenrecht, Band I, Art 187 SR, Rz 4 (S 406; Art 187 iVm Art 503 SR).
42 So kann im Falle des Konkurses ausgesondert werden (Art 41 Abs 2 KO) oder bei Einbeziehung in einer Exekution die Exszindierungsklage (Art 20 EO) erhoben werden.
43 Stück- bzw Speziesschuld.
44 § 961 ABGB.
45 Gattungs- bzw Genusschuld. Eine konkretisierte Gattungsschuld wird dabei wie eine Stückschuld behandelt.
46 RIS-Justiz RS0012049, „Für die Frage, ob ein depositum regulare oder irregulare vorliegt, kommt es nicht auf die Vermengung der erlegten Sachen ( Geld ) mit eigenen Sachen des Verwahrere an, sondern auf die wirtschaftlichen Absichten der Parteien.[sic!]“
47Parapatits in Schwimann/Kodek, § 959 ABGB, Rz 4 ff; bei unregelmässiger Verwahrung geht das Eigentum an einer Sache hingegen an den Verwahrer über und hat der Hinterleger lediglich einen obligationenrechtlichen Rückforderungsanspruch.
48 Vgl Titel II. Kapitel II.2.3.1a.
49 Vgl auch BuA 2019/54, S 104 f zur Abbildung von Eigentumsrechten in einem Token.
50 Zivilrechtliches Wertpapier, welches einen Herausgabeanspruch an einer Sache repräsentiert; auch Waren(wert)papier, Konnossement, Ladeschein. Vgl auch Art 387 und Art 504 SR.
51 Vgl bezüglich der funktionalen Äquivalenz bei handelsrechtlichen Traditionspapieren BaFin, Merkblatt Depotgeschäft, https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_090106_tatbestand_depotgeschaeft.html, 06.01.2009, zuletzt geändert am 17.02.2014, P 1.a).
1.3 Fazit tokenisiertes Eigentumsrecht
Eine Blockchain ist eine dezentrale, öffentliche und permanente Datenbank. Abhängig von der Ausgestaltung der Lese- und Schreibrechte kann diese dabei für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Die Bitcoin- und Ethereum-Protokolle sind „public“ und „open“ Blockchains. „Public“ besagt in diesem Zusammenhang, dass, anders als bei „private“ Blockchains, jeder Schreibrechte hat, während eine „open“ Blockchain auf öffentliche Leserechte im Gegensatz zu „closed“ Blockchains abstellt.
Rein technisch kann ein Token als Datensatz bzw Software gesehen werden, welche einer Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Sicherheitsvorkehrung unterliegt und in der Folge genutzt werden kann, um softwarebasierte Dienstleistungen zu autorisieren. Bei einer solchen Multi-Faktor-Authentifizierung wird einem Nutzer eines Computerprogrammes erst Zugriff gewährt, wenn ausreichend Beweise bzw Faktoren für eine Authentifizierung nachgewiesen werden. Derartige Faktoren stellen auf die Elemente Wissen, Besitz und Inhärenz ab, welche sich im Übrigen auch in Zusammenhang mit der starken Kundenauthentifizierung nach PSD II wiederfinden.
Coins bzw – in der Diktion des TVTG – Token werden dabei regelmässig auf einer eigenen Blockchain eingesetzt. Anders als solche Coins werden Token nicht durch Mining erzeugt, sondern auf einer existierenden Blockchain bspw in Zuge eines Fundraisings ausgegeben. Diese Terminologie ist dabei insbesondere im technischen Bereich weit verbreitet, hat aber keine besonderen Auswirkungen auf die rechtliche Beurteilungen und können so die Begrifflichkeiten Coins und Token weitestgehend synonym eingesetzt werden.
Auch wenn Coins im obigen Sinne nicht zwingend Rechte repräsentieren müssen, sind diese nicht als Fiatgeld (gemeint nicht nur Papiergeld, sondern auch Buch- und E-Geld) zu sehen, da diese im Sinne von virtuellen Währungen einen intrinsischen Wert im Zusammenhang mit der Konsensbildung auf einer Blockchain aufweisen bzw auch weitere Funktionen haben können, welche dem dezentralen Protokoll immanent sind.
Blockchains nutzen dabei regelmässig sogenannte Smart Contracts, welche Verträge im rechtlichen Sinne darstellen können, primär jedoch als permanente Skripte zu verstehen sind und auf das Agoric Computing zurückgehen.
Token stellen dabei mangels Körperlichkeit keine Sache im Sinne des liechtensteinischen Sachenrechtes dar. Erst mit Inkrafttreten des TVTG am 01.01.2020 sind die sachenrechtlichen Bestimmungen auf Token sinngemäss anwendbar. Unabhängig hiervon gilt der Grundsatz „Substance over Form“ und muss durchgeschaut werden, auf das, was ein Token repräsentiert. Sofern ein Verwahrer bspw eine Sache gemäss depositum regulare für einen Verfügungsberechtigten eines Tokens verwahrt, so repräsentiert ein solcher Token effektiv das Eigentumsrecht an der in Verwahrung gegebenen Sache.
2. Wertpapiere gem PGR und deren Funktionen
Die Wertpapiere werden in den §§ 73 ff der Schlussabteilung zum PGR geregelt. Im Sinne des PGR sind Wertpapiere Urkunden, in welchen ein Recht verbrieft wird, so dass es nur mit der Urkunde verwertet, geltend gemacht bzw übertragen werden kann. Ergänzend finden dabei die Vorschriften über Aktienurkunden auf Wertpapiere Anwendung.52 Eine ähnliche Definition findet sich dabei in Art 965 des schweizerischen OR wieder. Hierbei ist der Umstand zu beachten, dass das PGR auf den ersten Entwurf von Eugen Huber zur Revision der Titel 24 bis 33 des OR aus dem Jahr 1919 beruht, welcher jedoch in der Schweiz in in dieser Form nie umgesetzt wurde.53 Anders als Österreich und Deutschland kennen sowohl das liechtensteinische als auch das schweizerische Recht sohin eine gesetzliche Definition des Wertpapierbegriffs.54
Durch die Verbriefung soll eine noch grössere Umlauffähigkeit bzw Handelbarkeit erreicht werden. Es gibt dabei diverse Prinzipien, welche auf Wertpapiere zur Anwendung gelangen, bzw verstehen sich diese Prinzipien als Funktionen von Wertpapieren zur Gewährleistung der speditiven und sicheren Übertragbarkeit bzw Geltendmachung von Wertpapierrechten. Die einfache Übertragung wird durch die Übertragung des Wertpapieres erreicht (Transportfunktion). Ferner dient die Wertpapierurkunde als Beweismittel und kann ein Schuldner nur an jenen mit schuldbefreiender Wirkung leisten, der sich durch die Urkunde legitimiert; eine Verständigung über die Übertragung, wie dies bei der Abtretung von Forderungen mittels Zession der Fall ist, ist nicht notwendig (Liberationsfunktion für den Schuldner an den aus dem Wertpapier Berechtigten schuldbefreiend, sohin liberierend, zu leisten; gleichzeitig erfolgt der Ausweis der Berechtigung zum Erhalt der Leistung – die Legitimation – durch Vorlage des Wertpapiers, welches ein bestimmtes Recht verbrieft; es gilt die Vermutung, dass der Inhaber des Wertpapiers auch verfügungsberechtigt ist).55
Die Verkörperung eines Rechts in einer Urkunde hat auch die Indizienwirkung bzw trägt den Beweis mit sich, dass das Recht gemäss dem verbrieften Inhalt tatsächlich besteht (Indiz- und Beweisfunktion). Dabei wird das Recht im Umfang wie im Wertpapier beschrieben erworben und sind unverbriefte Abreden unbeachtlich (mit der Beweisfunktion in Zusammenhang stehende Einredenbeschränkung bzw Einwendungsausschluss oder auch Skripturhaftung). Der Einwendungsausschluss steht dabei wiederum in engem Zusammenhang mit der Präsentations- bzw Verkehrsschutzfunktion. Die Präsentationsfunktion hat zur Folge, dass ein Schuldner nur an den Inhaber eines Wertpapieres – der dieses vorweist bzw präsentiert – leisten darf. Die Präsentationsfunktion, welche auch nicht gänzlich losgelöst von der Beweis-, Liberations- und Legitimationsfunktion gesehen werden kann, führt letztlich zur Verkehrsschutzfunktion, wonach das Wertpapier gutgläubig vom nicht über das Wertpapier Verfügungsberechtigten erworben werden kann.56
Wertpapiere zeichnen sich sohin insbesondere durch eine Beweisfunktion, Legitimations- und Liberationsfunktion, einen Einwendungsausschluss, eine Transportfunktion, sowie eine Präsentations- bzw Verkehrsschutzfunktion aus. Die Verkehrsfähigkeit wird sohin insbesondere durch die Möglichkeit des Erwerbs vom Nichtberechtigten, aber auch durch Durchsetzbarkeit des verbrieften Rechtes unabhängig vom – abseits der Urkunde – tatsächlich entstandenen bzw bestehenden, oder inhaltlich allenfalls auch abgeänderten Recht, geschützt.
2.1 Indiz- und Beweisfunktion
§ 73 der Schlussabteilung zum PGR definiert ein Wertpapier anhand von drei Kriterien. Es sind diese eine Urkunde, die Verbriefung eines Rechtes in dieser Urkunde, sowie eine bestimmte Verbindung zwischen Urkunde und Recht.57 So kann das Recht aus einem Wertpapier nicht ohne die Urkunde verwertet, geltend gemacht, noch auf andere übertragen werden. Die Übertragungskomponente stellt dabei wesentlich auf die Transportfunktion ab.58 Als Urkunde wird dabei eine privatrechtliche Erklärung auf einem Schriftstück gesehen.59 In einer solchen Urkunde können Forderungs-, Mitgliedschafts-, oder auch Sachrechte festgehalten werden. Forderungsrechte können dabei alle obligationenrechtlichen Ansprüche sein, während Mitgliedschaftsrechte bestimmte Rechte an Körperschaften – sohin Kontroll- und/oder Mitwirkungsrechte beinhalten. Darüber hinaus können in einem Wertpapier auch dingliche Ansprüche abgebildet werden. Solche Waren(wert)papiere sind Wertpapiere, die Sachen vertreten; die Übertragung eines Warenpapiers entspricht dabei der Übertragung der Ware selbst.60
Die erwähnte Verbindung zwischen Urkunde und Recht wird dabei mittels Wertpapierklausel verabredet. Ein Wertpapier hat dabei nicht blosse Indizienwirkung, sondern legitimiert eine bestimmte Person zur Forderung einer verbrieften Leistung. Durch Leistung an die ausgewiesene Person befreit sich der Schuldner von seiner Pflicht. Derartige Wertpapierrechte werden auch durch Übertragung der Urkunde übertragen und können nicht auf sonstige Weise abgetreten werden.61 Ein Wertpapier beweist sohin, dass ein bestimmtes Recht gegenüber dem Aussteller besteht, welches gemäss dem Inhalt der Urkunde geschuldet wird.62
2.2 Liberations- und Legitimationsfunktion
Die Liberations- als auch Legitimationswirkung von Wertpapieren erfährt in Liechtenstein eine doppelte Regelung. Einerseits konstatiert § 1393 ABGB, dass auf Überbringer lautende Schuldscheine – sohin Inhaberpapiere – durch Übergabe abgetreten werden und sohin abseits des Besitzes keines weiteren Beweises bedürfen; die Urkunde weist sohin den rechtmässigen Gläubiger aus und legitimiert den Besitzer (bei Inhaberpapieren).63 Andererseits regelt § 74 Abs 2 der Schlussabteilung zum PGR das Legitimationsrecht in Zusammenhang mit Wertpapieren.64 Die angeführte Bestimmung im PGR legt fest, dass ein Schuldner – sofern er nicht arglistig oder grob fahrlässig, sohin bösgläubig und bei, nicht aber vor, Verfall65 handelt – schuldbefreiend an den aus einem Wertpapier Berechtigten leisten kann. Selbst wenn derjenige der sich aus dem Wertpapier legitimiert die Gläubigerstellung verloren haben sollte, kann der aus dem Wertpapier Verpflichtete sich seiner Schuld durch Leistung an den Ausgewiesenen liberieren und hat dem eigentlich berechtigten Gläubiger nicht erneut zu leisten.66 Die Legitimation und Liberation stehen sohin auch in Konnex zum Verkehrsschutz.67
Der Besitz eines Wertpapiers legitimiert den durch das Papier Ausgewiesenen als Gläubiger. Die Verfügungsberechtigung muss sohin nicht durch eine lückenlose Übertragungskette der vorhergehenden Gläubiger bewiesen werden. Präsentiert der Besitzer und sohin Gläubiger eines Wertpapiers das verurkundete Recht, so hat der Schuldner an den Ausgewiesenen zu leisten.68 Wie bereits ausgeführt sagt § 74 Abs 2 der Schlussabteilung zum PGR nichts über die materielle Berechtigung des Besitzers aus; selbiges gilt darüber hinaus auch für § 1393 ABGB. Der Besitzer (bei Inhaberpapieren) bzw generell gesprochen der Ausgewiesene gilt jedoch als Gläubiger. Möchte ein Schuldner die Verfügungsberechtigung eines Ausgewiesenen bestreiten, trägt er hierfür die Beweislast.69
Als zweite Seite derselben Münze stellt die Liberationsfunktion das schuldnerseitige Pendant zur Legitimationsfunktion des aus einem Wertpapier als berechtigt Ausgewiesenen dar. Der Schuldner kann nur an denjenigen, der sich durch ein Wertpapier als berechtigter Gläubiger ausweist schuldbefreiend leisten und muss sich dabei auf die verbriefte Urkunde als Beweismittel verlassen. Auch an einen an sich nicht Verfügungsberechtigten kann der Schuldner liberierend leisten, sofern sich Ersterer durch Vorlage eines Wertpapiers ausweist und dieses aushändigt.70 Zu beachten ist, dass eine schuldbefreiende Wirkung an den Altgläubiger gemäss § 1395 ABGB im Wertpapierrecht nicht zum Tragen kommt, da nur an den mittels Wertpapier Ausgewiesenen zu leisten ist. Anders als in Österreich ist dies für Liechtenstein nicht gewohnheitsrechtlich zu begründen, da hier auf Art 966 chOR zurückgehend in § 74 der Schlussabteilung zum PGR konstatiert wird, dass ein Schuldner nur gegen Vorlage des Wertpapiers durch den in der Urkunde Ausgewiesenen zur Leistung verpflichtet ist und an diesen formell korrekt ausgewiesenen Gläubiger auch schuldbefreiend leisten kann.71
Für Namenspapiere ist die Befreiungs- und Berechtigungswirkung zudem separat in § 83 der Schlussabteilung zum PGR geregelt, welcher auf Art 975 chOR zurückgeht. Hiernach kann ein Schuldner nur schuldbefreiend an denjenigen leisten, der das Namenpapier einerseits innehat und sich darüber hinaus als diejenige Person ausweist, auf deren Namen das Wertpapier lautet.72 Beachtlich ist dabei, dass das PGR lediglich von der Innehabung bzw Inhaberschaft73 spricht und auf das Corpus-Element respektive die Verfügungsgewalt abstellt, während sich das ABGB in dessen § 1393 explizit auf den Besitz bezieht und sohin auch ein Animus-Element (Wille, eine Sache zu behalten)74 als erforderlich erachtet.
2.3 Präsentations- bzw Verkehrsschutzfunktion
Die Präsentationsfunktion ergibt sich aus § 74 Abs 1 der Schlussabteilung zum PGR. Demgemäss ist der Schuldner aus einem Wertpapier nur gegen Vorweisung und Aushändigung desselben zur Leistung verpflichtet. Sofern jemand ohne Präsentation des Wertpapiers das darin verbriefte Recht geltend machen möchte, hat der Schuldner die Leistung zu verweigern.75
Die Wertpapiertitel werden dabei sachenrechtlich behandelt – das Recht aus dem Papier folgt dem Recht am Papier.76 Die Übertragung von Wertpapieren lautend auf Inhaber kommt sohin unter Bezugnahme auf Art 501 SR iVm § 75 Abs 2 der Schlussabteilung zum PGR grundsätzlich wirksam durch Übergabe der Urkunde zustande. Inhaberpapiere können aber wie auch andere Arten von Wertpapieren § 75 Abs 1 der Schlussabteilung zum PGR folgend mittels schriftlichen Vertrages und der Übergabe des Wertpapiertitels übertragen werden. Für den Besitzer des Wertpapieres gilt dabei die gesetzlich widerlegbare Vermutung, dass dieser auch der rechtmässige Eigentümer ist. Die Verkehrsschutzfunktion geht auf Art 172 Abs 2 SR zurück und schützt den gutgläubigen Erwerber eines Wertpapieres in seinem am Wertpapier erworbenen Eigentum. Hierdurch wird die Verkehrsfähigkeit von Wertpapieren geschützt respektive gewährleistet, da die Einreden gegenüber einem gutgläubigen Erwerber eines Wertpapieres beschränkt sind; so kann dieses vom gutgläubigen Erwerber nicht vindiziert werden. Für auf Inhaber lautende verbriefte Titel ergibt sich diese Einredenbeschränkung bzw Verkehrsschutzfunktion zusätzlich aus Art 514 SR, in welchem explizit festgehalten wird, dass Inhaberpapiere, welche dem Besitzer entgegen seinem Willen77 verlustig gegangen sind, von demjenigen der diese Kraft guten Glaubens erworben bzw empfangen hat, nicht herausgefordert werden können.78
Für Orderpapiere wird der Verkehrsschutz darüber hinaus eigens in § 88 der Schlussabteilung zum PGR geregelt. Diese Bestimmung entspricht Art 1146 chOR und ist vom Regelungsgehalt übereinstimmend mit § 96 Abs 1 der Schlussabteilung zum PGR (Regelung für Inhaberpapiere), welcher Art 979 chOR entspricht. Die Norm bezweckt einen Verkehrsschutz, da der Schuldner einem gutgläubigen Empfänger lediglich Einreden entgegenhalten kann, welche sich aus dem Inhalt und79 dem gültigen Bestand des Wertpapiertitels ergeben, oder aber dem Schuldner unmittelbar gegen dem aus dem Wertpapier Berechtigten zustehen.80
2.4 Transportfunktion
Die Transportfunktion von Wertpapieren besagt, wie der Name bereits impliziert, dass verbriefte Rechte einfach übertragen werden können, indem die – allenfalls indossierte – Wertpapierurkunde übertragen wird.81 Die Transportfunktion ergibt sich ebenfalls aus Art 73 Abs 1 der Schlussabteilung zum PGR, wonach in einer Urkunde verbriefte Rechte nur durch Übertragung der Urkunde übertragen werden können.82
2.5 Fazit wertpapierrechtliche Funktionen und deren Anwendung auf Wertrechte gemäss TVTG und PGR neu
Bei Wertrechten tritt an die Stelle der Transportfunktion durch Übergabe der Wertpapierurkunde gemäss TVTG die Eintragung ins Wertrechtebuch.83
Darüber hinaus haben Wertrechte nach § 81a der Schlussabteilung zum PGR idF BuA 2019/93 (LGBl 2019.304) dieselbe Funktion wie Wertpapiere. Dies bedeutet, dass den Wertrechten ebenso die Verkehrsschutzfunktion immanent ist und ein gutgläubiger Erwerb auch von den mittels TVTG im PGR neu, positiviert eingeführten Wertrechten möglich sein muss. „Fehlt bei der Übertragung von nicht verbrieften Forderungsrechten eine dem Besitz vergleichbare Rechtsscheingrundlage, ist diese im Falle der Wertrechte in Gestalt der für das Wertrecht konstitutiven Eintragung im Wertrechtebuch durchaus vorhanden, sofern die Gesellschaft für die zuverlässige Nachführung […] des Wertrechtebuchs Sorge trägt und dem jeweiligen Gläubiger eine Beweisurkunde über den nicht öffentlichen Eintrag ausstellt.“84 Es ist sohin auch ein gutgläubiger Erwerb von Wertrechten möglich; dass das sachenrechtliche Regime auch auf Wertrechte Anwendung findet, ergibt sich aus den Gesetzesmaterialien zum TVTG, welche auch auf die positiviert eingeführten Wertrechte gemäss PGR neu eingehen.85 Das Abstraktionsprinzip gilt hingegen nur für tokenisierte Wertrechte gemäss TVTG, während auf Wertrechte des PGR neu weiterhin das Kausalitätsprinzip zur Anwendung gelangt.86 Kommt also ein wirksames Verpflichtungsgeschäft nicht zustande oder fällt dieses im Nachhinein weg, ist in Zusammenhang mit tokenisierten Wertrechten nach dem TVTG bereicherungsrechtlich rückabzuwickeln, während Wertrechte nach dem PGR neu vindiziert werden können.87
Letztlich knüpft hinsichtlich der Wertrechte nach PGR neu auch die Legitimations- wie Liberationsfunktion an die Eintragung im Wertrechtebuch an.
3. Token als entmaterialisierte Wertpapiere de lege lata?
In diesem Kapitel erfolgt die Behandlung von Token als Wertrechte gemäss der Rechtslage vor Inkrafttreten des TVTG. Werden Rechte, so zum Beispiel Mitgliedschafts- oder Forderungsrechte in einem Token abgebildet, so wird kein Wertpapier ausgegeben, da ein Token keine körperliche Urkunde darstellt.88 Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass derartige Rechte – repräsentiert im Token – buchmässig geführt werden. Dies steht dabei in Einklang mit Art 150 Abs 1 PGR iVm Art 149 Abs 3 PGR und Art 267 Abs 1 PGR. Art 150 Abs 1 PGR konstatiert, dass Wertpapiere über eine Mitgliedschaft nur ausgegeben werden dürfen, wenn dies gesetzlich explizit vorgesehen ist, was argumentum e contrario zur Folge haben muss, dass gar keine Wertpapiere ausgegeben werden dürfen, wenn dies nicht gesetzlich erlaubt ist. Selbst wenn dies der Fall ist muss es möglich sein, Wertpapiere rein buchmässig, sohin als Wertrechte zu führen. Auch in Zusammenschau mit Art 149 Abs 3 PGR ergibt sich, dass wenn keine Wertpapiere ausgegeben wurden, die Übertragung von Mitgliedschaftsanteilen oder die Bestellung beschränkt dinglicher Rechte hieran durch schriftlichen Vertrag erfolgen kann. Auch die aktienrechtlichen Vorschriften sehen vor, dass Aktienurkunden nur ausgeben werden müssen, sofern dies in den Statuten nicht anders geregelt wird.89 Für eine buchmässige Führung von Anteilsrechten kann eine technische Abbildung in einem Token sohin nicht schädlich sein.
Die wertpapierrechtlichen Vorschriften finden sich neben den angeführten vereinzelten Bestimmungen in den allgemeinen Vorschriften des PGR und speziellen Vorschriften wie im Aktienrecht insbesondere in der Schlussabteilung zum PGR.90 Ob bei einer Aktiengesellschaft Aktienurkunden für das Aktionariat auszugeben sind, ist dabei gemäss Art 267 Abs 1 PGR in den Statuten zu regeln; im dispositiven Standardfall sind Wertpapiere auszustellen.91 Vorschriften, wonach ein Aktientitel durch ein Mitglied des Verwaltungsrates unterschrieben werden muss, können dabei nur zur Anwendung gelangen, sofern Urkunden ausgestellt wurden und dies nicht statuarisch abbedungen wurde.92
Beim PGR von 1926 orientierte sich der liechtensteinische Gesetzgeber zwar an den Vorarbeiten von Huber93 zur Revision des schweizerischen Obligationenrechts94, weshalb dieses grundsätzlich als Rezeptionsgrundlage herangezogen werden kann, jedoch ist zu berücksichtigen, dass dieser Revisionsentwurf in der Schweiz in der Folge überarbeitet wurde und erst im Jahr 1937 in Kraft trat.95 Vergleicht man das Aktienrecht der Schweiz in den Art 620 ff OR, wird eine ähnliche Regelung in Bezug auf die Ausstellung von Aktientiteln wie jener in Art 267 PGR vermisst. Vielmehr stellen einige Bestimmungen des schweizerischen OR explizit auf das Vorhandensein von Aktientiteln als physische Urkunde bzw Wertpapier ab.96 Zur Realisierung von entmaterialisierten Wertpapieren wurde in der Schweiz das Bucheffektengesetz beschlossen.97
Aber auch wenn gesetzgeberisch lediglich in Liechtenstein und nicht auch in der Schweiz vorgesehen ist, dass die Ausstellung von Aktienurkunden unterbleiben kann bzw statutarisch abbedungen werden