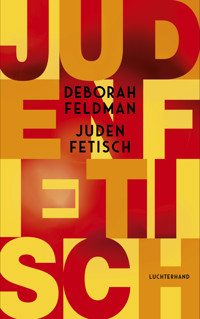9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung des SPIEGEL-Bestsellers und der gleichnamigen erfolgreichen Netflix-Serie „Unorthodox“
Mit 23 verlässt Deborah Feldman die ultraorthodoxe chassidische Gemeinde der Satmarer Juden in Williamsburg, New York, und damit das Leben, das sie in »Unorthodox« so packend erzählt hat. Die Möglichkeit zurückzukehren hat sie nicht. Sie folgt ihrem großen Traum, gemeinsam mit ihrem Sohn in Freiheit zu leben. Sie verlässt New York und folgt den europäischen Spuren ihrer geliebten Großmutter, die den Holocaust überlebt hat und die die einzige Person war, bei der sich die junge Frau angenommen fühlte. Schließlich gelingt es Deborah Feldman, Wurzeln zu schlagen, ausgerechnet in Berlin, dem Ort, der durch die Satmarer mit so vielen Ängsten und Vorurteilen verbunden war. Bildstark, wortgewaltig erzählt Deborah Feldman die beeindruckende Geschichte einer Selbstfindung und Versöhnung mit der Vergangenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 925
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DEBORAH FELDMAN
Überbitten
Eine autobiografische Erzählung
Aus dem amerikanischen Englisch von Christian Ruzicska
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Genehmigte Taschenbuchausgabe Januar 2019by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenCopyright der Originalausgabe © 2017 by Secession Verlag für Literatur, ZürichÜbersetzung des jiddischen Kinderliedes: Markus KrahCovergestaltung: Semper Smile nach einem Entwurf und unter Verwendung eines Motivs vonErik Spiekermann/Robert Grund, Berlinmr · Herstellung: scISBN 978-3-641-26993-7V004
www.btb-verlag.dewww.facebook.com/btbverlag
Die Namen und charakteristischen Identifikationsmerkmale aller Personen in diesem Buch, die nicht explizit ihrer Nennung zugestimmt haben, wurden geändert. Wenngleich auch alle in diesem Buch beschriebenen Vorkommnisse wahr sind, so wurden doch bestimmte Ereignisse verkürzt, verdichtet oder neu angeordnet, um die Identität der in sie involvierten Personen zu schützen und den Fluss der Erzählung zu gewährleisten. Jeder einzelne Dialog ist, entsprechend meiner genauesten Erinnerung, eine bestmögliche Annäherung an die Form, in der er tatsächlich stattgefunden hat.
Einige wenige Textpassagen des Buches kommen auch in geänderter Form in meinem in den USA veröffentlichten zweiten Buch, Exodus, vor, diese Teile wurden stark geändert, gründlich erweitert und in den Erzählfluss eingegliedert.
Wenige Passagen des Textes wurden bereits im Vorhinein aus dem Manuskript entnommen, und in diversen internationalen Tageszeitungen in geänderter und verkürzter Form abgedruckt.
Dem Andenken meiner unvergesslichen Großmutter gewidmet!
Inhalt
Vorwort
Vor sieben Jahren
Jahr 1
Jahr 2
Jahr 3
Jahr 4
Jahr 5
Jahr 6
Jahr 7
Danksagung
»Alle sieben Jahre sollst du ein Erlassjahr halten.«
Deuteronomium 15:1
VORWORT
IN WILLIAMSBURG, wo ich innerhalb der Grenzen der chassidischen Satmarer Gemeinde aufwuchs, lehrte man uns Kinder früh die alten biblischen Gesetze aus der Zeit der Tempel, jener Periode vor der Diaspora, als die jüdischen Menschen noch einen Sinn dafür hatten, was ein Zuhause bedeutete und die Würde, die sich daraus ergibt. Diese Gesetze fühlten sich für uns wie abstrakte Ideen an, sie waren Teil eines großen Erbes, das uns zum Trost gereichen sollte, das auch einzusetzen wir aber nur selten die Gelegenheit erhielten.
Die Ausnahme bildete der Garten meiner Großmutter, vielleicht sogar eines der letzten Fleckchen Erde in Williamsburg, das nicht völlig zubetoniert war. Dieser Garten war die persönliche Zufluchtsstätte meiner Bubby, ein Stück Natur im Kleinen, in das sie sich zurückzog, wenn es sie nach Ruhe und Frieden verlangte, wohingegen mein Großvater alles dafür tat, diesem Refugium eine religiöse Ordnung aufzubürden, ganz so, wie er es mit allen Dingen in seinem Leben hielt. Gut möglich, dass ihm dies nach dem Chaos, das er während des Krieges hatte durchleben müssen, ein wenig Trost spendete.
Wie auch immer, es war die Ordnung der Natur selbst, der sich meine Großmutter, auch sie eine Holocaustüberlebende, verpflichtet fühlte. Der Konflikt, der während ihrer gesamten Ehe zwischen ihnen gärte, kann sehr wahrscheinlich auf diese beiden miteinander im Wettstreit liegenden Formen der Loyalität zurückgeführt werden, und vielleicht gilt das auch für jenen Konflikt, der schon früh in mir selbst zu gären begann. Im Falle meiner Großeltern war es mein Zeide, der schließlich triumphierte. Der Garten, den meine Großmutter über Jahre hinweg so liebevoll kultiviert hatte, wurde einem uralten religiösen Gesetz unterworfen, dessen starre Anwendung sich für dieses Paradies im Kleinen als tödlich erwies und in gewisser Weise zum Verlust jener Großmutter führte, die ich kannte und liebte, was ich jedoch erst Jahre später realisieren sollte, als ich mit ihrer plötzlichen körperlichen Abwesenheit schwer zu kämpfen hatte.
Während meiner ausschließlich religiösen Erziehung auf der privaten Mädchenschule wurde ich unter anderem über die umfangreichen landwirtschaftlichen Gesetze im alten Israel unterrichtet, und mir wurde beigebracht, dass man damals das Land jedes siebte Jahr ruhen ließ. Auf Hebräisch sagt man dazu Schmitta, oder Schabbatjahr. Gott hatte befohlen, das Land in dieser Zeit brachliegen zu lassen. Keine landwirtschaftliche Tätigkeit war erlaubt, nichts, was in irgendeiner Form dem Wachstum hätte dienlich sein können. Jegliche Frucht galt als herrenlos, sie war sich selbst überlassen und fiel zu Boden, sobald ihre Zeit gekommen war. Den Armen war gestattet, private Ländereien zu betreten und sie dort für sich aufzusammeln. Jegliche Schuld war erlassen. Es war wie ein Neubeginn, für das Land, aber auch für die Menschen, die sich auf ihm abplagten. Es galt als eine Art Prüfung religiösen Gehorsams, der in den nachfolgenden Jahren mit reichen Ernten belohnt werden würde.
In der Welt, in der ich aufwuchs, kam man in der unerbittlichen Ordnung religiöser Dogmen nicht zu Atem. Aber ich erinnere mich, wie sich schon damals, als mein Großvater gnadenlos die alten landwirtschaftlichen Gesetze auf dieses kleine, überforderte Stück Land hinter unserem Wohnhaus anwandte, abwegige Gedanken durch den lockeren Nährboden meines jungen Geistes gruben, ganz ähnlich den rundlichen Regenwürmern, wie sie meine Großmutter häufig unter den Sträuchern sich windend vorgefunden hatte, denn ich mutmaßte bereits damals, dass die Gesetze Gottes doch nicht dafür vorgesehen sein konnten, das Land abzutöten, sondern es wieder aufzufrischen. Ich stellte mir vor, dass ich Gott besser kannte als irgendeiner der alten und weisen Menschen um mich herum; ich nahm an, dass sie ihn schmerzlich missverstanden hatten. So denkt die Arroganz einer Kindheit, die keine elendsvollen Erniedrigungen oder Leiden gekannt hat. Diese Menschen jedoch hatten die Apokalypse überlebt, und sie hatten einen neuen, postapokalyptischen Gott beschworen, einen Ausbruch unkontrollierter Wut, und folglich machte meine Gemeinschaft keinen Gebrauch mehr von den vielen Nachsichtigkeiten und Freiheiten, wie etwa den ausgefeilten Stickarbeiten auf einfacher Kleidung, die unsere Religion einst ausgezeichnet hatten. Stattdessen trachteten sie danach, die schlichtesten Kleider fortwährend noch fester zu binden, und hofften dabei, die Enge von Ordnung und Glauben würde den Sinn für Sicherheit wieder heraufbeschwören, der ihnen auf ewig entrissen worden war. Je offener die Welt um sie herum wurde, desto weiter zogen sie sich zurück.
Auch ich hätte mich wohl, als ich in unserem kleinen Shtetl mündig wurde, diesen Regeln anheimgeben sollen, aber irgendwie hatten sich die Kräfte in mir verschworen und genügend geistigen Freiraum geschaffen, um darin unabhängiges Gedankengut gedeihen zu lassen. Später, als ich dringend jenen physischen Raum benötigte, in dem ich meine Vorstellungen umsetzen konnte, ging ich fort, um niemals mehr zurückzukehren. Und indem ich diesen Schritt in die Außenwelt tat, war ich prompt versucht, die zwingend notwendige Persönlichkeit, die ich in all diesen Jahren wie eine Schutzhülle getragen hatte, abzustoßen, voller Hoffnung, dass das, was sich von unten emporarbeiten würde, mein wahres Selbst wäre, gleich einem Schössling in frisch gepflügter Erde.
Ich entdeckte recht bald, dass meine beiden Persönlichkeiten – jene, die ich als authentisch, und jene, die ich als falsch ansah – Wurzeln geschlagen hatten, die beim Fluchtprozess untrennbar voneinander, als Bündel eines Ganzen, der Erde entrissen worden waren. Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, dass jegliches Abhacken vom Wurzelballen mit dem Ziel, diejenigen Teile meiner Identität abzusondern, von denen ich mich befreien wollte, mehr Schaden anrichtete, als Gutes bewirkte.
Als ich mich auf der anderen Seite jener unsichtbaren Barriere, die mich immer eingeengt hatte, wiederfand, spürte ich, dass meine Zukunft irgendwo dort draußen lag und meiner wartete, aber ich verfügte über keine Orientierungsmittel, um durch den leeren Raum zwischen diesen beiden Punkten – dem, was war und dem, was kommen sollte – zu navigieren, abgesehen von dem moralischen Kompass, den meine Großmutter in mich eingepflanzt hatte, deren Geist nun in mir lebendig zu werden schien und wie eine zitternde Magnetnadel dem geografischen Norden zustrebte. Es war diese Kraft, die mir zu verstehen half, dass der Schlüssel, mit dem eine auch noch so dunstverschleierte Küste erreicht werden konnte, nicht etwa in der Ablösung von meiner Vergangenheit lag, sondern vielmehr im Zurückgreifen auf ihre Fäden, die es mit der Zukunft zu vernähen galt. Also tastete ich den Stoff rückwärtslaufend ab, um eine Stelle zu erfühlen, wo das Gewebe noch fest genug war, um Ankerfäden halten zu können. Ich wollte die Risse verweben, so wie man eine Wunde näht; die Kräfte miteinander versöhnen, die stets als Widersprüche in Erscheinung traten, in Wahrheit jedoch die ganze Zeit über sich ergänzende Teile eines Ganzen waren.
Ich spürte die magnetische Wirkung des europäischen Kontinents, jenes Raumes, den meine Gemeinschaft zu verbrannter Erde erklärt hatte, und ich bereiste ihn, um diesen großen Mythos, der über meiner Kindheit schwebte, aus nächster Nähe zu betrachten. Aber wo ich erwartete, auf Ödnis zu stoßen, fand ich im Gegenteil eine Vielfalt an Arten vor. Ähnlich, wie es die Beschreibung jener landwirtschaftlichen Zyklen im Heiligen Land vorsah, hatte Verzicht unweigerlich und auf natürliche Weise den Weg zu Heilung und Regeneration geebnet.
Auf sieben Schmitta-Zyklen folgt das Jubeljahr, das Jahr der Barmherzigkeit, ein Jahr, in dem Sklaven und Gefangene freigelassen werden. Wie es im Levitikus 25 heißt: Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt ein Freijahr ausrufen im Lande allen, die darin wohnen; denn es ist euer Halljahr. Da soll ein jeglicher bei euch wieder zu seiner Habe und zu seinem Geschlecht kommen. Natürlich war mir stets bewusst, dass ich nie wieder zu jener Familie zurückkehren konnte, die mich großgezogen hatte, aber ich konnte zurückkehren zu dem Landstrich, auf dem meine Familie einst ansässig war, und der nun brachgelegen hatte für eine Spanne von zehn Schmittas, drei Menschengenerationen, siebzig Kalenderjahre, und auf ihm zu leben, würde bedeuten, ihn wiederzubeleben.
Inzwischen sind genau sieben Jahre seit meiner Flucht vergangen, und jenen beiden Persönlichkeiten, die sich Seite an Seite und doch getrennt voneinander entwickelt hatten, war es schließlich erlaubt, sich zu verflechten, und damit ging das erste wirkliche Gefühl für ein vollständiges Selbst einher, hier in dieser alten und doch neuen Welt. In meinem Bewusstsein trage ich noch immer die Erinnerung an die Vergangenheit, aber nicht nur an die jüngste, sondern auch an die entferntere, ältere Vergangenheit, die dieser vorangeht, jene, die die letzten drei Generationen auf einen Webfehler in einem fadenscheinigen Stoff reduziert hatte, und aus diesem Grund habe ich die Fähigkeit erworben, die Zukunft als etwas Grenzenloses und Unbestimmbares zu vergegenwärtigen, als etwas, das in unseren vielen Händen liegt und nicht etwa in den Händen eines reizbaren und einzelnen Gottes.
Sieben Jahre lang war ich eine Art Flüchtling. Ich platzte in diese Welt, indem ich jene Öffnungen nutzte, die Globalisierung und Technologie in ihre alten Mauern geschlagen hatten, und unzählige andere haben dies ebenso getan wie ich. Schmerzlicherweise haben sich viele Menschen, die ich einst kannte, und die ebenfalls diesem Weg gefolgt waren, in den letzten Jahren das Leben genommen. Was passiert, wenn du die Tür aufstößt, und das einzige, was du vorfindest, ist Leere? Und ich rede hier nicht nur von uns, sondern von jedwedem Menschen, der sich auf eine Reise ohne Rückfahrschein begibt. Ich habe mir diese eine Frage in den vergangenen sieben Jahren beständig gestellt: Ist es möglich, anzukommen? Immer wenn mich die Nachrichten über noch einen Suizid erreichten, fühlte es sich an wie ein persönlicher Schlag gegen meine eigenen Hoffnungsreserven. Sie alle hatten die Frage für sich selbst beantwortet, indem sie einen entscheidenden Sprung in die Leere taten. Ich fragte mich, warum ich bislang diesen Sprung nicht getan hatte. Später sollte ich den Grund dafür darin erkennen, dass in jener Zeit meine Füße bereits festen Boden berührt hatten. Indem ich meine Gemeinschaft verließ, glaubte ich, auch die einzig verlässliche Quelle von Liebe und Schönheit in meinem Leben verloren zu haben: meine Großmutter. Und doch war es ihr ureigener Weg, der die Spur zum Leuchten brachte, auf der ich nun in umgekehrter Richtung reiste. Ihre Liebe zur Harmonie war es, die mich lehrte, wie die unvereinbaren Teile meines Selbst zusammenzubringen waren. Nun bin ich nicht mehr eine, die flieht, oder eine, die floh. Nun bin ich, wider alle Wahrscheinlichkeit, die, die zurückgekehrt ist.
Berlin, im Spätsommer 2016
»Warum gerade jetzt? Warum, fragte ich mich letztes Jahr irgendwann, schwebt die Frage nach der jüdischen Identität so schwer greifbar, so unfassbar über mir, eine Wolke, deren Umrisse ich gar nicht wirklich erfassen kann, die sich für mich anfühlt, als hätte sie keine klaren Konturen? (…) Fähig zu sein, sogar die erstaunte Frage des Kindes Warum hassen sie uns so? stellen zu können, fähig zu sein, wir sagen zu können. Die Schuld, nicht dazu fähig zu sein, die Schuld, möglicherweise meine Eltern oder sogar jene Opfer, jene Überlebenden durch reine Neugierde verraten zu haben – sie ließ in mir jahrelang auch den Impuls gefrieren, mehr über den Holocaust herausfinden zu wollen.«
Adrienne Rich, aus dem Essay Split at the Root
VOR SIEBEN JAHREN
IM ALTER VON ACHT JAHREN wage ich zum ersten Mal eine Frage zu stellen, die sich in meinem Geist schon lange vorher zusammengebraut hatte. Ich hatte Angst, es mochte einen dunklen Grund geben, warum meine Gedanken eher zum Zweifel neigen als zum Glauben. Diese Art Leben, das wir führen – es fühlt sich für mich nicht natürlich an, auch wenn ich weiß, dass es das sollte. Da niemand sonst an diesem Kummer leidet, rätsle ich, ob wohl eine genealogische Verunreinigung diese Anomalie erklären könnte. Ich befürchte, man betrachte mich wegen der Handlungen meiner Mutter als unrein, woraus folgt, dass auch sie durch jemanden unrein geworden ist, durch irgendeinen rätselhaften, vergessenen Vorfahren. Dies würde erklären, warum ich so bin, wie ich bin, und nicht wie die anderen.
»Bubby, bin ich hundertprozentig jüdisch?«, frage ich. Denn ich denke, es ist ein für mein Schicksal entscheidender Punkt, ob ich es bin oder nicht. Ich muss wissen, ob ich hoffen darf, dazuzugehören.
»Was für eine Frage!«, ruft sie. »Natürlich bist du jüdisch«, versichert sie mir. »Jeder in unserer Gemeinschaft ist es.« Sie verbannt meine erhebliche Angst mit einem Lacher. Aber wie kann sie sich so sicher sein?
»Schau dir unsere Welt an«, sagt sie. »Schau, wie isoliert wir leben. Wie wir immer gelebt haben. Juden vermischen sich nicht mit anderen und andere vermischen sich nicht mit uns. Und da denkst du, du könntest nicht ganz hundertprozentig sein?«
Ich kam nicht auf den Gedanken, zu erforschen, warum dann so viele Menschen unserer Gemeinschaft helle Augen hatten, blasse Haut, blondes Haar. Meine Großmutter selbst hatte immer stolz von ihren blonden Kindern gesprochen. Blässe und nicht dem jüdischen Stereotyp entsprechende Gesichtszüge galten bei uns als wertvoller Vorzug. Es bedeutete, dass einer fähig war durchzukommen. Es war das Geschenk der Maske, das Gott uns gewährte, zufällig gewährte, wie es schien, auch wenn man uns glauben hieß, dass er ein genaues System bei der Gewährung seiner Privilegien verfolge. Und so mochte ein Mangel an Blondsein auf spirituelle Unterlegenheit verweisen, gut möglich aber auch, dass es sich genau andersherum verhielt, das hing davon ab, wie man die Dinge betrachtete. Als ich mit siebzehn Jahren zum ersten Mal meinen Ehemann traf, achtete ich hauptsächlich auf sein blondes Haar und dessen Bedeutung für mein genetisches Vermächtnis. Ich fragte mich, ob die Gene stark genug sein würden, um mir Kinder mit goldenem Haar zu garantieren, Kinder, die sicher wären, sollte die in den unabänderlichen Gesetzen ihrer Umlaufbahnen gefangene Welt sich gegen sie richten.
Heute weiß ich, dass diese osteuropäischen Züge und hellen Gesichtsfarben perfekt mit den genetischen Studien einhergehen, die längst bestätigt haben, dass wir mitnichten auch nur irgendwas hundertprozentig sind. Aber diese Befunde haben nie Eingang in unsere Mitte gefunden, und wenn sie es doch taten, haben sie wahrscheinlich nichts ausgerichtet. In unserer Gemeinschaft glaubten wir, wir seien so lange standardmäßig rein, wie wir isoliert lebten.
Dieses Wort jedoch, rein – es entstammt nicht unserer Sprache, nicht unserem Vokabular. Unser Begriff für ›rein‹ lautet tuhor, und dessen ursprüngliche Bedeutung bezieht sich allein auf die geistige Reinheit. Es zeigt an, von reiner Absicht zu sein, von keiner Sünde beschmutzt. In der chassidischen Tradition hatte diese Art der Reinheit stets mehr gewogen als eine starke Abstammung. Die Fixierung auf reine Blutslinien kam erst später auf, als Nebenprodukt jener Ideologien und Gesetze, die uns durch Ausschluss brandmarkten. Ein Tropfenjüdischen Blutes war – und das nicht erst im Deutschland Hitlers – alles, was es brauchte, damit jene, die es konnten, diesen Tropfen verbargen und seine Existenz leugneten, während andere, denen dies nicht gelang, sich aus instinktivem Selbstschutz hinter den Trostpreis eines perversen Stolzes zurückzogen. Sie erfanden sich eine Art Reinheit. Sie erstellten Familienstammbäume, die tausend Jahre zurückreichten, nur um ihre intakten Stämme zu bezeugen. Sie benachteiligten Juden, die keinen unverschnittenen Status nachweisen konnten. Genau wie die Nazis zogen sie sich in das falsche und trügerische Gespinst einer Identität zurück, die auf Blutsverwandtschaft gründet. Da sie der anderen Welt nicht angehören konnten, war es das Nächstliegende, einen besonderen Club zu gründen, bei dem man stattdessen Mitglied sein konnte. Wir sind tuhor, sagten sie, und meinten natürlich unsere Seelen – aber jetzt meinten sie auch unser Blut.
Wenn mein Blut jüdisch ist, ist es meine Seele auch. Deshalb will ich Bescheid wissen. Ich will verstehen, wie genau das Jüdischsein mir eingeprägt ist. Was genau ist es, das ich geerbt habe? Wie kann ich die Vorstellung davon in etwas Greifbares zwingen? Die Frage, die allen Fragen vorausgeht, lautet aber: Wie kann ich mein Jüdischsein für mich erträglich machen?
Während sie am Tisch sitzt und unter einer Leuchtstofflampe einzelne Kohlblätter nach Raupen absucht, die sie treife, nichtkoscher, werden lassen würden, sagt Bubby geistesabwesend, dass Gott die anderen Völker nur auf diesen Planeten gestellt habe, damit sie das jüdische Volk hassen und verfolgen. Es sei letztendlich diese gegnerische Kraft, die uns definiere, so wie Gott auch Nacht und Tag erschaffen habe, Dunkelheit und Licht. Das eine sei nötig, um das andere zu definieren. Unser Jüdischsein bestehe exakt im Rahmen der Versuche, es auszurotten.
Diese ihre Aussage, die mir die Welt erklären soll, und die besagt, dass alles dort draußen furchtbar ist und immer sein werde, weil der Lauf der Dinge so zu sein habe, damit sie unsere Existenz rechtfertigen, ist derart extrem, dass ich denke, sie könne es unmöglich ernst meinen; sie plappere nur nach, was der Rabbi sagt, was jeder in der Gemeinschaft ständig wiederholt. Denn wäre es nicht eine schwerwiegende Selbstüberschätzung, wenn wir uns vorstellten, alles Übel der Welt sei allein uns zum Leid geschaffen worden? Ist diese Art von Arroganz nicht schon für sich genommen eine Sünde: das eigene Leid als das Allerheiligste zu begreifen, sich ihm zu unterwerfen, wie ein Orchester sich dem Dirigenten unterwirft, seinen eigenen Willen der ultimativen Vision eines Maestros opfert?
Auch wenn wir in unserer Gemeinschaft mit Nichtjuden nur in außergewöhnlichen Ausnahmefällen interagieren, wobei der Kontakt aufs Strengste geregelt ist, so weiß ich doch, dass Bubby vor dem Krieg ganz reale Beziehungen zu nichtjüdischen Menschen unterhalten hat. Sie erwähnte Nachbarn in dem kleinen Dorf, in dem ihre Eltern einen Laden betrieben hatten, wie diese gekommen waren, um mit Hilfe einer Pumpe im Vorderhof ihr Wasser in Selters zu verwandeln, und im Gegenzug kleinere Geschenke mitbrachten; wie sie Eier, Milch und Fleisch gegen Waren, die Bubbys Eltern verkauften, eingetauscht hatten. Sie erinnerte sich, wie sie eines Tages, bereits zu alt, um noch mit ihren zehn Geschwistern im gleichen Zimmer zu schlafen, fortgeschickt wurde, um bei ihrer wohlhabenden Großmutter in der Stadt zu leben; und an diese eleganten Damen mit modischen französischen Hüten und Pelzstolen, die ihre Großmutter auf einen Tee zu sich einlud, bei Torte und Kartenspiel. Sie bereiste mit ihrer Großmutter europäische Badeorte, wo sie in Kurhotels abstiegen und mit Menschen des gesamten Kontinents verkehrten.
Dann aber denke ich daran, wie sie vor Kurzem eine Putzfrau mitgenommen hat, als wir zufällig auf das sogenannte Goyte oifpiken stießen, ein Ritual, bei dem die meisten Hausfrauen von Williamsburg mitmachen. Auf der Suche nach Schwarzarbeit finden sich allmorgendlich Ecke Marcy und Division Street illegale Immigrantinnen aus Polen ein, seltener auch aus Litauen, der Slowakei und der Ukraine, dort, wo die Straße eine Brücke über den Expressway bildet und wo dann im Lärm tönender Hupsignale und über schäbige Straßen hinwegquietschender Reifen die demütigenden Verhandlungen geführt werden. Eine chassidische Hausfrau tritt heran, beäugt jede Anwärterin sorgfältig, als prüfe sie deren körperliche Verfassung, und winkt dann mit gekrümmtem Finger die eine als geeignet Eingestufte unter der Anweisung, hervorzutreten, heran. Ein Angebot wird genannt, meist niedrig: fünf Dollar pro Stunde. Wenn sich die Frau an diesem Tag mutig fühlt, wenn die wartende Gruppe klein erscheint, wenn es noch früh ist und sie sich gute Chancen einräumt, wird sie acht fordern, aber wahrscheinlich bei sechs nachgeben. Dann ziehen sie los, die beiden, die Putzfrau in einer Haltung der Unterwürfigkeit der Hausfrau zu ihrem Wohnsitz folgend, wo sie niedrigste Arbeiten erledigen wird, damit der Dame des Hauses Entwürdigungen dieser Art erspart bleiben.
Es entgeht mir auch jetzt nicht, dass dieses Schauspiel des ›Selektierens‹ ein merkwürdiger Spiegel kollektiver Erinnerung ist. Ich verstehe es als eine unbewusst ererbte Vendetta, die sich vor dem Hintergrund der Maschendrahtumzäunung des Highways in Miniaturform abspielt. Die Geschichte der Gründer unserer Gemeinschaft, der Überlebenden, die einst von Nichtjuden für eine Zukunft inmitten von Sterblichen ›selektiert‹ wurden, wird mit jeder herangewinkten Goyte auf perverse Weise verdreht. Eine kleine, aber gleichwohl offensichtliche Genugtuung. Und doch hatte bis zu diesem Tag meine Großmutter nie bei diesem Schauspiel mitgemacht.
Das eine Mal, dass einer solchen Goyte unser Haus geöffnet wurde, fand überhaupt nur statt, weil wir auf unserem Heimweg – ich trug die Tüten mit den von meiner Großmutter eingekauften Lebensmitteln – zufällig diese Straßenkreuzung überquerten und meine Großmutter plötzlich stehen blieb und unverwandt eine Frau anstarrte, die mit dem Rücken an den Gitterzaun gelehnt dastand, während andere nach vorne drängten und sich den Hausfrauen lautstark anpriesen; eine Frau mit glanzlosem braunem, leicht ergrautem Haar, vor sich gefalteten Händen und zu Boden gerichteten Augen, die darauf wartete, dass jemand sie mitnimmt, und die vielleicht zu stolz war, um danach zu fragen. Meine Großmutter schien wie in einer Art Träumerei erstarrt. Ich stellte meine Tüten auf den Boden und schaute der Szene neugierig zu. Bubby richtete ihren Finger auf die Frau.
»Du«, sagte sie. Die Frau blickte auf.
»Magyar vagy«, sagte Bubby in einer Weise, die eher einer Aussage gleichkam als einer Frage.
Die Frau schaute überrascht, nickte dann und trat vor. Eine Flut ungarischer Wörter strömte aus ihr hervor, als hätte sie diese seit Stunden unterdrückt, und als wäre nun jemand gekommen und hätte ihr gewährt, sie endlich entweichen zu lassen. Sie ergriff Bubbys Arm, ihr Körper löste sich aus der Gruppe der Dastehenden, sie verneigte sich vor meiner Großmutter, als führe sie einen unterwürfigen Knicks aus, als flehe sie uns an, sie doch von dieser Furcht des Wartens zu erlösen, von dieser Scham, hier noch als Letzte stehen zu werden, von dieser Angst, ohne Aussicht auf Arbeit zurück nach Hause gehen zu müssen.
Ich weiß nicht, woran meine Großmutter erkannte, dass die Frau Ungarin war. An dieser Straßenkreuzung standen nur sehr selten ungarische Frauen, was wohl einer der Gründe war, weshalb meine Großmutter es stets ablehnte, eine Putzfrau anzuheuern. Ihr missfiel die Tatsache, dass sie mit den polnischen Frauen nicht reden konnte; sie mochte ihnen das Haus nicht anvertrauen. Stattdessen erledigte sie die Schwerstarbeit selbst, kniete sich mit Lappen, Bürste und Wasserkübel nieder. Jetzt aber war da eine Ungarin, jemand aus ihrer Gegend, kaum jünger als sie selbst. War ihr diese Person aus ihrer Vergangenheit bekannt? Gut möglich, dass diese Frau für meine Großmutter nur etwas aus den Tagen ihrer Kindheit verkörperte, eine Verkörperung etwa ihrer Nachbarn, all jener Nachbarn, die als Freunde galten, bevor sich das politische Klima abkühlte, und die sich dann fröhlich die Häuser und Leben schnappten, die sie anderen entrissen hatten, ohne auch nur einen Gedanken an Treue und Loyalität zu verschwenden. Alle Goyim seien so, hatte sie gesagt, nur darauf aus, aus deiner Vernichtung Nutzen zu ziehen. So habe Gott sie erschaffen. Sie könnten gegen ihre Natur einfach nicht an.
Noch war ich unentschieden, ob nun Mitleid oder der persönliche Wunsch nach ausgleichender Gerechtigkeit Bubby dazu bewogen hatten, diese Putzfrau mit nach Hause zu nehmen. Es schien eine Art menschlicher Verbindung zwischen ihr und dieser Frau zu bestehen, die nun Seite an Seite mit ihr losmarschierte und in dieser geheimnisvollen Sprache schwatzte, die ich bisher nur von meinen Großeltern kannte, während sie förmlich vor Freude zitterte, dass sie von jemandem, der sie verstand, ausgewählt worden war.
Fühlte sich Bubby tatsächlich jemandem gegenüber verpflichtet, der gleicher Herkunft war wie sie, selbst wenn diese Person nicht jüdisch war? Oder anders: Verspürte sie das Bedürfnis, ihr zu beweisen, dass sich die Umstände der Vergangenheit in ihr Gegenteil verkehrt hatten? Wollte sie dieser Frau nun all das präsentieren, was sie sich hier in Amerika aufgebaut hatte? Ihr vierstöckiges Backsteinhaus, ihre Kronleuchter, Teppiche und bodenlangen Spitzenvorhänge? Wollte sie ihr zeigen, auf welcher Seite der Geschichte der wahre Triumph lag?
Ich schaute zu, wie sie die Frau in die Küche führte, ihr diverse Putzutensilien aushändigte und sie mit Aufgaben betraute, die sie üblicherweise selbst erledigte oder an mich delegierte, das tägliche Bügeln, Abstauben und Polieren eben. Ich war verdutzt, dass sie die Frau nicht bat, den Boden zu schrubben. Das wäre wohl zu eindeutig gewesen, mutmaßte ich: Meine Großmutter schaut einer nichtjüdischen Frau aus ihrer Heimat dabei zu, wie sie sich in diesem großen und gemütlichen Haus, das sie nun besaß, niederkniete. Mir lag nichts daran, diese zufällig anwesende Frau in ihrer Würde erniedrigt zu sehen, aber ich erwog doch, dass diese Erfahrung meiner Großmutter eine Art Schlussstrich gewähren mochte. Ich dachte, sie möge vielleicht die Verbitterung über diesen alten, nachklingenden Verrat mildern, den sie in meiner Gegenwart zwar nur selten erwähnte, von dem ich aber wusste, dass er in den tiefsten Schichten ihrer Erinnerung noch schmerzhaft brannte.
Nach einigen Stunden eher einfacher Hausarbeit rief meine Großmutter die Frau zur Mittagspause an den Küchentisch. Ich war von der Haltung überrascht, mit der sie sie an den Tisch bat und sich ihr wie einer Gleichgestellten gegenübersetzte. Sie servierte ihr sogar auf echtem Porzellan, was mich nicht weniger verwirrte. Ich fragte mich, ob dies wohl Teil einer klugen und wohlbedachten Strategie sein mochte, oder aber die Vornehmheit meiner Großmutter bezeugte. Bubby hatte gefüllten Kohl aufgetaut, ein sowohl in unserer Gemeinschaft wie auch in ihrer einstigen Heimat traditionelles Gericht, und ich beobachtete, wie die Frau sich sputete, zum Essen Platz zu nehmen, während sie die ganze Zeit aufgeregt auf Ungarisch plapperte. Hier und da konnte ich Häppchen aufschnappen, sie sprachen über Rezeptvarianten, über die Art, wie ihre Mutter diese Rollen zubereitet hatte. Sie lobte Bubbys Kochkunst überschwänglich. Ich spürte, wie sie versuchte, sich einzuschmeicheln; ganz gewiss nicht ohne Grund, denn natürlich suchten all diese Putzfrauen eine feste Stelle, damit sie nicht mehr Tag für Tag, getragen von der Hoffnung, herausgegriffen zu werden, an diese Straßenkreuzung mussten. Eine regelmäßige Inanspruchnahme versprach Sicherheit, vielleicht sogar ein höheres Honorar und Empfehlungen für andere Familien, wenn man gut arbeitete. Zu viele Wochen am Zaun verbracht zu haben, war jedoch ein sicheres Zeichen dafür, eine schlechte Wahl abzugeben, und dann sank der Stundenlohn tiefer und tiefer, bis schließlich gar kein Angebot mehr kam. Das war die Furcht all dieser Putzfrauen, man konnte sie, ging man spät vormittags an den letzten Nachzüglern vorüber, in ihren Augen sehen, diese Panik, wenn die Zeit ablief und die Menge sich ausdünnte und überall Streifenwagen vorbeifuhren.
Meine Großmutter sprach wenig, während die Frau weiterhin plapperte, dabei ihr Kinn in die eine Hand gestützt hielt und mit der anderen die Muster der Tischdecke nachfuhr. Hin und wieder nickte meine Großmutter oder warf das entsprechende ungarische ›Mhmm‹ oder ›verstehe‹ ein. Als die Frau ihre Mahlzeit beendet hatte, nahm Bubby ihren Teller und wusch ihn in der Spüle. Sie kochte Kaffee und servierte ihn in einer angeschlagenen weißen Kanne. Dann legte sie eine Zwanzig-Dollar-Note auf das Tischtuch.
»Keine weitere Arbeit heute«, sagte sie entschlossen. »Schluss.«
Die Frau blickte niedergeschlagen drein. Sie musterte die Banknote auf dem Tisch. Drei Stunden Arbeit plus Trinkgeld.
»Darf ich nächste Woche wiederkommen, ja?« Auf dem Weg zur Kaffeetasse zitterten ihre Hände.
Meine Großmutter sagte nichts, sie verneinte bloß mit dem Kopf. Dann, womöglich weil ihr die Frau leid tat, sagte sie schließlich: »Mach dir keine Gedanken. Ich heuere niemals Leute an, um mir helfen zu lassen. Ich mache meine Arbeit lieber selbst.«
Die Frau versuchte, meine Großmutter umzustimmen. Sie bot an, sich hier und jetzt niederzuknien und den Boden zu schrubben, um ihre Nützlichkeit unter Beweis zu stellen. Sie ergriff die Hände meiner Großmutter und küsste sie. Ihre Verzweiflung tauchte ihre vorherige Überschwänglichkeit in vollkommen anderes Licht, und ich spürte, wie meine Großmutter sich für sie genierte.
Bubby sagte, dass es ihr leid tue, dass sie aber keine Arbeit für sie habe. Ihre Kinder seien alle groß, erklärte sie. Es gebe da nicht mehr so viel zu tun. Würde die Frau aber ihre Telefonnummer dalassen, könnte sie diese vielleicht an ihre Töchter weitergeben, könnte sehen, ob diese interessiert seien. Doch sie könne nichts versprechen.
Damit hatte die Putzfrau etwas, woran sie sich klammern konnte. Sorgfältig schrieb sie ihre Kontaktdaten auf, Stift und Papier nutzend, die meine Großmutter ihr reichte. »Ich arbeite sehr günstig«, versicherte sie. »Fünf Dollar.«
Ich schloss sachte die Tür hinter ihr, während sie sich noch in Abschiedsgrüßen überwarf, sehnsuchtsvoll jener Frau nachblickend, die ihre Sprache sprach, die dasselbe alte Land erinnerte, und von der sie sich wohl Solidarität erhofft hatte; und ich dachte, dass es doch die Generation ihrer Eltern gewesen sei, die es an selbiger hatte mangeln lassen. Als die Frau gegangen war, saß Bubby eine Zeitlang am Küchentisch und nippte an ihrem Kaffee, während ein leises Lächeln um ihre Mundwinkel spielte. Ich brannte vor Neugierde zu erfahren, was sie wohl dachte, aber natürlich konnte ich nicht einfach nachfragen.
Als ich später an der Anrichte Geschirrtücher faltete, während Bubby weiterhin schweigend auf ihrem kleinen Stuhl saß, fragte ich mich, welche Rache wohl die wahre sein mochte? Wem war bei einem solchen Spiel mehr Genüge getan, meiner Großmutter, die sich der Goyte gegenüber freundlich erwiesen hatte, auch wenn sie ihr zwar Arbeit vorenthalten, aber ihr auch die mit dieser einhergehende Erniedrigung erspart hatte, oder aber all diesen Frauen, die geflissentlich das Schrubben und Reinigen von Toilette und Treppe überwachten, und dabei auf perverse Weise Genuss daraus zogen, wie die Umstände im Laufe der Geschichte in ihr Gegenteil verkehrt worden waren? Als Kind war ich überzeugt, dass es darum ging, wer die wirksameren Methoden in diesem Spiel entwickelte; ich nahm an, dass meine Großmutter die Rechnung mit ihrer eigenen subtilen Version von Gerechtigkeit beglich.
Heute blicke ich auf diese Geschichte ganz anders zurück. Ich erkenne in meiner Großmutter den Konflikt zwischen ihrer Sehnsucht nach Anstand und den erschreckenden, aber doch nur allzu menschlichen Impulsen wieder, die sie nur schwer unterdrücken konnte. Ihr Handeln an jenem Tag als entweder dies oder jenes zu bestimmen, als mitleidsvoll oder rachsüchtig, wäre zu einfach. Bubby war großartig, weil sie so komplex war, so rätselhaft. In ihr waren all diese Kräfte zugleich am Werk, wenn auch einige davon unbemerkt, da sie gut darin war, die Oberfläche ruhig und glatt zu halten. Die stillen Dramen aber, an denen ich sie als Kind teilnehmen sah, begleiteten mich wie die Märchen, mit denen andere Kinder aufwuchsen. Dies sind die Geschichten, die ich als Erwachsene wieder und wieder in meinem Geist durchspiele und dabei nach den Schlüsseln Ausschau halte, die mir die inneren Prozesse dieser Frau offenbaren würden, nach deren Vorbild ich mich unbewusst geformt habe.
»Ich muss den Quellen und der flackernden Präsenz meiner eigenen Ambivalenz als Jüdin ins Auge blicken. (…) Ich war durch irgendetwas mit diesen Toten verbunden – nicht nur durch Sterblichkeit, sondern durch einen tabuisierten Namen, eine verhasste Identität. Aber war ich – musste ich dies wirklich sein?«
Adrienne Rich, aus dem Essay Split at the Root
MEINE LEHRERINNEN SAGTEN, jüdisch zu sein heiße, ein Zelem Elohim, einen Funken Gottes, in sich zu tragen. Bubby aber bestand darauf, dass es die Anwesenheit des Anderen war, die unsere Andersartigkeit auswies. Bei ihr klang dies so, als hörten wir auf, Juden zu sein, wenn andere aufhörten, uns deswegen zu hassen.
Gab es denn nichts außerhalb von ›jüdisch‹ und ›nicht-jüdisch‹, wollte ich wissen? Gab es etwas dazwischen, darüber hinaus? War es möglich, dass ich einer Sphäre angehörte, die jenseits dieser beiden Pole existierte?
»Diese Schwelle«, erklärte sie, »die uns umgibt, die du spürst, an die du glaubst, es gab sie schon immer. Sie ist seit eh und je wirksam. Denk nur an die Zeiten, als es überall Ghettos gab und die Absonderung der Juden durch äußere wie innere Kräfte vorgeschrieben war! Natürlich bist du rein jüdisch«, spottete sie erneut, »wie solltest du es nicht sein?« In diesem Moment wünschte ich mir, dass dies wahr wäre, dass ich glauben könnte, ich sei ebenso wertvoll wie die Menschen um mich herum. Und doch quälte mich gerade deren mangelnde Anerkennung.
Es ging in meiner Gemeinschaft nicht nur darum, jüdisch zu sein, maßgeblich war, welcher Art Jude man angehörte. Denn es gab unzählige Varianten. Selbst wenn man Aschkenasi war, konnte man noch immer in winzige und spezifische Kategorien unterteilt werden, zwischen denen jeweils eine enorme Kluft lag. Man konnte Galizianer sein, Litwak, oder Yekke. Und dann gab es die vielen Juden außerhalb des aschkenasischen Kreises, die Sephardim, die Mizrachim, die bucharischen Juden, die jemenitischen, die persischen … und sie alle hatten deutlich mehr jüdische DNA als irgendwer von uns; dennoch durften wir uns nicht mit ihnen vermischen. In unserer Gemeinschaft in Williamsburg waren einige Flüchtlingsfamilien zugegen; sie kamen aus Ländern wie Kasachstan, dem Jemen, Argentinien, dem Iran. Aber selbst die, deren Vorfahren vor zwei Generationen noch in Europa gelebt hatten, waren nicht wie wir, da sie für zwei Generationen von der Tradition abgeschnitten gewesen waren, eine Zeitspanne, die sie unmöglich aufholen konnten, denn innerhalb dieser beiden Generationen war die Bedeutung dessen, was es hieß, jüdisch zu sein, völlig neu bestimmt worden.
Der Krieg hatte die Aufspaltungen nur noch weiter vorangetrieben. Nun akzeptierte jede Sekte ausschließlich Mitglieder derselben reinen Abstammung, Überlebende, die ihren Stammbaum bis zu einer bestimmten Stadt oder Region zurückverfolgen konnten. Dieser Stammbaum entschied darüber, wem man angehörte. Man heiratete ausnahmslos jemanden aus demselben Wurzelholz, damit die Kinder einen klar gezeichneten Stammbaum besaßen. Diese Kinder sollten das Shtetl in ihren Adern lebendig halten. So existierten Städte wie Bobowa und Wischnitza und Klausenberg und Sanz und Pápa und Gur weiter, weil die Nachkommen ihrer Einwohner nicht vergessen hatten, woher sie kamen. In abgesonderten Vierteln in Brooklyn hatten sie ihrem Genpool eine neue Form gegeben, Viertel, deren Grenzen nun, gleichwohl nicht sichtbar markiert, doch tief in unser kollektives Bewusstsein eingeprägt waren und unsere Orientierung in Raum und Zeit bestimmten.
Das Shtetl, dem wir angehörten, hieß Satmar, ursprünglich ein Städtchen unweit der Häuser, in denen meine Großeltern ihre Kindheit verbracht hatten. Auch die Satmarer, zu denen meine Großeltern wegen dieser einstigen geografischen Nähe von Natur aus zählten, waren davon besessen, alles in der Familie zu halten. Onkel heirateten Nichten, Cousins Cousinen. Unser Genpool wurde kleiner und kleiner, der Kreis um uns herum dünnte zusehends aus. Unsere nächsten Nachbarn, die Halberstams, waren Sohn und Tochter zweier Brüder, und als eins ums andere ihrer Kinder mit Mukoviszidose geboren wurde, genau genommen sieben von neun, schienen höhere Mächte davon Notiz zu nehmen. Etwas musste mit diesen armen Kindern geschehen, an deren entstellte Körper ich mich noch gut erinnere, und daran, wie sie auf ihren speziellen Rollstühlen in der nachmittäglichen Schabbat–Sonne lümmelten, während ihnen die von der Medicare bezahlten Betreuer den Sabber vom Kinn wischten. Später habe ich oft über die Ironie in der Bedeutung ihres Nachnamens nachgedacht, Halberstam. Indem sie alles in der Familie hielten, hatten sie ihren Stam so sehr geschwächt, ihren Genpool so weit reduziert, dass er zu ihrem Verderben führte.
Also begannen sie mit ihrem Testprogramm, und als ich fünfzehn war, kamen Ärzte in weißen Laborkitteln in unser Klassenzimmer und packten ihre Ausrüstung auf den schäbigen Tischen aus, während wir Schlange standen, um ihre Röhrchen mit unserem Blut zu füllen. Eine nach der anderen rollten wir unsere Ärmel hoch, bissen die Zähne zusammen, wenn die Nadel die Haut durchstach, und versuchten, einander keine Schwäche zu zeigen. Danach liefen wir in der Cafeteria umher, jede einzelne von uns mit einer mit Tapeband befestigten Mullkompresse auf dem Unterarm. Uns allen war klar, dass wir gerade volljährig geworden waren: Im nächsten Jahr würde man beginnen, uns unter die Haube zu bringen, aber bevor das geschehen konnte, mussten sie unser genetisches Profil analysieren. Dor Yeshorim hieß das Programm: Die aufrechte Generation. Um die Tradition der Verwandtenheirat aufrechterhalten zu können, um weiterhin von den anderen abgesondert leben zu können, mussten wir sicherstellen, dass wir nicht wie die Halberstams Krankheiten zu züchten begannen. Bevor wir also mit unseren zukünftigen Gatten verheiratet wurden, verglichen sie unsere Gene miteinander, stellten sicher, dass wir nicht Träger der nämlichen Mutationen waren, dass unsere Profile einander ähnelten, aber eben nicht zu sehr. Wir aber haben nie erfahren, was sie in unserem Blut gefunden haben mochten. Es wurde unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in einer Bank aufbewahrt. Wir erhielten einfach nur eine Nummer, die wir mit jeder anderen Nummer in Beziehung setzen konnten. Dann war es nur noch eine Frage des Vergleichs, und die Antwort ein einfaches Ja oder Nein.
Zwei Jahre später sollte ich die Bank anrufen, ihr meine Nummer durchgeben, und dann die meines voraussichtlichen Ehemanns. Mit stockendem Atem erwartete ich die Antwort. Da war noch immer diese alte Angst in mir, dass dort etwas gefunden werden mochte, das nicht dazugehörte, etwas, das erklären würde, warum ich war, wie ich war.
»Mazel Tov!«, sagten sie. »Du wirst viele gesunde Kinder haben.«
Und das war alles, was zählte. Sollten sie eine Unstimmigkeit in meinem Blut gesehen haben, dann haben sie darüber kein Sterbenswörtchen verloren.
Es gibt ein Wort im Jiddischen, das ich allzu oft in meiner Kindheit gehört habe, ein Wort, das mir die Wirbelsäule versteifte und das Blut in die Wangen schießen ließ: Dieses Wort lautet Yichus. Es war für mich ein so bedeutungsschwangeres Wort, da ich mich vor ihm, so hilfreich es auch bei der Erzeugung von Hierarchie und Prestige war, ungeheuer fürchtete. So oft ich es hörte, rief es mir in Erinnerung, dass ich an allem nur den zerbrechlichsten Halt hatte und somit dazu verdammt war, einen endlosen Kampf zu führen, um nicht wie Sediment auf den Boden der Gesellschaft abzusinken.
Das Wort Yichus geht auf den alltäglichen und harmlosen hebräischen Begriff für ›Verwandtschaft‹ zurück, im Jiddischen aber meint es eher so etwas wie ›edle Abstammung‹; es ist ein Wort, das einem Individuum in Abhängigkeit von seinen Vorfahren Wert zumisst. In unserer Gemeinschaft besetzten Familien mit Yichus beneidenswerte Positionen. Sie waren unsere Ausgabe der Aristokraten. Diese Familien hüteten Urkunden, die ihre tadellose genetische Linie bewiesen, wie ihren Augapfel. Diese Beweisstücke legten sie Ehestiftern vor und verlangten, dass man ihnen für ihre Söhne und Töchter nur solche Vorschläge unterbreite, die ihrer Ahnentafel auch geziemten. Meine eigene Verbindung, welche Vorfahren auch immer ich hätte geltend machen können, war durch die skandalös missratene Vereinigung meiner Eltern und das daraus entstandene Chaos zerrissen, das sich schlagartig in meiner Familie ausgebreitet hatte wie ein permanenter Fleck, der seitdem an jener Faser nagte, die uns mit der Gemeinde verband, einem Gewebe, das auf ungebrochene Ehebündnisse und ununterbrochene Ahnenfolgen angewiesen war.
Als ich vierzehn war und die neunte Klasse meiner religiösen Mädchenschule erreicht hatte, bestand das Jahresprojekt in der Erstellung und Präsentation unserer Stammbäume. Kaum war dies in der ersten Schulwoche verkündet, löste es bei mir eine Welle verheerender Panik aus. Ich lief nach Hause und konnte meine Tränen nur schwer zurückhalten, bis ich schließlich in der Küche meiner Großmutter landete. Dieses Projekt verhängte das Urteil der Verdammung über mich. Ich wusste, ich war reif für eine weitere Demütigung. Während die Mädchen in meiner Klasse ihre illustren Ahnentafeln präsentierten, ihre intakten und strahlenden Stammbäume, wäre ich gezwungen, die Gebrochenheit meiner Familie zur Gänze offenzulegen. Ich wäre für immer das Mädchen mit dem entstellten Baum.
Bubby genügte ein Blick, und schon ließ sie das Bällchen Hackfleisch, das sie gerade zu Faschirt formte, auf die Arbeitsfläche fallen. Sie wusch sich die Hände und zog eine Papiertüte aus einem Versteck oben vom Küchenschrank. Sie hatte dort einen Vorrat an schokoladeüberzogenen Orangenschalen, den sie für Notfälle wie diesen bereithielt. Wortlos reichte sie mir ein Stück, damit ich es mampfen konnte, und biss selbst von einem ab. Ich schaute ihr zu, wie sie gedankenvoll kaute, und wartete auf die Lösung, die sie sicherlich ausheckte.
»Nun, eigentlich hat jeder ein wenig Yichus«, sagte sie. »Wenn du dir einen x-beliebigen Stammbaum nur genau genug vornimmst, wie solltest du da nicht über einen kleinen Rabbi stolpern, irgendeinen untergeordneten Heiligen? Ich wette, wenn wir nur genügend weit zurückgehen bei unserer Suche, können wir ausreichend viele Rabbiner zusammentrommeln, um selbst eine Hanna Rokeach vergleichsweise klein aussehen zu lassen.«
Sie scherzte, damit ich mich besser fühlte. Wir beide wussten, dass es keine Chance gab, Hanna Rokeach zu schlagen, die zwar allen Gesetzen der Logik zufolge wegen ihres erbärmlichen Aussehens (was hauptsächlich einem sehr tiefliegenden Haaransatz geschuldet war) hätte leiden müssen, die sich aber aufgrund ihrer »Verwandtschaft« stets eines beneidenswerten Prestiges innerhalb der Gemeinschaft erfreuen konnte.
Ich schöpfte Mut bei dem, was meine Großmutter mir versicherte. Sie musterte meine Panik kühl, befähigt, sich einzufühlen, zugleich aber davor gefeit, der nämlichen Angst, nicht anerkannt zu werden, aufzusitzen. Meine Bubby benötigte keine Anerkennung, denn ihre Welt endete mit den Mauern ihres Eigentums; solange sie ihre Küche hatte und ihren Garten, brauchte sie nichts und niemanden. Ich versuchte jeden Tag verzweifelt, mich dort draußen als würdig zu erweisen, war ich doch noch immer jung und naiv genug zu glauben, dass diese Welt mir den inneren Frieden schenken würde, nach dem ich mich so sehr sehnte.
»Ich werde dem Großonkel schreiben, der uns geholfen hat, die Ehe deiner Eltern zu arrangieren«, sagte Bubby, die noch immer auf einer Faser Orangenschale kaute. »Er wird die mütterliche Seite des Baums ausfüllen können.«
Ich wollte sie in diesem Augenblick umarmen, wagte es aber natürlich nicht. Ich hatte sie noch nie umarmt und würde es niemals tun. Das gab es in unserer Welt schlicht und einfach nicht. Hätte ich die ungeschriebenen Gesetze gebrochen und einen Arm um ihre Schultern gelegt, so kann ich mir nur vorstellen, dass sie dies zutiefst beunruhigt hätte, ja vielleicht sogar verängstigt. Gefühle waren in unserer Welt unglaublich gefährlich. Erhöhtest du nicht, wenn du zeigen solltest, wie wichtig jemand für dich war, die Wahrscheinlichkeit, dass das Universum ihn dir nehmen würde, sobald die Zeit für eine Bestrafung gekommen wäre?
Aber ich liebte sie sehr an diesem Tag, und ich werde mich immer daran erinnern, denn ihre Sorge um mich war ausreichend groß gewesen, mir helfen zu wollen, das gähnende Loch in mir zu füllen, das nach Wurzeln flehte, nach so vielen wie möglich, damit ich fühlen konnte, wie sie sich in den Boden eingraben würden, und mir sicher sein durfte, dass selbst ein starker Wind nicht einfach kommen und mich von meiner Position hinunterstoßen konnte.
»Aber dies war die Botschaft. Und sie enthielt genügend Wahrheit – so, wie jede Verleugnung sich mit Teilwahrheiten betäubt –, um bis auf Weiteres unbeantwortet zu bleiben, und mich trunken und ausgetrocknet, an der Wurzel gespalten, nach Klarheit, nach Luft gierend zurückzulassen.«
Adrienne Rich, aus dem Essay Split at the Root
MONATE SORGSAMER FORSCHUNG FOLGTEN. Ich fing an, meinem Großvater mit Stift und Notizblock zu folgen, stellte ihm Fragen über eine Vergangenheit, die ihm größtenteils unbekannt war, da er zu jung und naiv gewesen war, den richtigen Personen, als diese noch gelebt hatten, die wichtigen Fragen zu stellen. Denn wenn Menschen leben, das war mir bewusst, nehmen wir sie als gegeben hin, am Verlust jener Generation hatte ich diese Lektion stellvertretend gelernt, und so war ich fest entschlossen, nichts von der Zeit zu verschwenden, die mir mit diesen Menschen noch blieb, die eines Tages dahingegangen sein würden. Eines Tages, wenn es zu spät geworden sein würde, jene Fragen zu stellen, die mein Bewusstsein zu martern beginnen würden, während sie doch als Kind einfach in meinem Blickfeld aufgeschienen waren wie angenehme Kuriositäten. Ungeduldig wurde ich an die vernachlässigten Archive vergilbten Papiers im Erdgeschossbüro meines Großvaters verwiesen, wo ganze Räume zum Depot einer Vergangenheit umfunktioniert worden waren, von der niemand den Wunsch hegte, sie je noch einmal aufzusuchen. Ich durchkämmte Kisten voller vergilbter Briefe und brüchig gewordener Dokumente mit Wasserzeichen, die mich dazu befähigten, neue Fragen zu formulieren, auf deren Grundlage ich Briefe in verkrampfter jiddischer Schrift an neu entdeckte entfernte Verwandte und ehemalige Nachbarn schrieb, die alle eine erhebliche Distanz zwischen sich und alles Damalige gesetzt zu haben schienen. Als die Antworten zögerlich, doch höflich eintröpfelten, begann sich ein Baum zu formen. Bubby hatte recht behalten: Jeder Baum trägt irgendwann einmal eine perfekte Frucht. Sieben Generationen zurück auf der Seite des Großvaters der Großmutter meiner Großmutter fand ich einen Lamed Vavnik.
Diese Entdeckung war vielleicht der Höhepunkt meiner Forschung, obwohl, wie Bubby es versprochen hatte, auch andere niedrig gestellte »Heilige« auftauchten, etwa der weise Talmudist Amram Chasida oder der Kriegsheld Michoel Ber Weissmandel auf der Seite meines Großvaters, sowie andere Rabbiner aus Kleinstädten, die schmale Bände liturgischer Texte verfasst hatten, welche man wohl nur noch in den Bibliotheken leidenschaftlicher Sammler findet. Bubby hatte mir gegenüber die Möglichkeit geäußert, dass es in ihrer Familie einen Lamed Vavnik geben könnte. Als Kind waren ihr Geschichten erzählt worden, die sie mir oft wiedererzählt hatte, aber sie war sich niemals sicher, ob er wirklich existiert hatte, und falls ja, ob er auch wirklich ein Vorfahre war. So machte ich mich daran, die vergessenen Glieder der Kette zu rekonstruieren, die die beiden miteinander verband.
Ein Lamed Vavnik, das muss man wissen, ist keine Kleinigkeit. Er war wohl die größte Entdeckung, die ich hatte machen können. Er entsprach einem Joker, er schlug alles andere. Die Ahnenreihen der meistgeschätzten Rabbiner-Familien wurden gegenüber dem magersten Stammbaum unbedeutend, wenn dieser irgendwann einmal einen der sechsunddreißig verborgenen Gerechten hervorgebracht hat.
Meine Großmutter erinnerte sich seiner unter dem Namen Reb Leibele Oshvari, wusste aber keinen authentischen Familiennamen, da er fünf Generationen auf der mütterlichen Seite der Mutter ihrer Mutter zurückreichte und ein Lamed Vavnik, zu Lebzeiten stets für Anonymität sorgend, nach seinem Tode häufig auf diese Weise in Erinnerung bleibt. Er hatte darum gebeten, dass auf seinem Grab schlicht Leibel aus der Stadt Oshvar stehen solle. Schon von fern wusste man, dass es sich um sein Grab handelte, war meiner Großmutter berichtet worden, da man einen besonderen Zaun um das Grab herum hatte aufstellen müssen, nachdem einigen Menschen, die ihm zu nahe gekommen waren, schlimme Dinge widerfahren waren. Man musste frei von Sünde sein, wollte man das Grab eines Lamed Vavnik berühren, und da es selten vorkam, dass ein Mensch solcher Art war, stellte man einen Zaun auf, um vor der Gefahr der heiligen Energie zu schützen, die über seiner Grabstätte schwebte. Das ist der Grund, sagte sie, warum man wusste, dass er ein Zadik nistar war. Man fand es heraus, als all die Witwen und Waisen, die er im Verborgenen unterstützt hatte, sich plötzlich ohne Hilfe wiederfanden und damit wurde klar, wer sich all die Jahre über als mildtätig erwiesen hatte. Eine solche Entwicklung war ein typischer Indikator für die Anwesenheit eines Lamed Vavnik.
»S’is lamed vav Zadikim nistarim«, hatte mir mein Großvater häufig erzählt: Es sind hineingeboren in jede Generation sechsunddreißig verborgene Gerechte. Das war eine der großen mystischen Kernlegenden im chassidischen Glauben. Diese sechsunddreißig heiligen Männer trugen den Spitznamen ›Säulen der Welt‹, denn man glaubte, sie seien besonders reine Seelen, dank derer Verdienste die Welt weiterbestehe, aller verheerenden Sünde zum Trotz. Solange sie existierten, würde Gott die Welt sich drehen lassen, unabhängig davon, wie sehr ihn das Menschengeschlecht auch enttäuschte. Verschwände aber auch nur einer von ihnen, fände die Welt umgehend ihr Ende, da Gottes Duldsamkeit dann erwartungsgemäß ihr Ende erreicht haben würde.
Zeidi sagte, dass die Lamed Vav existierten, um Gott zu gemahnen, dass er mit der Schöpfung des Menschen etwas Gutes erschaffen habe. Sie repräsentierten das Beste, was ein menschliches Wesen erreichen konnte. Sie waren bekannt für ihre extreme Demut und Selbstlosigkeit, vollbrachten ihr ganzes Leben lang Gutes, ohne sich je einer entsprechenden Anerkennung zu erfreuen. Sie entsagten allen Annehmlichkeiten mit dem Ziel, anderen zur Seite zu stehen. Niemand war zu gering, ihre Mildtätigkeit zu verdienen. Was die verborgenen Gerechten von den gewöhnlichen Heiligen unterschied, war gerade ihre Zurückhaltung. Normale chassidische Heilige wurden wie Könige verehrt, sie pflegten einen Lebensstil, der sich für Menschen mit begeisterter Gefolgschaft geziemte. Ein Lamed Vavnik aber trachtete danach, jegliche Nutznießung seiner geistigen Erhabenheit auszuschlagen, er bewahrte Stillschweigen um seine Heiligkeit und litt wegen seines trügerischen äußeren Erscheinungsbildes von Armut und Unwissenheit häufig unter Verspottung und Zurückweisung, wodurch er den höchsten Grad an Heiligkeit erreichte. Ein öffentlicher Zadik, traf er auf einen Zadik nistar, konnte gar nicht anders, als schamvoll seinen Kopf zu beugen, da die Insignien, denen er frönte, ihn an die weltliche Ebene banden. Nie würde er Gott so nahe sein wie ein verborgener Heiliger. Wie auch immer, selbst dem heiligsten Zadik war die Anwesenheit eines Lamed Vavnik in seiner Nähe wahrscheinlich nicht bewusst. Damit das System unversehrt blieb, verlangte es, dass der verborgene Heilige verborgen blieb. Es geschah erst nach seinem Tode, dass seine Heiligkeit entdeckt, seinem Andenken gehuldigt werden konnte. Erst dann konnte er seinen Nachkommen Gutes tun, ja, selbst so entfernten und bedauernswerten Nachkommen wie mir. War ich denn nicht die perfekte Anwärterin für den Segen eines Lamed Vavnik? Selbst gedemütigt und verspottet, besaß vielleicht auch ich einen verborgenen Kern Rechtschaffenheit? Und selbst, wenn dem nicht so war, wer denn konnte behaupten, dass es auszuschließen wäre? Wenn die Zeit kommen sollte, meinen Stammbaum vor der Klasse zu präsentieren, würde die Tatsache, dass ich, tief vergraben, verborgen in den Wurzeln meines Baums, einen Lamed Vavnikvorweisen konnte, jegliche mögliche Kritik zum Schweigen bringen.
Was auch immer meine Nachforschungen noch ergeben sollten, mein Problem war grundsätzlich gelöst. Leibel aus Oshvar würde aus dem Herzen meiner Präsentation hervorscheinen, und jede einzelne meiner Altersgenossinnen wäre zu respektvoller Ruhe gezwungen. Vielleicht würden sie auch Spekulationen über mich anstellen, sich fragen, ob ich solcherlei Gene geerbt hätte, und ob meine unglücklichen Umstände nicht schlicht und einfach als geistreiche Abscheulichkeit dienen sollten, um meine Heiligkeit davor zu bewahren, entdeckt zu werden.
Gewappnet mit einem neuen Gefühl der Ruhe und des Vertrauens, vervollständigte ich die weitreichenden Äste meines Familienstammbaums und wusste, dass der schwerste Teil meiner Aufgabe auf spektakuläre Weise erfüllt war. Als der letzte Brief von Großonkel Menachem, dem jüngsten Onkel meiner Mutter, ankam – abgestempelt in Bnei B’rak, in Israel –, riss ich ihn nicht einfach mit meinen Fingern auf. Ich nahm stattdessen den silbernen Brieföffner meines Großvaters, und schlitzte den Brief vorsichtig an der Seite auf. In ihm befanden sich sorgsam beschriftete Fotografien und ein peinlich sauber gezeichnetes Diagramm familiärer Beziehungen, das ich mir mit nur geringer Neugier anschaute. Bar jeglicher Kenntnisse über die Vorfahren meiner Mutter, überraschte es mich allerdings, nun von der neuen, komplexen Verflechtung von Ästen zu erfahren, von Zweigen, die bis in weit entfernt liegende Winkel Europas zurückreichten. Am meisten aber überraschte es mich, in Erfahrung zu bringen, dass der Ast, der meine Mutter hervorgebracht hatte, seine Ursprünge in Deutschland fand. Da war mir etwas in die Hände gefallen, das ich mir nicht leisten konnte, groß zur Schau zu stellen.
Meine Mutter musste also ausgerechnet eine Yekke sein. Dies war der abschätzige Ausdruck, den wir für die deutschen Juden verwendeten, die in unseren Augen ihre jüdische Lebensweise aus Scham und Selbstverachtung aufgegeben und schließlich ersetzt hatten durch eine angemessenere kulturelle Identität. Yekkes waren dafür bekannt, extreme Varianten stereotyper deutscher Charaktereigenschaften aufzuweisen, sie standen im Ruf, pünktlicher zu sein als die Deutschen selbst, galten als versessen auf genaueste Berechnungen, Vorschriften und Regeln. Man sagte, es mangele ihnen an Herz, ihre Häuser hätten nicht diese Wärme, für die andere aschkenasische Gemeinschaften bekannt waren. Yekkes sprachen Deitschmerisch, einen herausgeputzten, hochnäsigen Dialekt des Jiddischen, der niemals so klingen würde wie das Hochdeutsch, das sie zu imitieren suchten. Sie hielten ihre Pejos kurz, steckten sie sich hinter die Ohren, schnitten ihre Bärte und trugen Anzüge, und all dies, um zu vermeiden, dass ihre jüdische Lebensweise ins Auge sprang. Selbst die Bezeichnung für sie kommt vom deutschen Wort Jacke; die Deutschen hatten diese Bezeichnung erfunden, um den langen schwarzen Mantel zu beschwören, welchen die Juden getragen hatten, bevor sie sich säkularisierten und das Kleidungsstück zugunsten einer zeitgemäßen Mode ablegten. Es ist eine Mahnung, dass ihr Kleidungsstil nur Maskerade war, dass die Deutschen niemals ihre wahre Herkunft vergessen sollten. Yekkes hatten versucht, sich in eine Gesellschaft einzufügen, die sie schließlich nie aufgenommen hat – deshalb war es schmählich, ein Yekke zu sein. Es war das Brandmal dessen, der ein Möchtegern war und der äußerste Zurückweisung erfahren hatte. Meine Vorfahren waren genau das. Ich würde über dieses derbe Brandmal Rechenschaft ablegen müssen. Was sollte ich da erfinden können? Besser, die Geschichte ganz und gar vertuschen.
Natürlich ergab es Sinn, dass meine Familie für meinen Vater eine Yekke ausfindig gemacht hatte. Sie hatten Kompromisse eingehen müssen, so verzweifelt, wie sie versucht hatten, ihn unter die Haube zu bringen. Meine Mutter war die perfekte Kandidatin, arm und aus einem in Stücke zerbrochenen Hause. Abgesehen von ihren Großeltern und ein paar Tanten und Onkeln war der gesamte Zweig ihrer Familie durch den Krieg ausgelöscht worden und mit ihm die Erinnerung an alles, das vielleicht als unerfreulich hätte gelten können. Als sie den Atlantik überquerte, um sich der Familie meines Vaters anzuschließen, war ihre Herkunft vergessen, sie streifte sich die neue familiäre und gemeinschaftliche Identität schlicht und einfach auf jene Weise über, wie man sich ein locker sitzendes Kleid überwirft. So war genügend Stoff vorhanden, um darunter eine Unmenge an Sünden zu verbergen.
Ich war verwirrt, dass, gleichwohl Großonkel Menachem mir eine Menge unbedeutender Details über die Leben von längst verstorbenen Cousins zweiten Grades angeboten hatte, es doch überraschend wenig Informationen über seine Eltern selbst gab, die 1939 aus Deutschland geflohen waren. Ich hatte die Namen der Eltern seiner Mutter, und einige Dokumente, die deren Existenz bekräftigten, aber über die Eltern seines Vaters, meine anderen Urgroßeltern, gab es so gut wie nichts. Die Stelle in seiner Geburtsurkunde, an der der Name seines Vaters hätte stehen müssen, war leer. Macht nichts, dachte ich. Ein Fehler der Bürokratie, und vielleicht, man schrieb damals das Jahr 1897, ein Produkt seiner Zeit.
Als ich Monate später schließlich mein Projekt in der Schule präsentierte, hatte ich eine prächtige Karte erstellt, die an einigen Stellen bis zu neun Generationen zurückreichte, über meinen mütterlichen Großeltern aber klaffte eine auffällige Leere. Damals zerstreute ich mein Publikum und mich selbst mit all den neuen Informationen, die ich über die glanzvolle Geschichte der väterlichen Seite meiner Familie zusammengetragen hatte. Und doch sollte ich am Ende all jene Informationen nutzen können, die ich als Vierzehnjährige gewissenhaft zusammengetragen und aufbewahrt hatte, als ich Jahre später als Erwachsene nach Europa reiste, auf der Suche nach einer neuen Identität und in gewisser Weise nach einer neuen Geschichte. Erst als ich die Entscheidung traf, Bürgerin Europas zu werden, besann ich mich wieder auf diese Leere und hielt nach Beweisen Ausschau, die mir helfen konnten, einer deutschen Bürokratie, die mich anscheinend unbedingt ausschließen wollte, Argumente entgegenzusetzen.
Ich werde niemals vergessen, wie mir das Blut an jenem Tag in den Adern rauschte, als ich den Anruf meines Einwanderungsanwalts erhielt. Er machte aus mir schlagartig wieder jene Achtjährige, die ich war, als ich zum ersten Mal meiner Großmutter diese eine Frage gestellt hatte, als würde ich tief in mir die Entdeckungen, die ich später erst machen sollte, bereits ahnen.
Aber ich bin mir selbst vorausgeeilt, denn der Weg, der mich bis zu diesem Punkt geführt hat, war lang, und das volle Gewicht dessen, was geschah, als mir mein Anwalt seine Entdeckung mitteilte, kann man nur erfassen, wenn man die Geschichte kennt, die genau hierin mündete.
»Einem Traum ähnlich, der sich auf einen Traum türmt, war dieses neue Amerika der Kultur und Bildung.«
Aniza Yezierska, Bread Givers
ICH ZOLLTE MEINEM STAMMBAUM in den Jahren, die nun folgen sollten, keine besondere Aufmerksamkeit. Ich wurde von der Entwicklung meiner eigenen Lebensgeschichte abgelenkt. Für eine Heranwachsende, die an der Schwelle zum Erwachsensein stand, schien die Gründung eines eigenen Familienzweigs bedeutsamer als diese lange schon zu Stümpfen verkümmerten Glieder. Das Jahr, in dem ich mein Projekt in der Schule präsentierte, erwies sich für mich in Bezug auf die Wahrnehmung meiner Person innerhalb der Gemeinschaft als Wendepunkt, da ich mich meinem Ziel, anerkannt zu werden, langsam näher fühlte, war ich doch dabei, mich zu einer achtbaren Kallah Mod zu entwickeln, was ich umso unerbittlicher vorantrieb, als ich sichergehen musste, dass mein verborgenes Ich auch verborgen blieb und mein oberflächliches Ich so gut wie eben möglich dem eines weiblichen chassidischen Prototypen entsprach.
Es bestand die geringe Chance, dass ich mir mit den verdienstvollen Eigenschaften meines Charakters doch noch den Weg zu einer guten Partie ebnen konnte, gewiss keiner perfekten, aber doch einer solchen, die ein wenig über meiner momentanen sozialen Position angesiedelt war. So wie der Lamed Vavnik einen höchst aristokratischen Rabbiner überragte, so mochte es doch gut möglich sein, dass bei den am heftigsten verachteten Personen ein Gran Heiligkeit verborgen war, und ich bemühte mich, mir genau diese Klassifizierung zu erarbeiten. Darin lag meine einzige Chance auf Glück in dieser Welt. Mein Erfolg in diesen Bestrebungen sollte sich jedoch als mein Zugrundegehen erweisen.
Meine Familie entschied, mich an einen jungen Mann zu verheiraten, der fanatisch streng erzogen worden und in einem sehr viel radikaleren Milieu aufgewachsen war als ich selbst. Dies entsprach ihrer Strategie, mich in Schach zu halten. Sie hatten meinen Drang zur Freiheit stets gefürchtet und waren sich sicher, die einzig erfolgreich dagegen einzusetzende Taktik sei die der absoluten Unterdrückung. Da mein Verhalten in diesen Jahren meiner Jugend derart untadelig war, habe ich mir den Eselsdienst erwiesen, den Weg in eine dieser verfrommten Familien für mich zu ebnen.
Nach zwei Jahren unglücklicher Ehe, in denen ein ganzer Katalog religiöser Vorschriften, die mir erst während meiner Verlobungszeit deutlich geworden waren, dafür gesorgt hatte, dass alles nur noch elender werden sollte, entschied ich mich, entweder aus dieser Welt, die für mich immer nur ein Gefängnis von unterschiedlichen Größenmaßen war, zu fliehen oder aber mich umzubringen.
Die Situation erstickte mich beinahe, und da ich soeben meinen Sohn zur Welt gebracht hatte, wollte ich keinesfalls ein Kind dazu verdammen, dasselbe Schicksal erleiden zu müssen. Da es aber ein nur wenig rühmliches Trauerspiel gewesen wäre, auf Suizid zurückzugreifen, ohne die Alternativen vollständig sondiert zu haben, machte ich mich daran, einen konkreten Fluchtplan aufzustellen.
Ich gab mir drei Jahre, eben jene Zeitspanne, die mir noch blieb, bis mein Sohn ins religiöse Schulsystem eingesogen würde. Mein Plan sollte eine Vielzahl praktischer Maßnahmen beinhalten, absolute Priorität jedoch bestand in der Entwicklung einer Methode, mit der ich mich der äußeren Welt zugehörig fühlen konnte, einer Welt, von der ich so gut wie keine Ahnung hatte.
So sollten einige Jahre vergehen, bis es mich erstmals wieder danach verlangte, auf jene sorgfältig zusammengetragenen Dokumente zurückzukommen, die mitzunehmen ich am Tag meiner Abreise den richtigen Instinkt bewiesen hatte. Ich sollte später herausfinden, dass in ihnen die einzig verbliebene Chance lag, meine Identität zu rekonstruieren, in jenen frühen Tagen meines Fortgehens aber sah ich über die Relevanz entlegener familiärer Ursprünge hinweg und versuchte stattdessen, mich in Amerika wiederzufinden, das mir damals ebenso wenig vertraut war wie jedes andere fremde Land auch.
Meinen ersten Schritt in Richtung ›Assimilation‹ hatte ich 2007 unternommen, als ich mich zwei Jahre vor meinem Weggang, im Alter von zwanzig Jahren, heimlich am Sarah Lawrence College einschrieb. Dies war der kritischste Abschnitt von Phase 1. Bildung war das Sprungbrett zum amerikanischen Traum einer beständigen Neuerfindung seiner selbst, so viel hatte ich mit einem kurzen, verstohlenen Blick auf diese Gesellschaft begriffen, innerhalb derer meine eigene Welt gleich einer Luftblase existierte, deren imaginäre Wände sich durch unsichtbaren Druck von außen wie von innen den Anschein von Unumstößlichkeit gaben.
Die religiöse Schulausbildung, die ich absolviert hatte, war natürlich nicht darauf ausgelegt, den staatlichen Standards zur Einschreibung an Universitäten zu entsprechen. Der Zutritt zu dem renommierten College jedoch war mir auf Grundlage dreier Essays möglich, die ich in jenem korrekten und förmlichen Englisch verfasste, das ich mir durch jahrelange Lektüre der Vorkriegsliteratur, die ich wie Schmuggelware unter meiner Matratze verborgen hielt, angeeignet hatte.